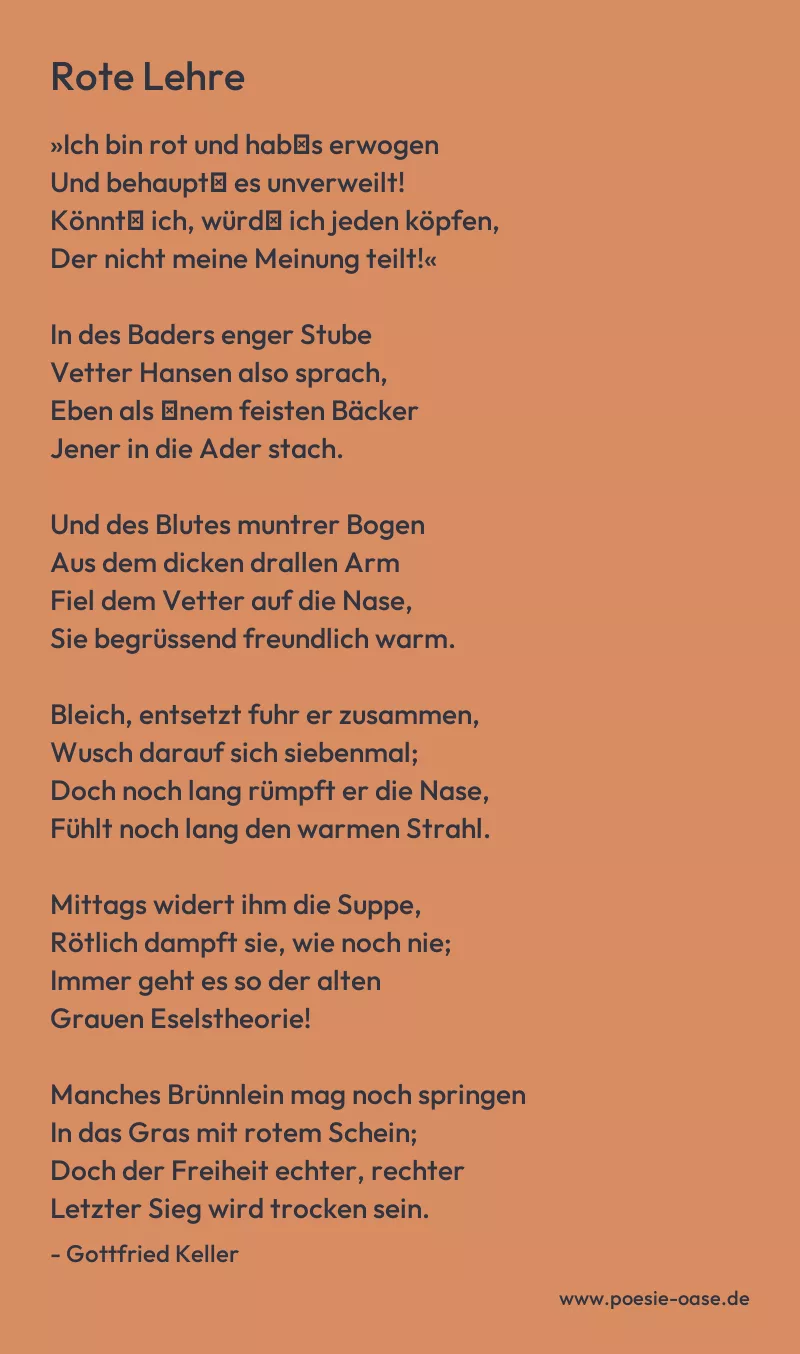Rote Lehre
»Ich bin rot und hab′s erwogen
Und behaupt′ es unverweilt!
Könnt′ ich, würd′ ich jeden köpfen,
Der nicht meine Meinung teilt!«
In des Baders enger Stube
Vetter Hansen also sprach,
Eben als ′nem feisten Bäcker
Jener in die Ader stach.
Und des Blutes muntrer Bogen
Aus dem dicken drallen Arm
Fiel dem Vetter auf die Nase,
Sie begrüssend freundlich warm.
Bleich, entsetzt fuhr er zusammen,
Wusch darauf sich siebenmal;
Doch noch lang rümpft er die Nase,
Fühlt noch lang den warmen Strahl.
Mittags widert ihm die Suppe,
Rötlich dampft sie, wie noch nie;
Immer geht es so der alten
Grauen Eselstheorie!
Manches Brünnlein mag noch springen
In das Gras mit rotem Schein;
Doch der Freiheit echter, rechter
Letzter Sieg wird trocken sein.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
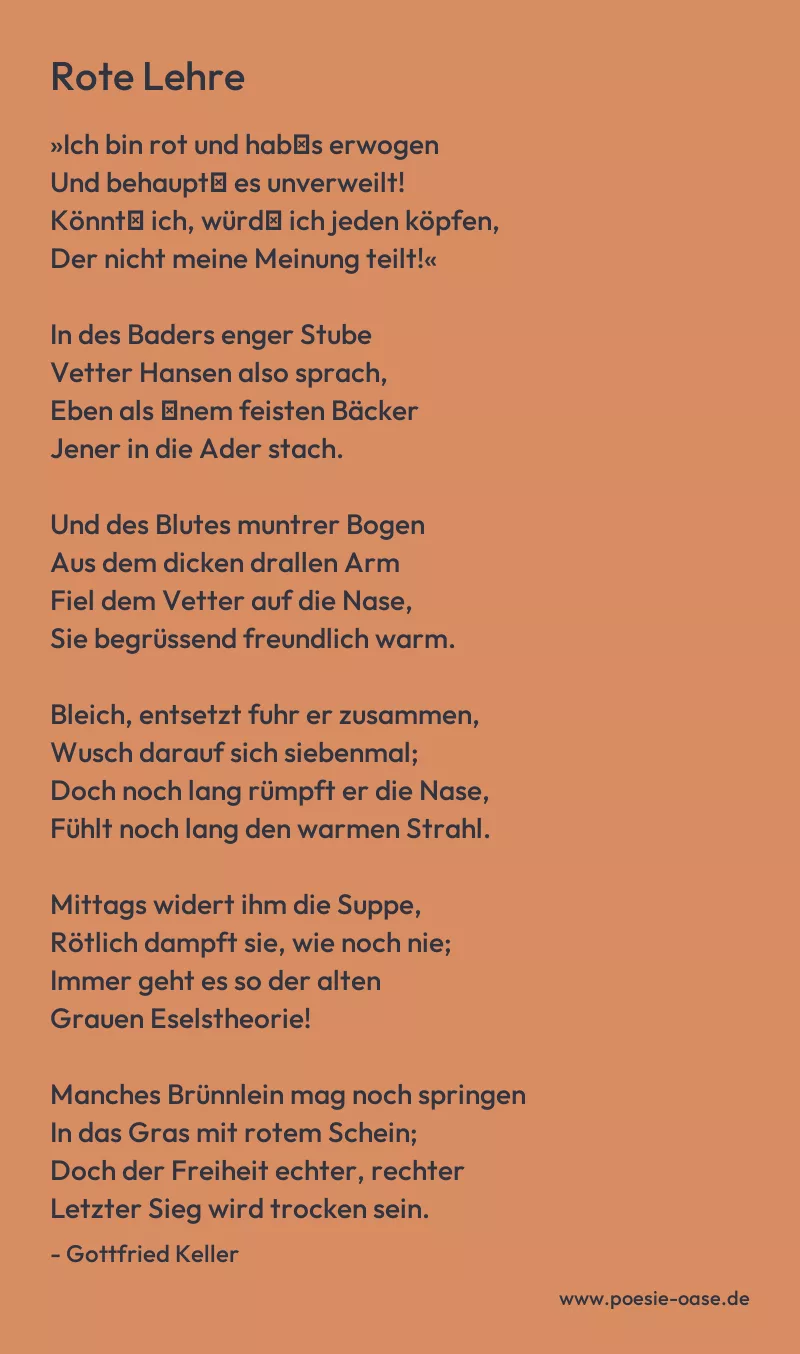
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Rote Lehre“ von Gottfried Keller ist eine satirische Auseinandersetzung mit dogmatischer Ideologie und fanatischer Meinungsvertretung. Das Gedicht beginnt mit einer direkten, selbstbewussten Aussage eines Mannes namens Vetter Hansen, der stolz seine „rote“ Meinung verteidigt und sogar Gewaltandrohungen ausspricht. Diese Haltung wird sofort als übertrieben und absurd dargestellt, wodurch Kellers Kritik an blinder Überzeugung und mangelnder Reflexion deutlich wird.
Die zweite Strophe verlagert die Szenerie in die enge Stube eines Baders, wo Vetter Hansen sich in einer absurden Situation befindet: Während der Bader einem Bäcker einen Aderlass verabreicht, spritzt das Blut des Bäckers auf Hansens Nase. Diese Szene, die zunächst makaber erscheint, entfaltet eine tiefere Symbolik. Das Blut, das als Sinnbild der „roten“ Ideologie Hansens verstanden werden kann, konfrontiert ihn direkt und unerwartet mit seiner eigenen Überzeugung. Der „muntrer Bogen“ des Blutes, der ihn scheinbar spielerisch trifft, unterstreicht die Unverhofftheit und letztlich die Unangemessenheit seiner radikalen Haltung.
Die darauffolgenden Strophen zeigen die Reaktion Hansens auf dieses Erlebnis. Er ist sichtlich schockiert, wäscht sich siebenmal und rümpft noch lange die Nase, was seine anhaltende Abscheu und Irritation symbolisiert. Diese Reaktion auf das Blut, das seine Nase benetzte, deutet an, dass die „rote Lehre“ nicht nur unangenehm ist, sondern auch eine tiefe Abneigung auslöst. Die letzten beiden Strophen verstärken diese Botschaft noch weiter. Die Suppe, die plötzlich rötlich erscheint und ihm ekelt, zeigt die Übertragung seiner Abscheu auf alltägliche Dinge, was seine Sichtweise dauerhaft verändert. Der „alten grauen Eselstheorie“ (die wohl die „rote Lehre“ symbolisiert), die alles beeinflusst, wird eine pessimistische Sicht auf die Zukunft mitgegeben.
Der letzte Vers, der „trockene“ Sieg der Freiheit, deutet auf Kellers Hoffnung auf eine Welt ohne fanatische Ideologien hin, in der die Freiheit des Denkens und die Toleranz gegenüber anderen Meinungen triumphieren. Die „roten“ Ideen, so die Implikation, sind zwar kurzzeitig vorherrschend, doch langfristig werden sie durch die Klarheit und Nüchternheit der Freiheit überwunden. Durch diese satirische Darstellung warnt Keller vor der Gefährlichkeit unreflektierter Ideologien und plädiert für eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Meinung und eine offene Haltung gegenüber Andersdenkenden.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.