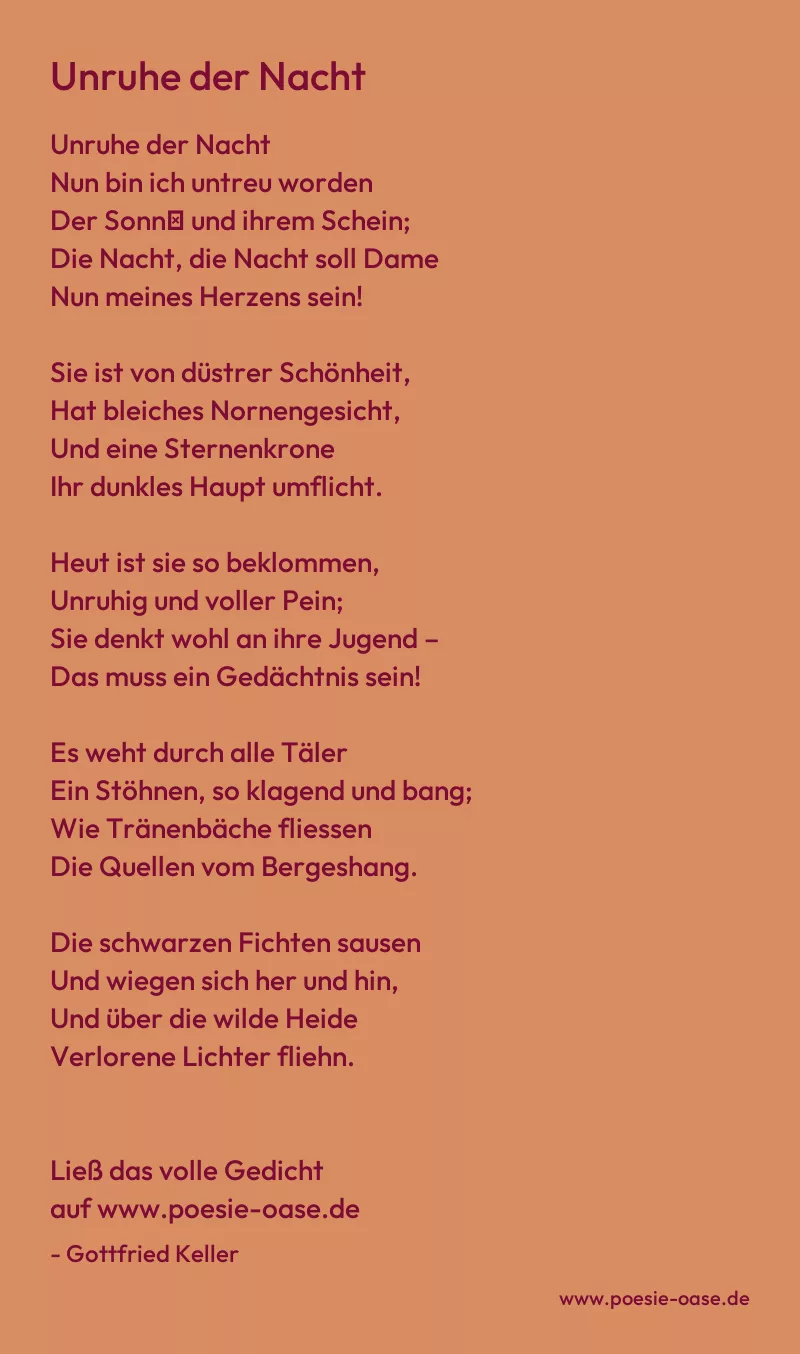Unruhe der Nacht
Nun bin ich untreu worden
Der Sonn′ und ihrem Schein;
Die Nacht, die Nacht soll Dame
Nun meines Herzens sein!
Sie ist von düstrer Schönheit,
Hat bleiches Nornengesicht,
Und eine Sternenkrone
Ihr dunkles Haupt umflicht.
Heut ist sie so beklommen,
Unruhig und voller Pein;
Sie denkt wohl an ihre Jugend –
Das muss ein Gedächtnis sein!
Es weht durch alle Täler
Ein Stöhnen, so klagend und bang;
Wie Tränenbäche fliessen
Die Quellen vom Bergeshang.
Die schwarzen Fichten sausen
Und wiegen sich her und hin,
Und über die wilde Heide
Verlorene Lichter fliehn.
Dem Himmel bringt ein Ständchen
Das dumpf aufrauschende Meer,
Und über mir zieht ein Gewitter
Mit klingendem Spiele daher.
Es will vielleicht betäuben
Die Nacht den uralten Schmerz?
Und an noch ältere Sünden
Denkt wohl ihr reuiges Herz?
Ich möchte mit ihr plaudern,
Wie man mit dem Liebchen spricht –
Umsonst, in ihrem Grame
Sie sieht und hört mich nicht!
Ich möchte sie gern befragen
Und werde doch immer gestört,
Ob sie vor meiner Geburt schon
Wo meinen Namen gehört?
Sie ist eine alte Sibylle
Und kennt sich selber kaum;
Sie und der Tod und wir alle
Sind Träume von einem Traum.
Ich will mich schlafen legen,
Der Morgenwind schon zieht –
Ihr Trauerweiden am Kirchhof,
Summt mir mein Schlummerlied!