Der Kaufmann Harpax starb; sein Leichnam ward sezieret;
Und als man überall dem Übel nachgespüret,
So kam man auch aufs Herz, und sieh! er hatte keins:
Da, wo sonst dieses schlägt, fand man das Einmaleins.
Ein Casus Anatomicus
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
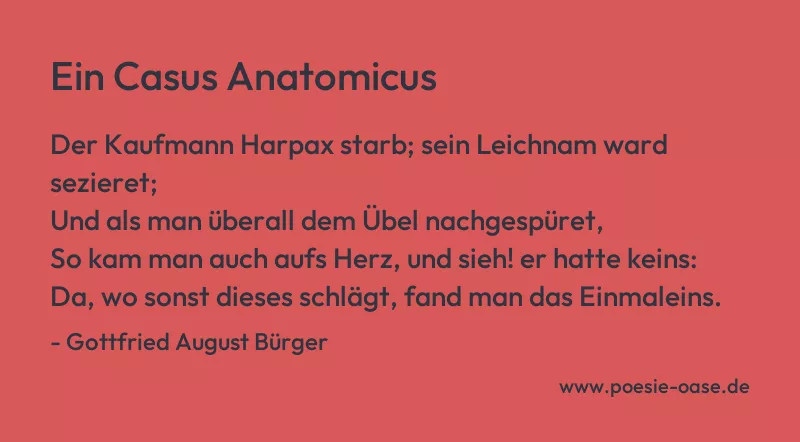
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ein Casus Anatomicus“ von Gottfried August Bürger ist eine bissig-satirische Kritik an der Habgier und dem Materialismus. Es präsentiert in knapper Form ein makaberes Bild, das durch die Gegenüberstellung von Tod, Anatomie und Mathematik einen tiefgreifenden Kommentar auf die menschliche Natur liefert.
Die Geschichte beginnt mit dem Tod des Kaufmanns Harpax, dessen Leichnam seziert wird. Der Fokus liegt dabei auf der Suche nach der Ursache seines Todes und der Analyse seines Körpers. Das eigentliche Pointe des Gedichts kommt jedoch, als die Anatomie des Herzens betrachtet wird. Anstelle des lebendigen Organs, das für Emotionen und menschliche Wärme stehen könnte, finden die Sezierer das „Einmaleins“ – die grundlegenden Rechenregeln, die im Kontext des Kaufmanns für Profitstreben und materielle Interessen stehen.
Die Ironie des Gedichts liegt in der direkten Verbindung zwischen dem toten Körper des Kaufmanns und dem Fehlen jeglicher emotionaler Regung. Bürger suggeriert, dass Harpax‘ Leben von Berechnung, Handel und dem Streben nach Reichtum dominiert wurde, bis der Tod als eine Art natürliche Konsequenz folgt. Das Herz, als Sitz der Seele und des Mitgefühls, wird durch das „Einmaleins“ ersetzt, was die Entmenschlichung des Kaufmanns und die Vorherrschaft des Geldes symbolisiert.
Die Sprache des Gedichts ist einfach und prägnant, was die Wirkung des Gedichts noch verstärkt. Der kurze Reim und die klare Struktur machen die Botschaft sofort verständlich. Durch diese Kürze und Direktheit gelingt es Bürger, die Leser aufzurütteln und zum Nachdenken über die Werte und Prioritäten des menschlichen Lebens anzuregen. Das Gedicht fungiert als eine Art moralischer Fingerzeig, der die Gefahren des unkontrollierten Materialismus aufdeckt und die Leser dazu anregt, die eigene Einstellung zum Leben zu hinterfragen.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
