Apollo stand betäubt durch Söhne seiner Kunst,
Denn jeder singt ihm Dank, oft für weit größre Gunst,
Als ihm der Gott gewährt, und nach verrauschten Chören
Bat Alcon insgeheim Apoll um neue Lehren.
Er kam, vergnügt, zurück. Gleich denkt die ganze Schaar:
Was wird denn eben dem, vor andern, offenbar?
Und einer rief ihm zu: Nun bist du, frei von Fehde,
Voll Gottheit, voll Olymp. Umstirnt mit Wahrheit, rede
Aetherisch! Genius! Uranisch ist dein Ruhm!
Sprich! Was entwölkte dir Apollens Heiligthum?
Er sprach: Ihr Dichter, hört! Mir hat der Gott befohlen,
In meinem Ausdruck mich nicht stets zu wiederholen.
Alcon
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
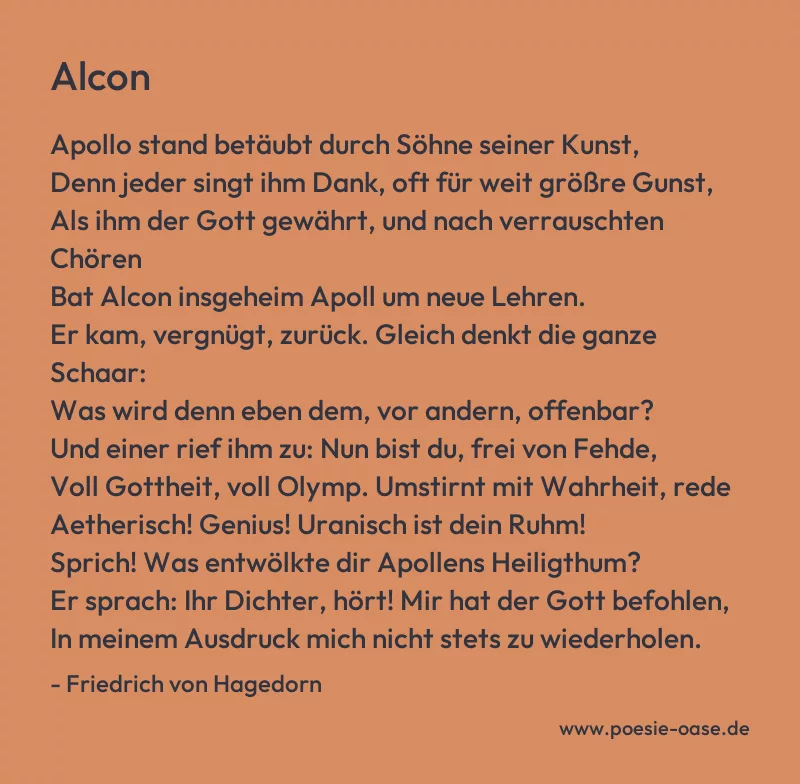
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Alcon“ von Friedrich von Hagedorn ist eine kleine Satire auf die Künstlerwelt und die darin vorherrschende Selbstgefälligkeit und den Hang zur Übertreibung. Es beginnt mit einem Bild des Gottes Apollo, der von den Lobeshymnen der Künstler um ihn herum überwältigt ist. Diese Künstler übertreffen in ihren Lobpreisungen oft die tatsächliche Großzügigkeit Apollos, was die Künstlichkeit und Unehrlichkeit ihrer Huldigungen unterstreicht.
Die eigentliche Pointe des Gedichts liegt in der Figur des Alcon, eines Dichters, der sich still und heimlich um neue Erkenntnisse und Lehren von Apollo bemüht. Seine Rückkehr wird von den anderen Künstlern mit gespannter Erwartung und übertriebenem Lob empfangen. Sie erwarten offenbar eine Offenbarung, die sie in ihrer eigenen Kunst weiterbringt und ihren Ruhm mehrt. Die übertriebene Rhetorik, die sie verwenden, um Alcon zu preisen, ist dabei ebenso amüsant wie entlarvend. Sie sprechen von „Gottheit“, „Olymp“ und „Wahrheit“, was die Lächerlichkeit ihrer Erwartungen verdeutlicht.
Alcons Antwort, die eigentliche Lehre, enttäuscht die Erwartungen der versammelten Künstler jedoch auf drastische Weise. Er offenbart lediglich, dass er angewiesen wurde, sich in seinem Ausdruck nicht ständig zu wiederholen. Diese scheinbar banale Erkenntnis stellt eine subtile Kritik an der Monotonie und der mangelnden Originalität in der Kunstwelt dar. Die Wiederholung des Gleichen, die mangelnde Entwicklung und die fehlende Auseinandersetzung mit neuen Ideen werden hier als Problem identifiziert. Die Pointe ist, dass die erhoffte göttliche Inspiration in der Kunst letztlich in einer simplen Anweisung zur Vermeidung von Wiederholungen besteht.
Hagedorns Gedicht nutzt eine einfache, klare Sprache, um seine Botschaft zu vermitteln. Der Humor ergibt sich aus dem Kontrast zwischen der übertriebenen Erwartungshaltung der Künstler und der nüchternen Antwort Alcons. Die Satire richtet sich gegen die Eitelkeit und Selbstgefälligkeit der Kunstwelt, sowie gegen die Neigung, banale Wahrheiten in pathetischen Worten zu verpacken. Das Gedicht mahnt zur Bescheidenheit, zur Originalität und dazu, die eigenen Ansprüche und Erwartungen kritisch zu hinterfragen.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
