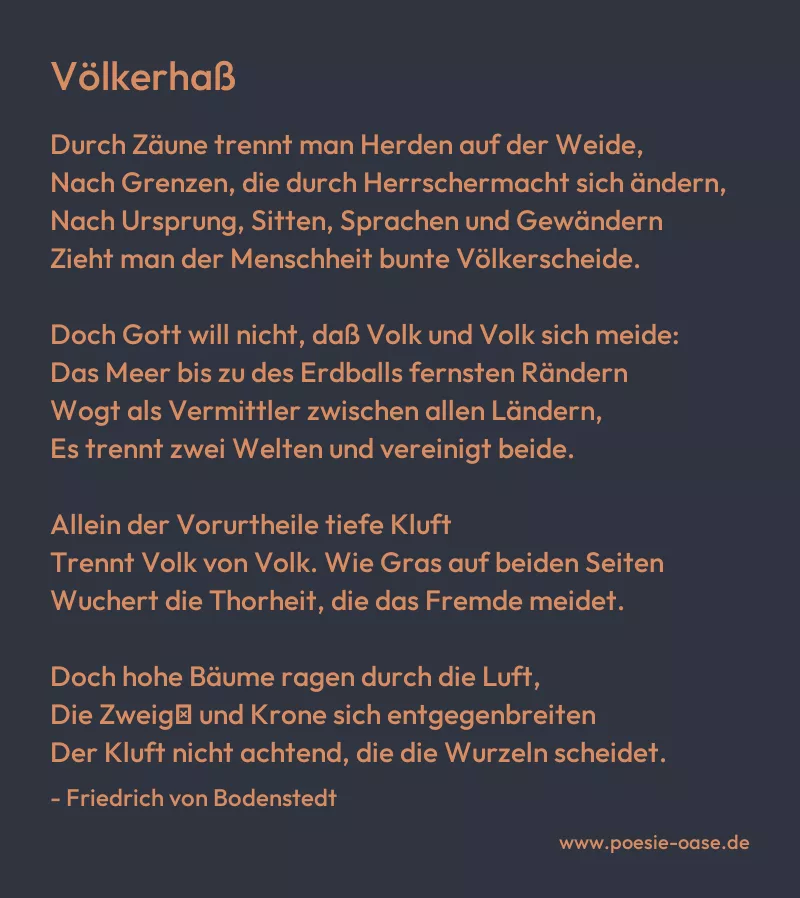Völkerhaß
Durch Zäune trennt man Herden auf der Weide,
Nach Grenzen, die durch Herrschermacht sich ändern,
Nach Ursprung, Sitten, Sprachen und Gewändern
Zieht man der Menschheit bunte Völkerscheide.
Doch Gott will nicht, daß Volk und Volk sich meide:
Das Meer bis zu des Erdballs fernsten Rändern
Wogt als Vermittler zwischen allen Ländern,
Es trennt zwei Welten und vereinigt beide.
Allein der Vorurtheile tiefe Kluft
Trennt Volk von Volk. Wie Gras auf beiden Seiten
Wuchert die Thorheit, die das Fremde meidet.
Doch hohe Bäume ragen durch die Luft,
Die Zweig′ und Krone sich entgegenbreiten
Der Kluft nicht achtend, die die Wurzeln scheidet.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
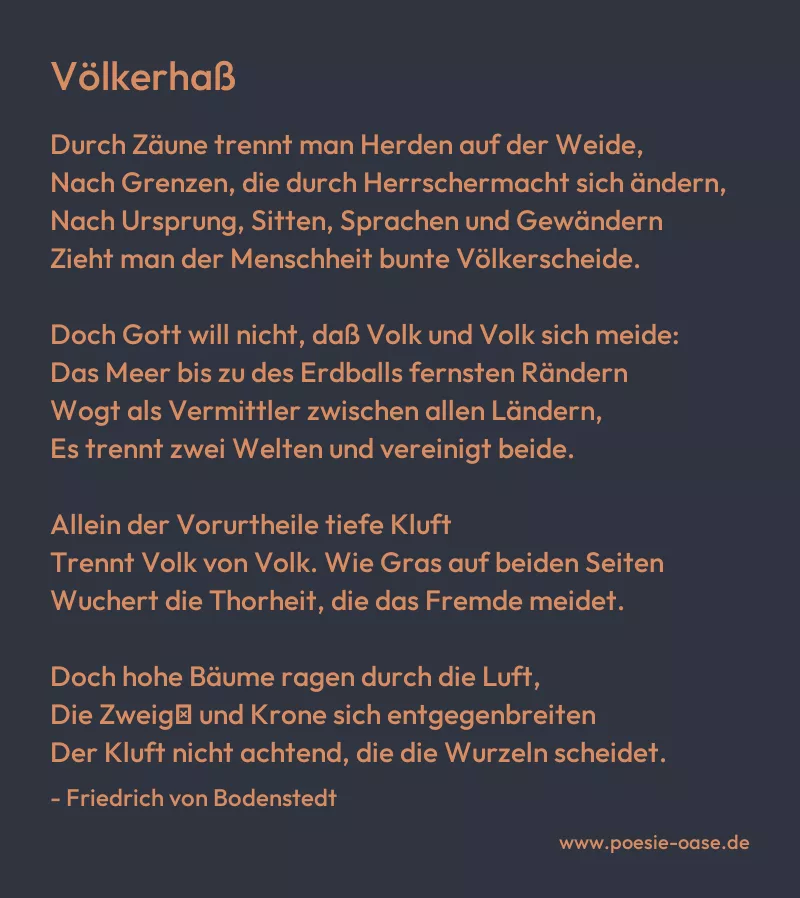
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Völkerhaß“ von Friedrich von Bodenstedt ist eine eindringliche Mahnung gegen die künstlichen Trennungen und den Hass zwischen Völkern, die durch menschliche Konstrukte wie Grenzen und Vorurteile entstehen. Das Gedicht beginnt mit einem Bild der Trennung: „Durch Zäune trennt man Herden auf der Weide.“ Diese Metapher deutet auf die künstlichen Barrieren hin, die zwischen den Völkern errichtet werden, und kritisiert die willkürliche Natur dieser Trennungen, die auf „Herrschermacht“, „Ursprung, Sitten, Sprachen und Gewändern“ basieren. Der Dichter stellt fest, dass diese Trennungen der „Menschheit bunte Völkerscheide“ widersprechen.
Im zweiten Teil des Gedichts wird die ursprüngliche Absicht des göttlichen Schöpfers betont: „Doch Gott will nicht, daß Volk und Volk sich meide.“ Hier wird eine Gegenüberstellung von menschlicher Teilung und göttlicher Einheit etabliert. Das Meer dient als Metapher für die Vermittlung und Verbindung zwischen den Völkern, indem es „zwischen allen Ländern“ vermittelt und diese miteinander verbindet. Das Meer wird als Symbol der Verbundenheit eingesetzt, das zeigt, wie die Welt aus der göttlichen Perspektive gesehen werden sollte, im Gegensatz zur Engstirnigkeit menschlicher Trennungen.
Die zentrale These des Gedichts wird in den folgenden Versen ausgedrückt: „Allein der Vorurtheile tiefe Kluft / Trennt Volk von Volk.“ Hier wird die eigentliche Ursache des Völkerhasses benannt: die Vorurteile, die wie eine tiefe Kluft zwischen den Völkern liegen. Das Bild des „Gras[es] auf beiden Seiten“, das „Thorheit“ verkörpert und das Fremde meidet, verstärkt diese Kritik an der menschlichen Ignoranz und dem Misstrauen.
Das Gedicht endet mit einem Hoffnungsschimmer, indem es die Metapher von „hohe[n] Bäume[n]“ verwendet, die trotz der Trennung ihrer Wurzeln durch die Luft ihre „Zweig′ und Krone“ ausbreiten. Diese Metapher symbolisiert die Möglichkeit der Überwindung von Vorurteilen und der Verständigung zwischen den Völkern. Die Bäume, die sich trotz der Trennung der Wurzeln in den Kronen begegnen, stehen für die Möglichkeit der Einheit und des Friedens, die trotz aller Trennungen bestehen kann, wenn die Menschen sich von ihren Vorurteilen befreien und sich einander zuwenden. Das Gedicht ist somit ein Aufruf zur Überwindung von Hass und zur Suche nach Einheit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.