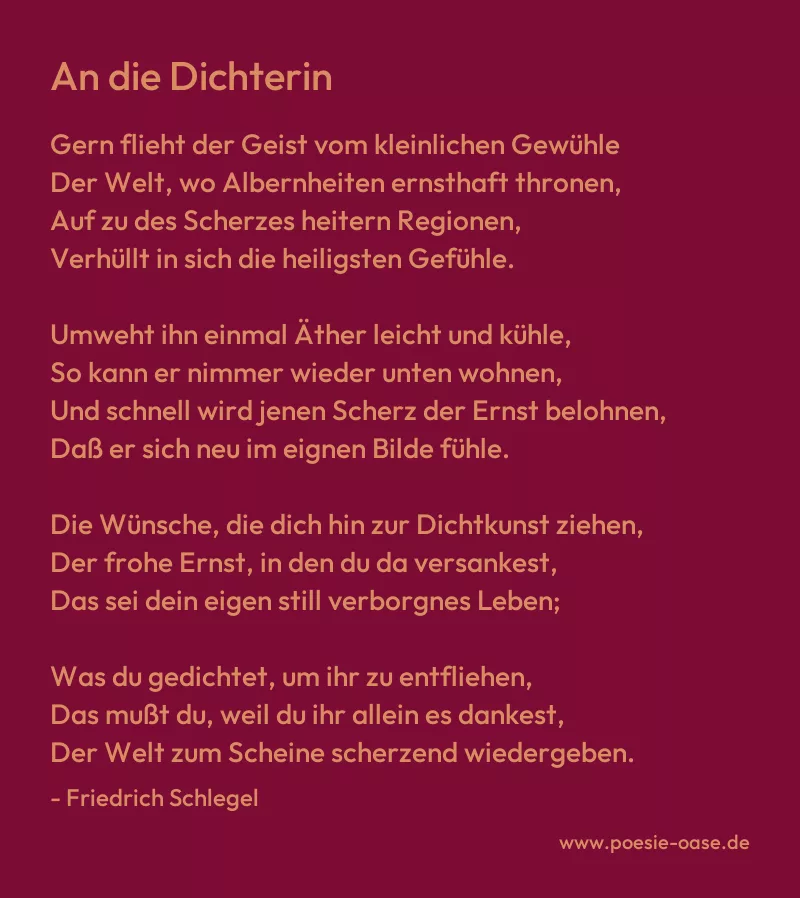An die Dichterin
Gern flieht der Geist vom kleinlichen Gewühle
Der Welt, wo Albernheiten ernsthaft thronen,
Auf zu des Scherzes heitern Regionen,
Verhüllt in sich die heiligsten Gefühle.
Umweht ihn einmal Äther leicht und kühle,
So kann er nimmer wieder unten wohnen,
Und schnell wird jenen Scherz der Ernst belohnen,
Daß er sich neu im eignen Bilde fühle.
Die Wünsche, die dich hin zur Dichtkunst ziehen,
Der frohe Ernst, in den du da versankest,
Das sei dein eigen still verborgnes Leben;
Was du gedichtet, um ihr zu entfliehen,
Das mußt du, weil du ihr allein es dankest,
Der Welt zum Scheine scherzend wiedergeben.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
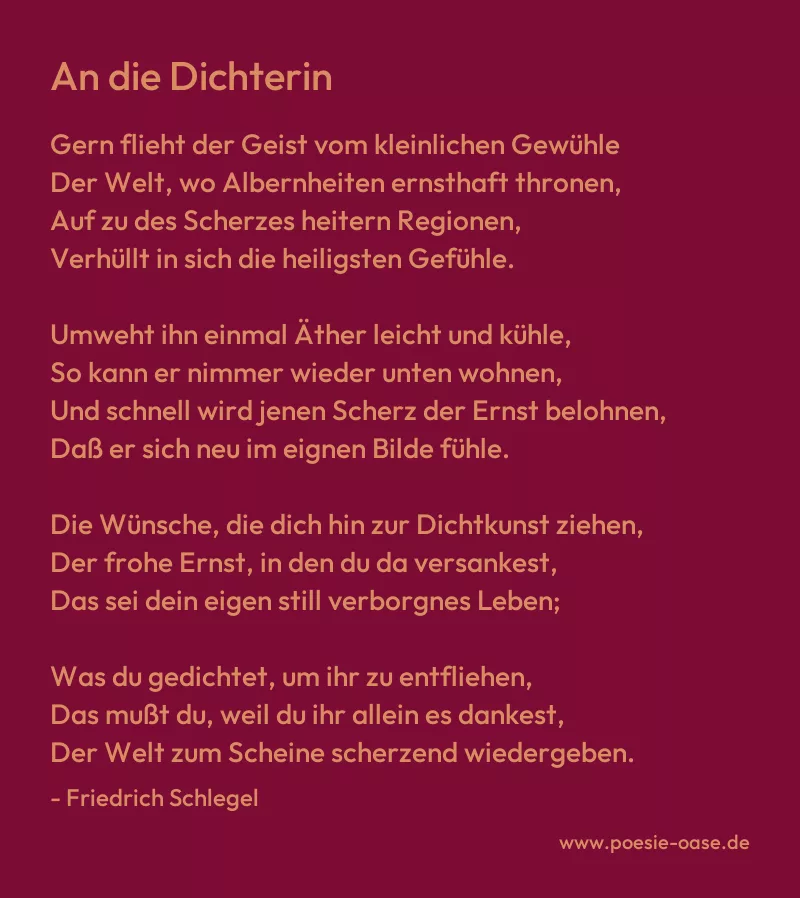
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An die Dichterin“ von Friedrich Schlegel feiert die schöpferische Kraft und die innere Welt der Dichterin, während es gleichzeitig die Notwendigkeit betont, diese Welt nach außen zu tragen und mit der Welt zu teilen. Die ersten beiden Strophen beschreiben den Dualismus des Geistes, der einerseits der banalen Welt entfliehen möchte, in der Albernheiten herrschen, und sich andererseits in den heiteren Regionen des Scherzes und der inneren Gefühle verbergen kann.
Der Dichter wird von der ätherischen Schönheit und den „heiligsten Gefühlen“ angezogen und kann danach nicht mehr in die niederere Welt zurückkehren. Die Zeilen spielen auf eine Transformation an, in der der Scherz, der als Fluchtmittel diente, mit Ernst belohnt wird. Das bedeutet, dass die Freude an der Kunst, die anfänglich als Flucht vor der Welt diente, schließlich in einer tieferen Erkenntnis des Selbst und der Welt mündet. Der Dichter findet sich „neu im eignen Bilde“ wieder, was auf eine Selbstfindung durch das Schreiben hinweist.
Die dritte Strophe lenkt den Fokus auf die Dichterin und ihre innere Welt. Die Wünsche, die sie zur Dichtkunst treiben, und der „frohe Ernst“, der ihr in der Kunst widerfährt, sollen ihr „eigenes still verborgnes Leben“ sein. Dies deutet auf die Intimität und den persönlichen Charakter der Kunst hin, die aus inneren Empfindungen und Erlebnissen entspringt.
Die letzten beiden Verse vollziehen eine entscheidende Wendung. Das, was die Dichterin erschaffen hat, um der Welt zu entfliehen, muss sie ironischerweise der Welt zurückgeben. Dies ist ein Aufruf zur Veröffentlichung und zum Teilen des geschaffenen Werkes, um der Welt Freude und Erkenntnis zu schenken. Das „scherzend wiedergeben“ suggeriert dabei, dass die Kunst in der Welt anders wahrgenommen wird, als in ihrem Entstehungsort.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.