Michel Angelo hieß als Wunder der Kunst dich willkommen,
Weil du als Gegengewicht gegen den schönen Apoll,
Der den Raphael trug und ihn verneinte, ihm dientest;
Mancher sprach es ihm nach, aber er sagte zu viel.
Was die Wahrheit vermag, das zeigst du deutlich, o Gruppe,
Deutlicher zeigst du jedoch, daß sie nicht alles vermag!
Vor dem Laokoon
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
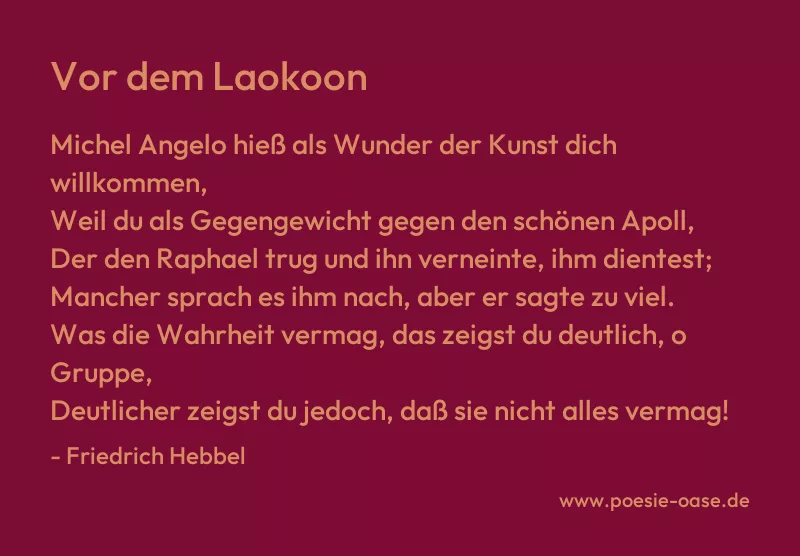
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Vor dem Laokoon“ von Friedrich Hebbel ist eine knappe, aber tiefgründige Auseinandersetzung mit der Kunst, insbesondere mit der Frage nach der Bedeutung und den Grenzen der Darstellung von Wahrheit und Schönheit. Es nimmt Bezug auf die berühmte antike Skulptur des Laokoon, die in der Renaissance und darüber hinaus eine zentrale Rolle in der Kunsttheorie spielte.
Hebbel beginnt mit einem Verweis auf Michelangelo, der den Laokoon als ein „Wunder der Kunst“ begrüßte und ihn als Gegenpol zum Schönheitsideal des Apoll sah, welches von Raphael verkörpert wurde. Dieser einleitende Vers etabliert den Kontext und deutet auf eine Auseinandersetzung mit den vorherrschenden ästhetischen Auffassungen hin. Die Erwähnung Michelangelos, der den Laokoon hochschätzte, deutet auf die Betonung des Ausdrucks von Leid und Schmerz hin, was im Gegensatz zur Harmonie und dem Gleichgewicht des Apoll steht. Hebbel kritisiert die übermäßige Verehrung des Laokoon, indem er sagt, dass Michelangelo „zu viel“ sagte.
Der Kern des Gedichts liegt in der Erkenntnis, dass der Laokoon zwar die Wahrheit darstellen kann – im Sinne von Schmerz, Leid und Kampf –, dass diese Wahrheit aber nicht alles vermag. Die Skulptur zeigt die menschliche Qual in all ihrer Intensität, doch Hebbel deutet an, dass dies nicht das gesamte Spektrum menschlicher Erfahrung und künstlerischer Möglichkeiten abdeckt. Es legt den Schluss nahe, dass Kunst mehr als nur die bloße Darstellung der Wahrheit sein kann oder sein muss; sie hat auch die Aufgabe, Schönheit, Harmonie und andere Werte widerzuspiegeln, die im Laokoon selbst fehlen.
Das Gedicht ist in seiner Kürze prägnant und verdichtet. Hebbel benutzt klare Sprache und eine strukturierte Form, um seine Botschaft zu vermitteln. Die antithetische Struktur, die durch das Gegenüberstellen von „Wahrheit“ und „alles“ erzeugt wird, unterstreicht die zentrale These des Gedichts: dass die Kunst zwar die Wahrheit zeigen kann, aber nicht auf diese beschränkt sein darf. Die letzten beiden Zeilen bilden den Höhepunkt und die Quintessenz der Aussage, indem sie die Grenzen der reinen Wahrheit in der Kunst aufzeigen. Hebbel stellt hier die Frage nach dem Wesen und der Vielschichtigkeit der Kunst selbst.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
