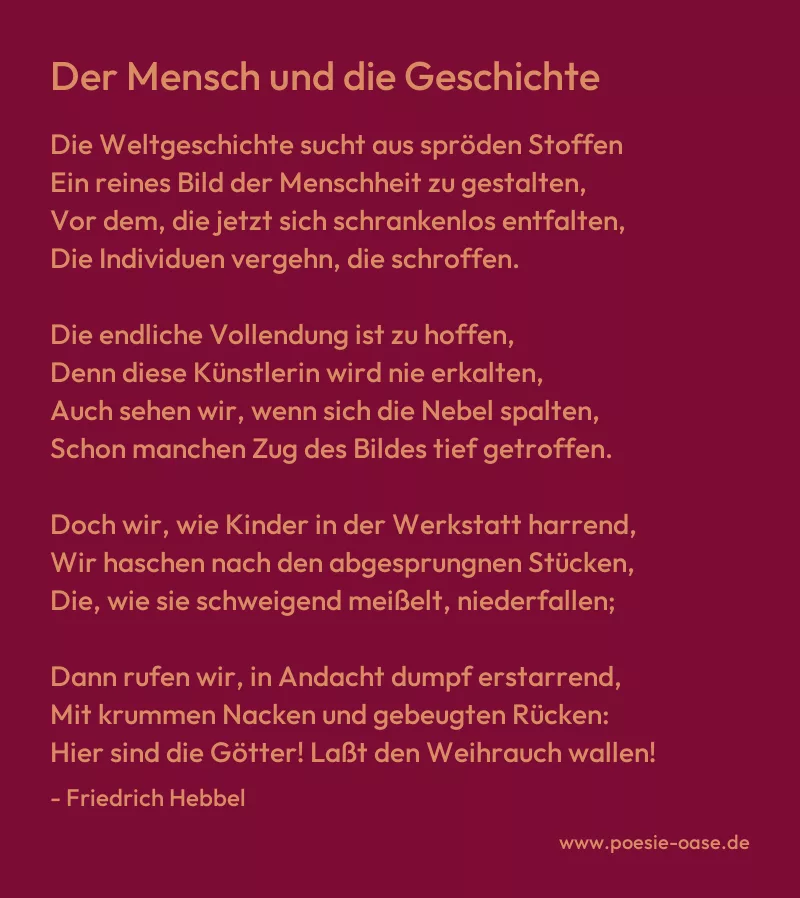Der Mensch und die Geschichte
Die Weltgeschichte sucht aus spröden Stoffen
Ein reines Bild der Menschheit zu gestalten,
Vor dem, die jetzt sich schrankenlos entfalten,
Die Individuen vergehn, die schroffen.
Die endliche Vollendung ist zu hoffen,
Denn diese Künstlerin wird nie erkalten,
Auch sehen wir, wenn sich die Nebel spalten,
Schon manchen Zug des Bildes tief getroffen.
Doch wir, wie Kinder in der Werkstatt harrend,
Wir haschen nach den abgesprungnen Stücken,
Die, wie sie schweigend meißelt, niederfallen;
Dann rufen wir, in Andacht dumpf erstarrend,
Mit krummen Nacken und gebeugten Rücken:
Hier sind die Götter! Laßt den Weihrauch wallen!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
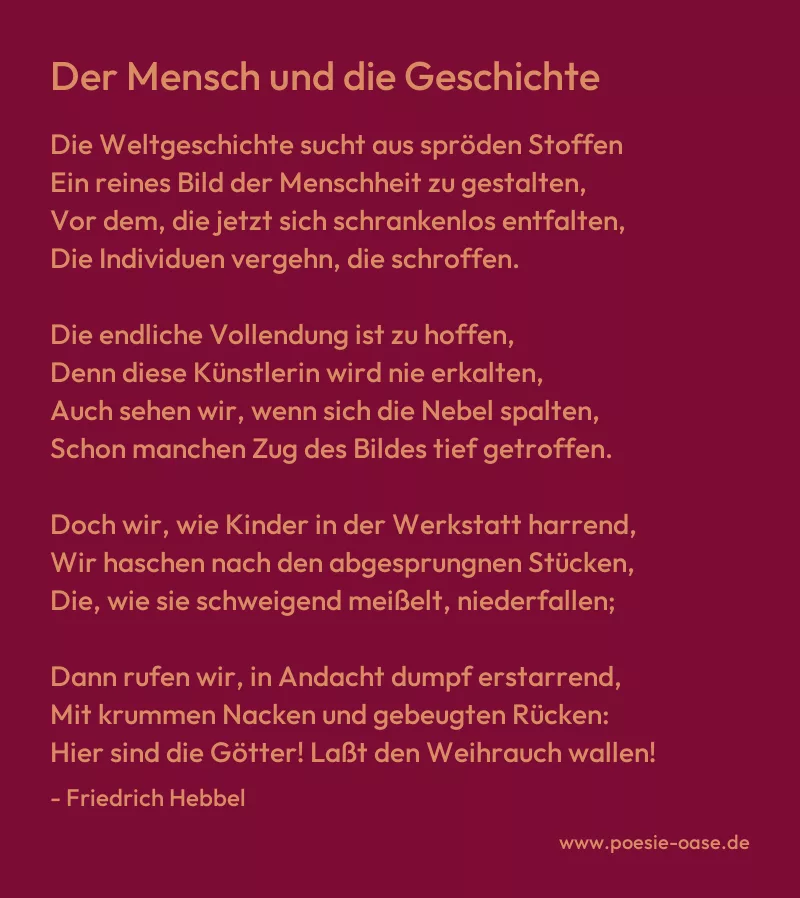
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Mensch und die Geschichte“ von Friedrich Hebbel thematisiert die Beziehung zwischen dem Individuum und dem großen Ganzen der Geschichte. Es zeichnet ein Bild von der Geschichte als einer schaffenden Künstlerin, die aus dem „spröden Stoff“ der menschlichen Existenz ein „reines Bild der Menschheit“ formt. Der Fokus liegt auf der Unpersönlichkeit dieses Prozesses, in dem die „Individuen“ – die Menschen – „vergehn“ und lediglich als Rohmaterial für das größere Kunstwerk dienen.
Die ersten beiden Strophen etablieren die zentrale Metapher: Die Geschichte ist die Künstlerin, und das menschliche Leben ist das Material. Die „endliche Vollendung“ des Kunstwerks wird als Hoffnung ausgedrückt, obwohl der Weg dorthin durch das Vergessen der Einzelnen gepflastert ist. Die „Nebel“ des Vergessens spalten sich gelegentlich, wodurch einige „Züge des Bildes“ sichtbar werden, was andeutet, dass die Geschichte in ihren Fortschrittsschritten zumindest partiell verstanden werden kann. Das Gedicht betont dabei die Distanz des historischen Prozesses zu den Beteiligten.
Die dritte Strophe ändert die Perspektive und zeigt die Reaktion der Menschen auf diesen Prozess. Sie werden mit „Kindern in der Werkstatt“ verglichen, die von den „abgesprungenen Stücken“ der Geschichte fasziniert sind. Diese „Stücke“ sind womöglich Überreste oder Fragmente vergangener Ereignisse oder einzelner Menschen. Das Bild der Kinder, die diese Fragmente sammeln, deutet auf eine kindliche, unreflektierte Verehrung hin. Sie erstarren in „Andacht“ und verehren die Fragmente als „Götter“, was eine gewisse Blindheit gegenüber dem Gesamtbild und der zugrundeliegenden Dynamik der Geschichte impliziert.
Das Gedicht offenbart eine doppelte Ironie. Einerseits die Ironie des individuellen Schicksals, das im großen historischen Kontext an Bedeutung verliert. Andererseits die Ironie der menschlichen Reaktion, die oft in der Verehrung von Fragmenten oder ephemeren Aspekten der Geschichte besteht, während das umfassendere Kunstwerk, das sich aus ihnen zusammensetzt, kaum wahrgenommen oder verstanden wird. Die „krummen Nacken“ und „beugten Rücken“ am Ende des Gedichts unterstreichen die Unterwürfigkeit und den begrenzten Horizont derer, die sich in der Geschichte bewegen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.