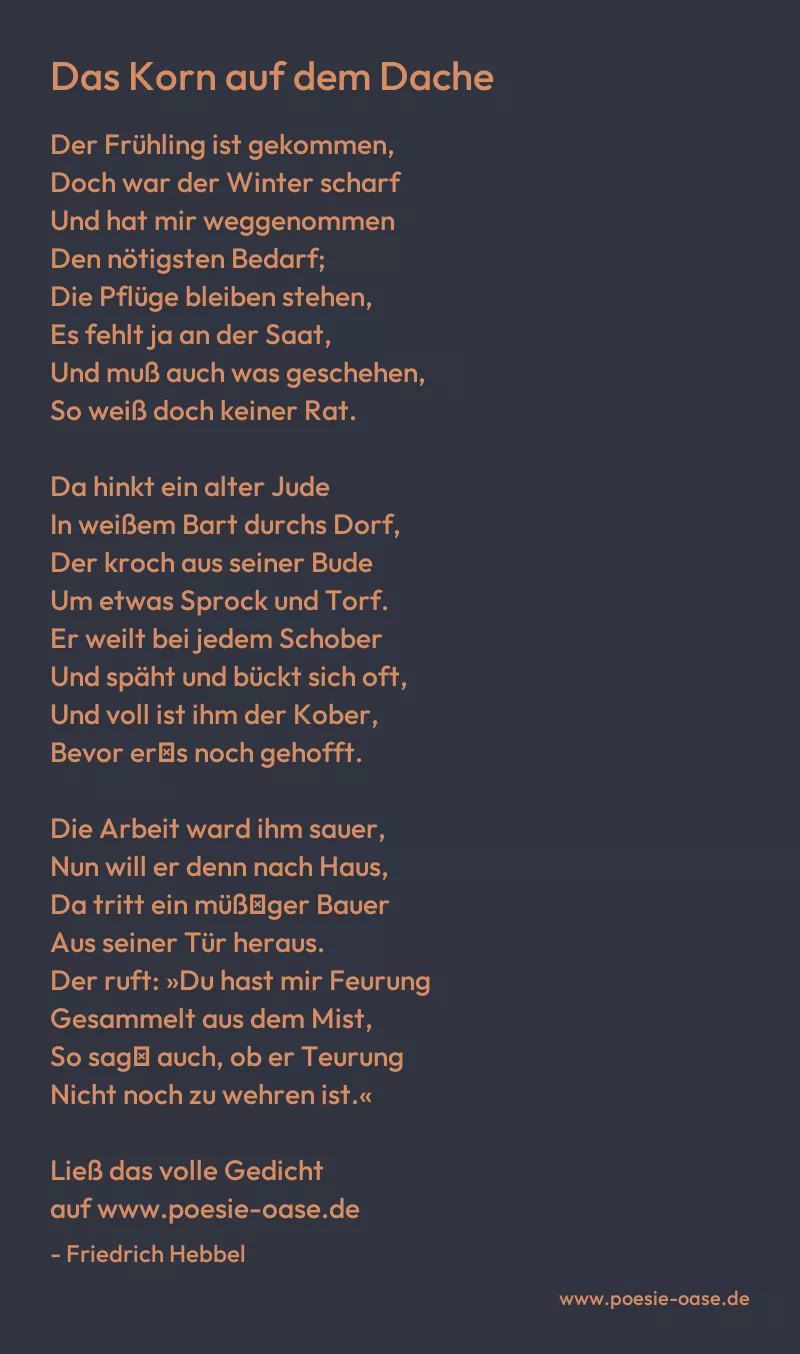Das Korn auf dem Dache
Der Frühling ist gekommen,
Doch war der Winter scharf
Und hat mir weggenommen
Den nötigsten Bedarf;
Die Pflüge bleiben stehen,
Es fehlt ja an der Saat,
Und muß auch was geschehen,
So weiß doch keiner Rat.
Da hinkt ein alter Jude
In weißem Bart durchs Dorf,
Der kroch aus seiner Bude
Um etwas Sprock und Torf.
Er weilt bei jedem Schober
Und späht und bückt sich oft,
Und voll ist ihm der Kober,
Bevor er′s noch gehofft.
Die Arbeit ward ihm sauer,
Nun will er denn nach Haus,
Da tritt ein müß′ger Bauer
Aus seiner Tür heraus.
Der ruft: »Du hast mir Feurung
Gesammelt aus dem Mist,
So sag′ auch, ob er Teurung
Nicht noch zu wehren ist.«
Der Alte hebt die Blicke,
Doch bis zum Himmel nicht,
Dann tickt er mit der Krücke
Aufs Hüttendach, und spricht:
»War das nicht eine Ähre,
Was ich im Stroh dort sah?
Wenn′s nicht die einz′ge wäre,
So ist die Hilfe nah!«
Der Bauer geht zur Leiter
Und deckt die Hütte ab,
Er drischt sein Stroh noch weiter,
Im lust′gen Klipp und Klapp,
Und als die Körner springen,
Da folgt ihm Mann für Mann,
Und das wird so viel bringen,
Daß jeder säen kann.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
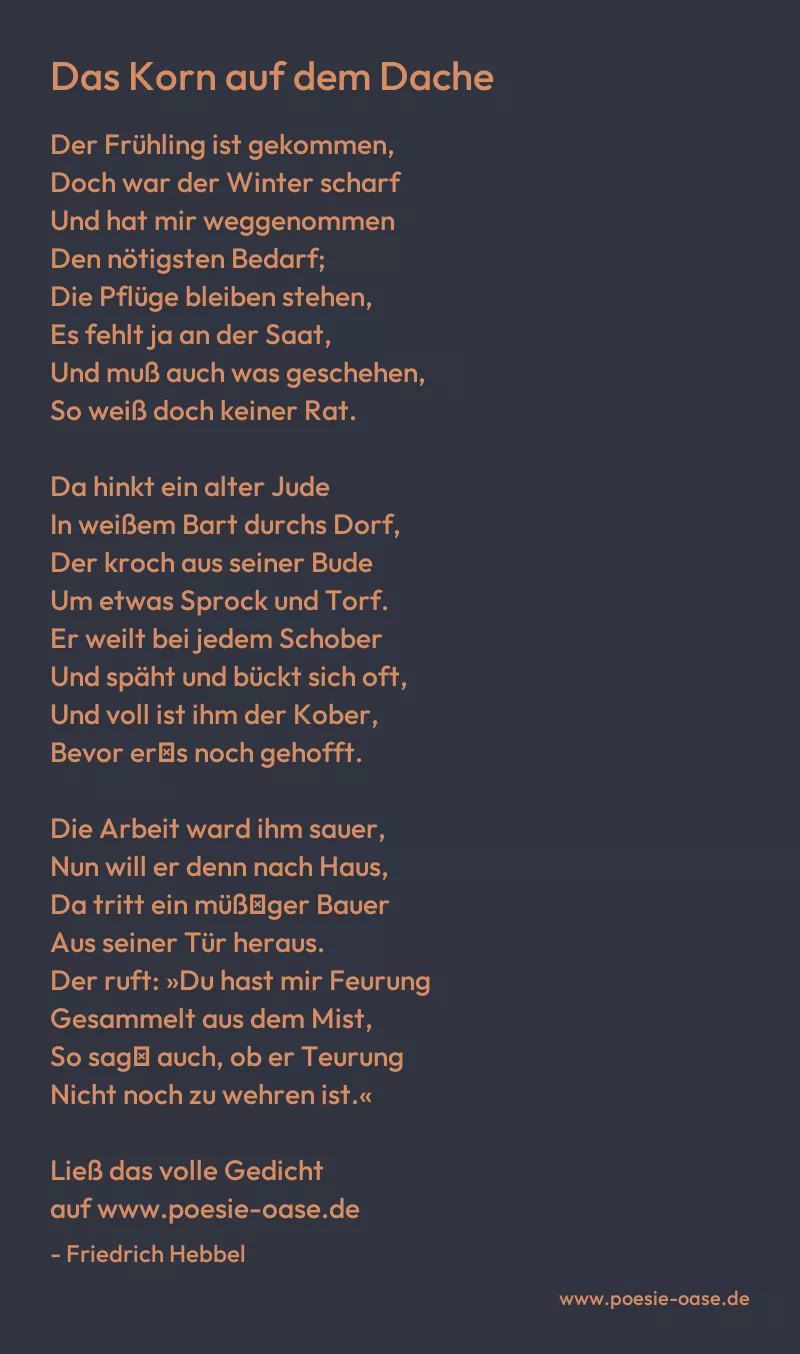
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Das Korn auf dem Dache“ von Friedrich Hebbel erzählt eine Geschichte von Hoffnung, Entdeckung und gemeinschaftlichem Handeln in einer Zeit der Not. Der Frühling ist gekommen, doch die vorhergegangene strenge Winterzeit hat die Vorräte der Dorfbewohner dezimiert, sodass die Aussaat gefährdet ist. Die zentrale Metapher des Gedichts wird in den ersten Strophen etabliert: Die Bauern sind ohne Saatgut, ihre Existenz ist bedroht.
Ein alter Jude, der als Außenseiter der Dorfgemeinschaft dargestellt wird, wird zur Quelle der Rettung. Er sucht nach Brennmaterial, findet aber auf dem Dach eines Hauses unerwartet einen Strohhalm mit Kornähren. Diese Entdeckung ist der Wendepunkt der Geschichte. Der Jude, als Symbol für das scheinbar Unbeachtete und Marginalisierte, entdeckt die Lösung des Problems. Seine scheinbar zufällige Entdeckung hat einen entscheidenden Einfluss auf die Gemeinschaft, da sie das fehlende Saatgut liefert.
Der Bauer, der zunächst nach der Hilfe für seine Not fragt, ist der Katalysator für die Umsetzung der entdeckten Lösung. Er, sowie die anderen Dorfbewohner, folgen der Spur der Erkenntnis, die der Jude gelegt hat. Die im Stroh versteckten Körner werden freigelegt, und die Gemeinschaft findet eine Lösung, die ihre Existenz sichert. Die letzte Strophe beschreibt die Freude über die Entdeckung und die Aussicht auf eine reiche Ernte.
Hebbel nutzt in diesem Gedicht eine einfache, fast volksliedhafte Sprache, um eine universelle Botschaft zu vermitteln: Hoffnung und Rettung können oft in unerwarteten Orten und durch ungewöhnliche Quellen gefunden werden. Das Gedicht ist ein Plädoyer für die Kraft der Solidarität und das Vertrauen in die Möglichkeit, aus scheinbar aussichtslosen Situationen einen Ausweg zu finden. Es zeigt, dass selbst in Zeiten der Not, wenn die Gemeinschaft zusammenarbeitet und unkonventionelle Lösungen in Betracht zieht, Hoffnung und Heilung möglich sind.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.