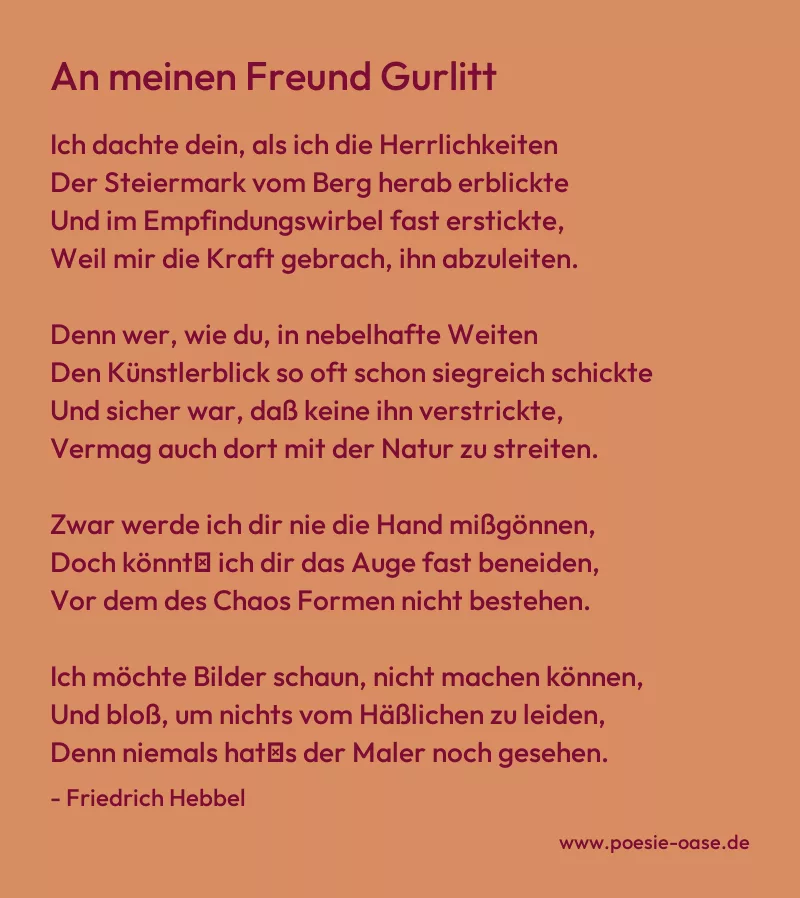An meinen Freund Gurlitt
Ich dachte dein, als ich die Herrlichkeiten
Der Steiermark vom Berg herab erblickte
Und im Empfindungswirbel fast erstickte,
Weil mir die Kraft gebrach, ihn abzuleiten.
Denn wer, wie du, in nebelhafte Weiten
Den Künstlerblick so oft schon siegreich schickte
Und sicher war, daß keine ihn verstrickte,
Vermag auch dort mit der Natur zu streiten.
Zwar werde ich dir nie die Hand mißgönnen,
Doch könnt′ ich dir das Auge fast beneiden,
Vor dem des Chaos Formen nicht bestehen.
Ich möchte Bilder schaun, nicht machen können,
Und bloß, um nichts vom Häßlichen zu leiden,
Denn niemals hat′s der Maler noch gesehen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
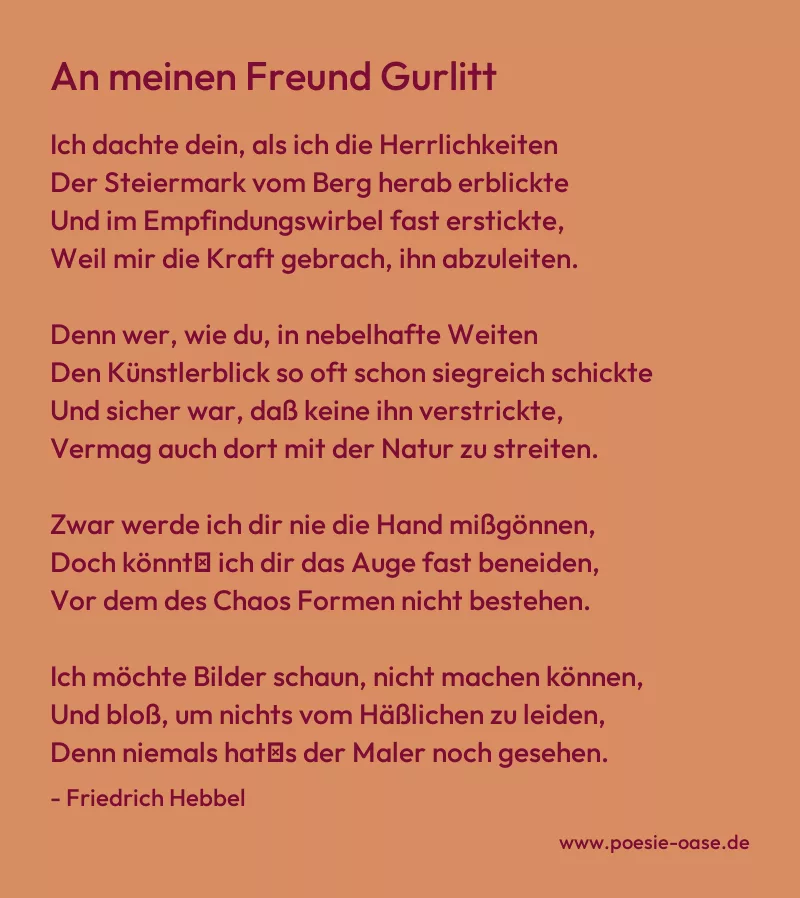
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An meinen Freund Gurlitt“ von Friedrich Hebbel ist eine Reflexion über die Kluft zwischen Erleben und künstlerischer Gestaltung, sowie über die Natur des Künstlertums. Es beginnt mit der Beschreibung eines überwältigenden Naturerlebnisses, dem Betrachter die „Herrlichkeiten / Der Steiermark vom Berg herab erblickte“. Der Dichter, geplagt von der Intensität des Erlebens, verweist auf die Unfähigkeit, diese Eindrücke adäquat in Kunst umzusetzen. Der „Empfindungswirbel“ droht ihn zu „erdrücken“, da ihm die Kraft fehlt, ihn zu kanalisieren und in etwas Geschaffenes zu überführen. Das Gedicht zeugt von einem Zwiespalt: dem Bedürfnis nach Schönheit und der gleichzeitigen Unfähigkeit, sie zu manifestieren.
Im zweiten Teil des Gedichts wird Gurlitt, ein Freund des Dichters, zum Gegenstand des Vergleichs. Hebbel attestiert ihm die Fähigkeit, die „nebelhaften Weiten“ der Natur mit dem „Künstlerblick“ zu durchdringen und zu beherrschen. Durch die Anspielung auf Gurlitts „sichere“ Meisterschaft im Umgang mit der Natur, drückt sich die Bewunderung des Dichters aus, vermischt mit einer subtilen Form des Neides. Die Zeilen betonen, wie Gurlitt im Gegensatz zum Dichter die Macht besitzt, sich in der Natur zu behaupten und sie künstlerisch zu meistern. Dies wird durch die Zeile verdeutlicht: „Vermag auch dort mit der Natur zu streiten“.
Die dritte Strophe offenbart Hebbels tiefe Sehnsucht nach dem passiven Genuss von Kunst gegenüber der aktiven Schöpfertätigkeit. Er beneidet Gurlitt um dessen Fähigkeit, das Schöne in der Welt zu erkennen und festzuhalten. Die Zeilen „Ich möchte Bilder schaun, nicht machen können“ drücken diese passive Haltung aus. Der Dichter sehnt sich nach einem ungestörten Betrachten der Schönheit, ohne sich der Anstrengung und dem möglichen Scheitern der künstlerischen Produktion aussetzen zu müssen. Die Sehnsucht nach dem Schutz vor dem „Häßlichen“ verstärkt diesen Wunsch nach ungetrübtem Genuss.
Die letzten Zeilen des Gedichts „Denn niemals hat’s der Maler noch gesehen“ sind mehrdeutig. Sie können sowohl als Bestätigung der Einzigartigkeit des Künstlers gedeutet werden, der in der Lage ist, das Wahre und Schöne zu erkennen, als auch als Ausdruck der Selbstzweifel. Es könnte bedeuten, dass die „Häßlichkeit“ so umfassend ist, dass kein Künstler sie jemals vollumfänglich gesehen hat. Das Gedicht endet damit, dass es die Beziehung zwischen dem Erleben der Schönheit, dem Streben nach künstlerischer Vollendung und der Sehnsucht nach passiver Kontemplation ergründet. Es ist ein komplexes Selbstporträt, das die inneren Kämpfe eines Künstlers mit seinen eigenen Fähigkeiten und der Welt um ihn herum reflektiert.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.