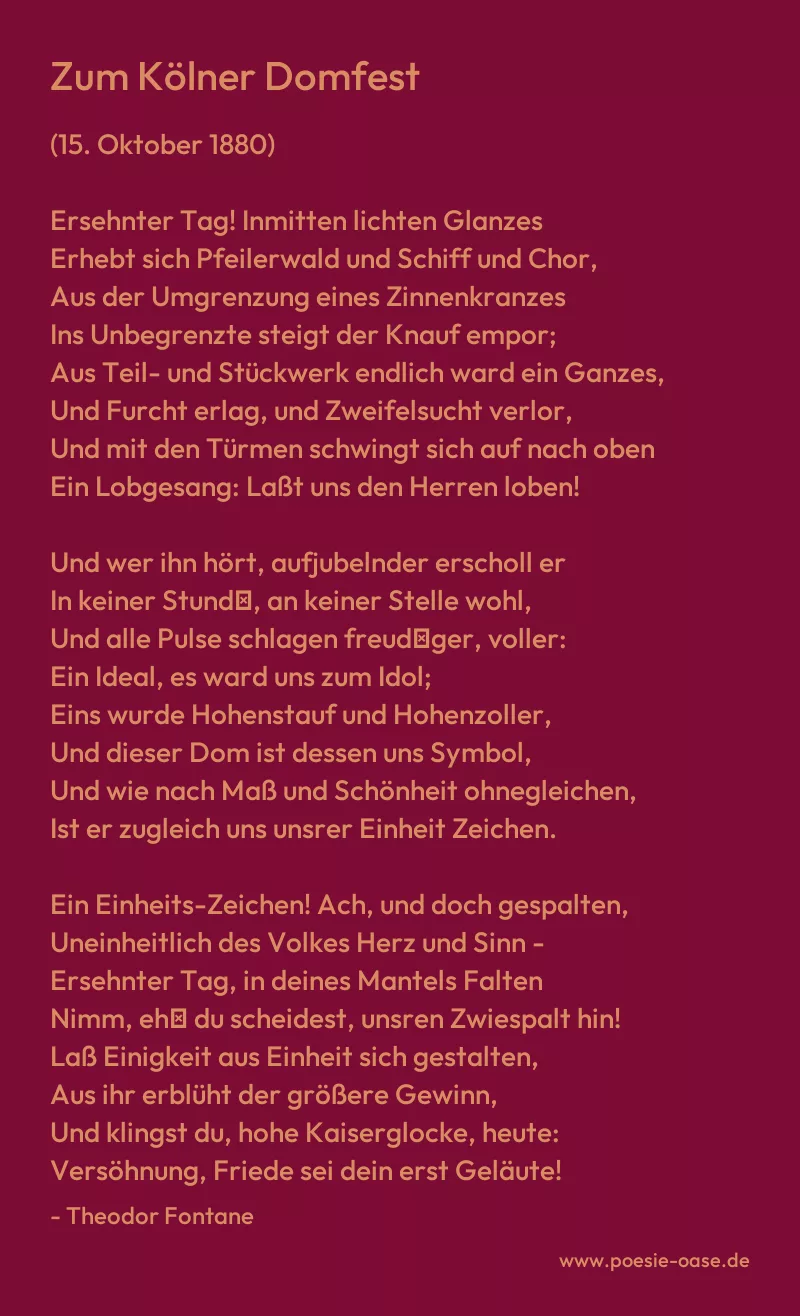Zum Kölner Domfest
(15. Oktober 1880)
Ersehnter Tag! Inmitten lichten Glanzes
Erhebt sich Pfeilerwald und Schiff und Chor,
Aus der Umgrenzung eines Zinnenkranzes
Ins Unbegrenzte steigt der Knauf empor;
Aus Teil- und Stückwerk endlich ward ein Ganzes,
Und Furcht erlag, und Zweifelsucht verlor,
Und mit den Türmen schwingt sich auf nach oben
Ein Lobgesang: Laßt uns den Herren loben!
Und wer ihn hört, aufjubelnder erscholl er
In keiner Stund′, an keiner Stelle wohl,
Und alle Pulse schlagen freud′ger, voller:
Ein Ideal, es ward uns zum Idol;
Eins wurde Hohenstauf und Hohenzoller,
Und dieser Dom ist dessen uns Symbol,
Und wie nach Maß und Schönheit ohnegleichen,
Ist er zugleich uns unsrer Einheit Zeichen.
Ein Einheits-Zeichen! Ach, und doch gespalten,
Uneinheitlich des Volkes Herz und Sinn –
Ersehnter Tag, in deines Mantels Falten
Nimm, eh′ du scheidest, unsren Zwiespalt hin!
Laß Einigkeit aus Einheit sich gestalten,
Aus ihr erblüht der größere Gewinn,
Und klingst du, hohe Kaiserglocke, heute:
Versöhnung, Friede sei dein erst Geläute!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
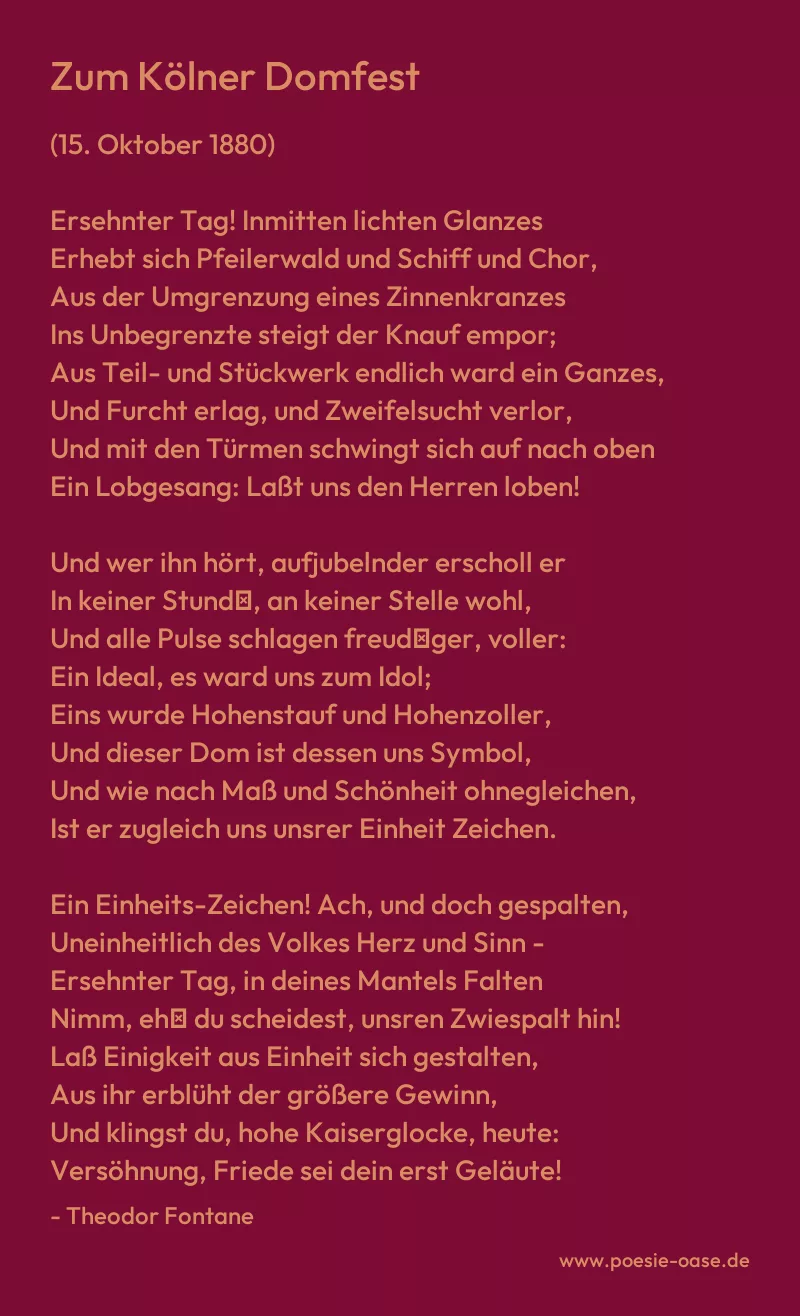
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Zum Kölner Domfest“ von Theodor Fontane ist eine Reflexion über die Vollendung des Kölner Doms und die damit verbundene Hoffnung auf Einigkeit in einem politisch und gesellschaftlich zerrissenen Deutschland. Es wurde am 15. Oktober 1880 verfasst, dem Tag der Fertigstellung des Doms, und feiert dessen architektonische Pracht sowie die damit verbundenen Ideale. Fontane nutzt die beeindruckende Erscheinung des Doms als Metapher für die Sehnsucht nach einem geeinten und friedlichen Deutschland. Der Dom, der aus vielen Einzelteilen zu einem „Ganzen“ vollendet wurde, symbolisiert die Überwindung von „Furcht“ und „Zweifelsucht“, die die deutsche Gesellschaft zu dieser Zeit spalteten.
Die ersten beiden Strophen beschreiben die Erhabenheit des Doms und die Begeisterung, die sein Anblick auslöst. Fontane betont die Einheit, die durch die Vollendung des Bauwerks erreicht wurde. Der Dom wird zum „Idol“, einem Ideal der Einheit, das sowohl die preußischen Hohenzollern als auch die Tradition der Staufer vereint. Die Freude und der Jubel, die im Gedicht zum Ausdruck kommen, spiegeln die Hoffnung wider, dass die Einheit des Doms auch im Herzen des Volkes spürbar werden möge.
In der dritten Strophe erfolgt jedoch ein Bruch. Fontane erkennt, dass die Realität hinter der Fassade der Einheit zurückbleibt. „Ein Einheits-Zeichen! Ach, und doch gespalten,“ lautet die bittere Feststellung. Die gesellschaftlichen und politischen Spannungen, die Uneinigkeit des Volkes, werden deutlich benannt. Der Dichter appelliert an den Dom, an den „ersehnten Tag“, die „Zwiespalt“ des Volkes in seinen „Mantel“ aufzunehmen.
Der Schluss des Gedichts ist ein eindringlicher Appell an die Versöhnung und den Frieden. Fontane wünscht sich, dass die Einheit, die im Bauwerk des Doms manifestiert ist, auch im gesellschaftlichen Leben umgesetzt wird. Die „Kaiserglocke“ soll zum Zeichen der Versöhnung und des Friedens läuten. Das Gedicht ist somit mehr als nur eine Huldigung an ein architektonisches Meisterwerk; es ist ein politisches Statement, das die Sehnsucht nach einem geeinten, friedlichen und gerechten Deutschland zum Ausdruck bringt. Fontanes Werk zeigt die Ambivalenz der damaligen Zeit, die von großer Hoffnung und tiefer Sorge zugleich geprägt war.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.