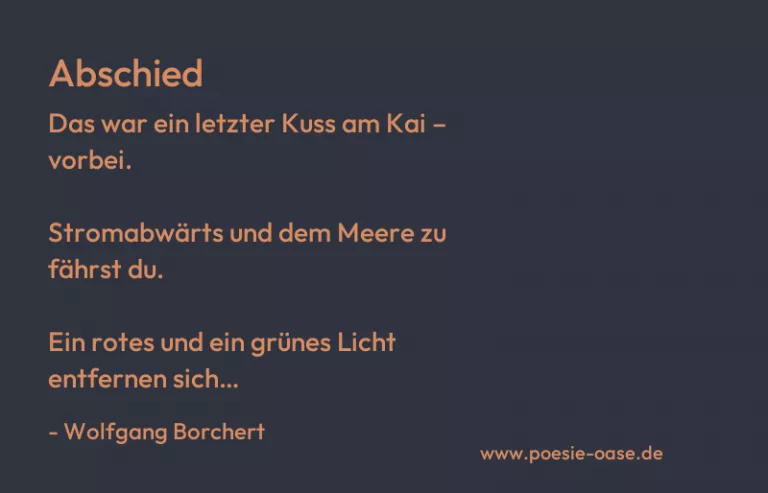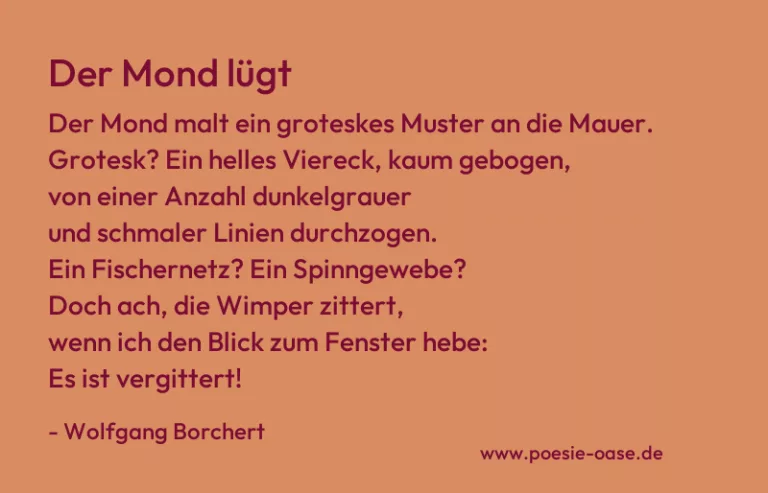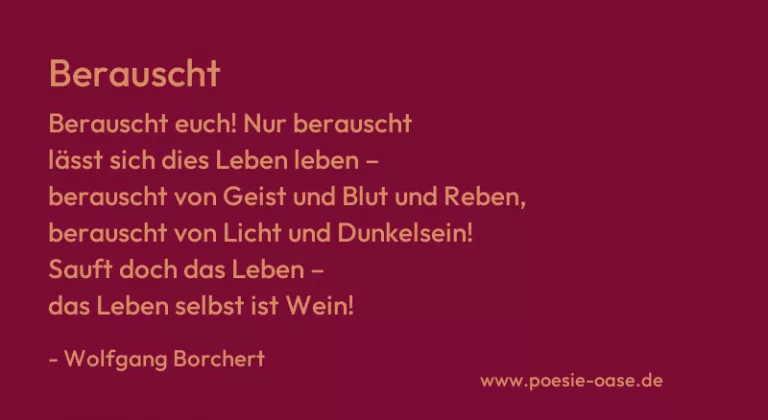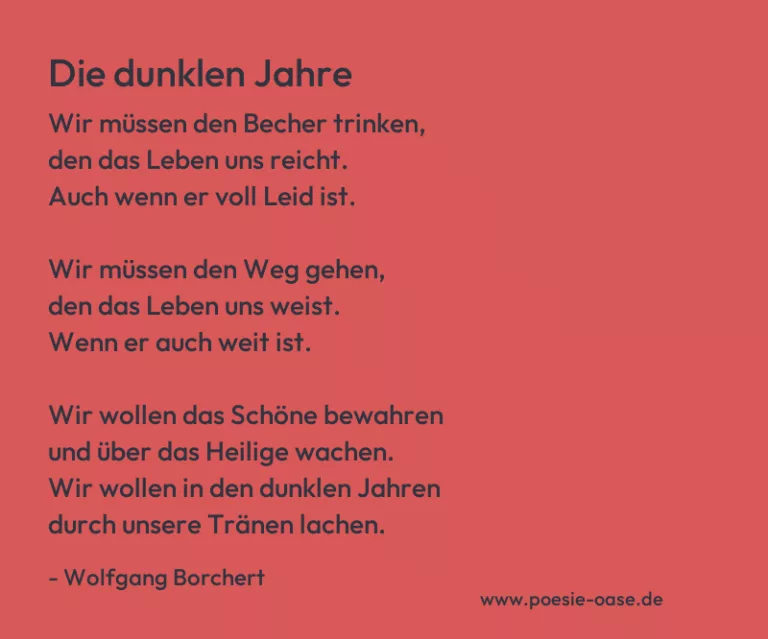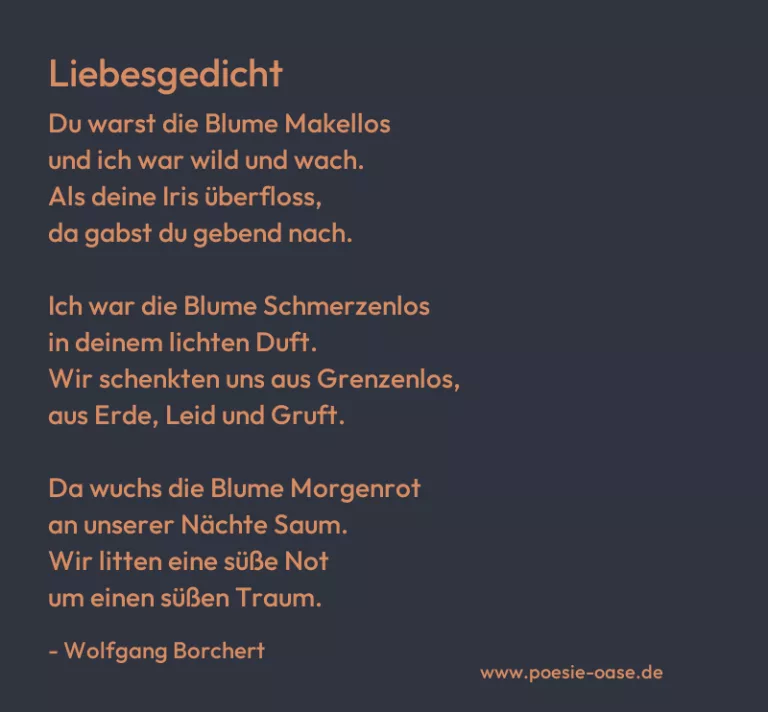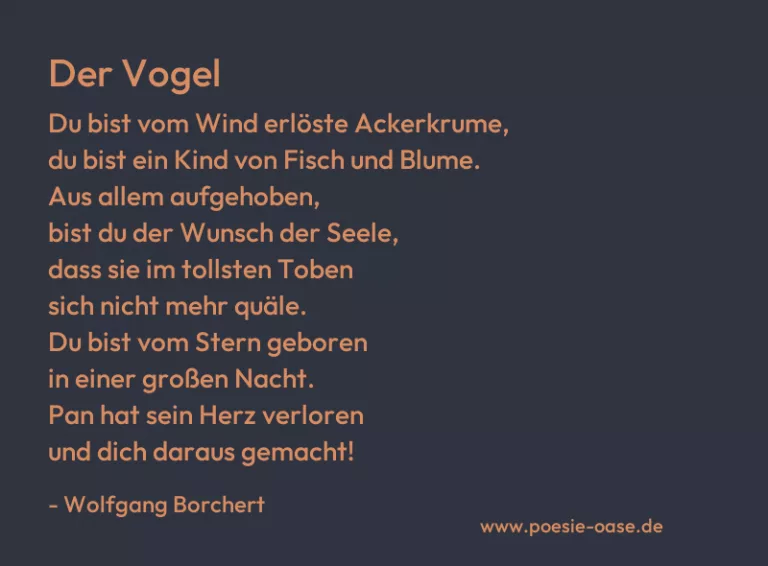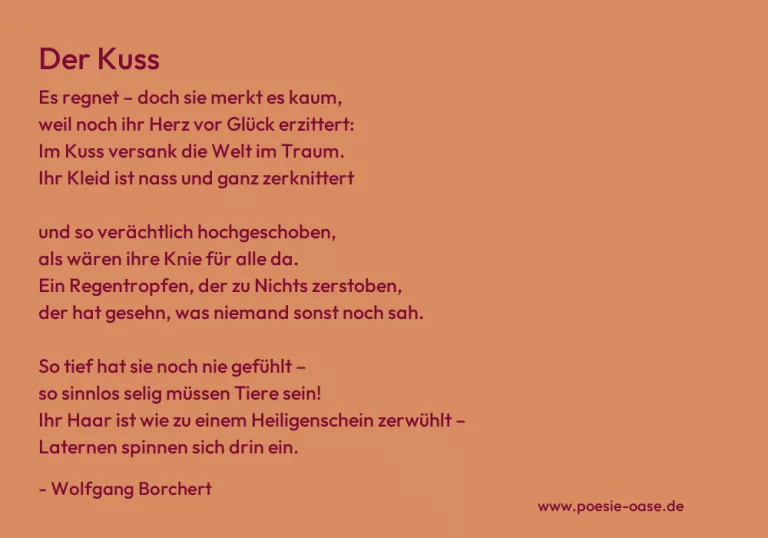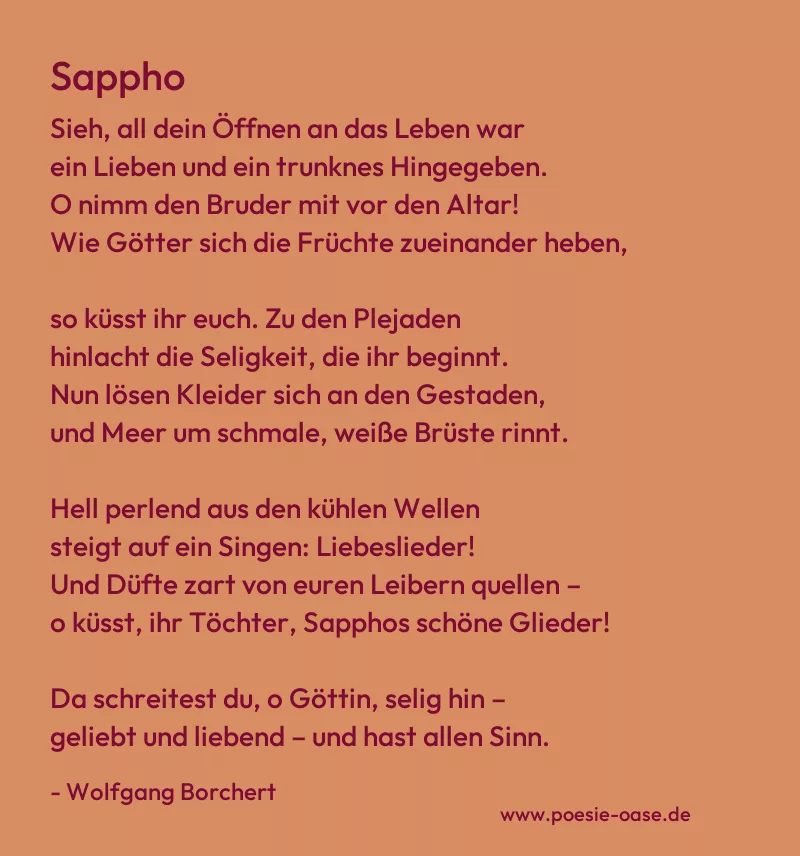Sappho
Sieh, all dein Öffnen an das Leben war
ein Lieben und ein trunknes Hingegeben.
O nimm den Bruder mit vor den Altar!
Wie Götter sich die Früchte zueinander heben,
so küsst ihr euch. Zu den Plejaden
hinlacht die Seligkeit, die ihr beginnt.
Nun lösen Kleider sich an den Gestaden,
und Meer um schmale, weiße Brüste rinnt.
Hell perlend aus den kühlen Wellen
steigt auf ein Singen: Liebeslieder!
Und Düfte zart von euren Leibern quellen –
o küsst, ihr Töchter, Sapphos schöne Glieder!
Da schreitest du, o Göttin, selig hin –
geliebt und liebend – und hast allen Sinn.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
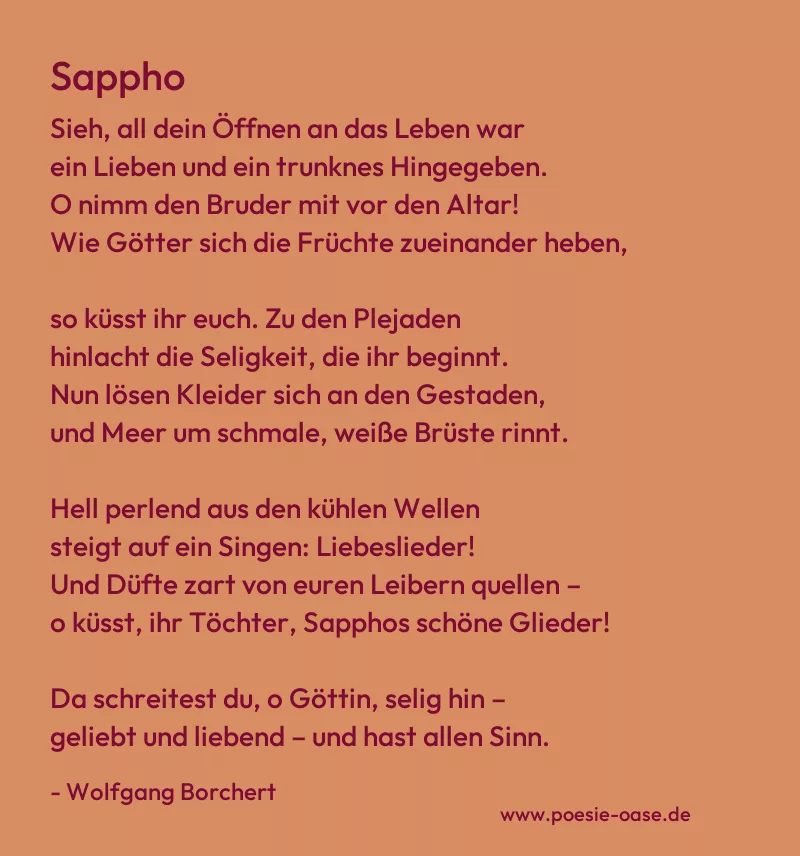
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sappho“ von Wolfgang Borchert ist eine hymnische, sinnlich aufgeladene Huldigung an die gleichgeschlechtliche Liebe und die mythische Figur der Sappho, die als Symbol weiblicher Leidenschaft, Schönheit und dichterischer Kraft inszeniert wird. In der lyrischen Sprache Borcherts wird Sappho zu einer fast göttlichen Figur, deren Lieben ein Akt des Rausches, der Hingabe und der Vollkommenheit ist.
Die erste Strophe beschreibt die Liebe als ekstatische Öffnung zum Leben – ein „trunknes Hingegeben“, das keine Zurückhaltung kennt. Der Altar wird hier nicht nur als religiöses, sondern auch als erotisches Symbol gedeutet: Der Kuss wird zu einem göttlichen Akt, der mit mythischer Fruchtbarkeit und Schönheit aufgeladen ist. Der Vergleich mit den Göttern hebt die Liebenden in eine höhere, übermenschliche Sphäre.
In den folgenden Strophen weitet sich das Bild in eine fast traumhafte Szene: Kleider lösen sich, das Meer umspielt die Körper, und das Singen aus den Wellen steigert die Szenerie ins Übernatürliche. Das Liebesmotiv wird mit Naturkräften verknüpft – das Wasser, die Düfte, die Gestirne (Plejaden) – und so in eine archaische, universelle Dimension überführt. Dabei wird die weibliche Schönheit in einer Weise gefeiert, die sinnlich und verehrend zugleich ist.
Im Schlussvers tritt Sappho selbst als „Göttin“ auf: geliebt und liebend, ganz im Einklang mit sich selbst und ihrer Natur. Borchert entwirft hier ein Idealbild von Liebe als Ganzheit – körperlich, seelisch und spirituell. Angesichts seines übrigen, oft von Tod und Leid geprägten Werks ist dieses Gedicht eine seltene, lichte Ausnahme: ein poetischer Raum, in dem Schönheit, Sinnlichkeit und Liebe ungestört möglich sind.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.