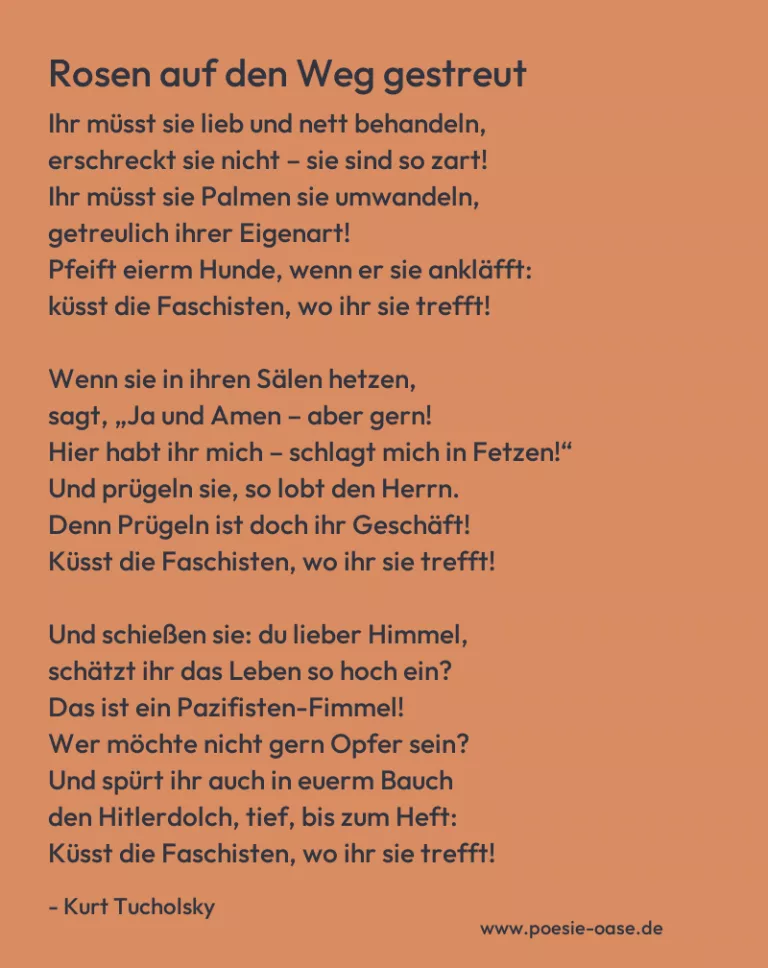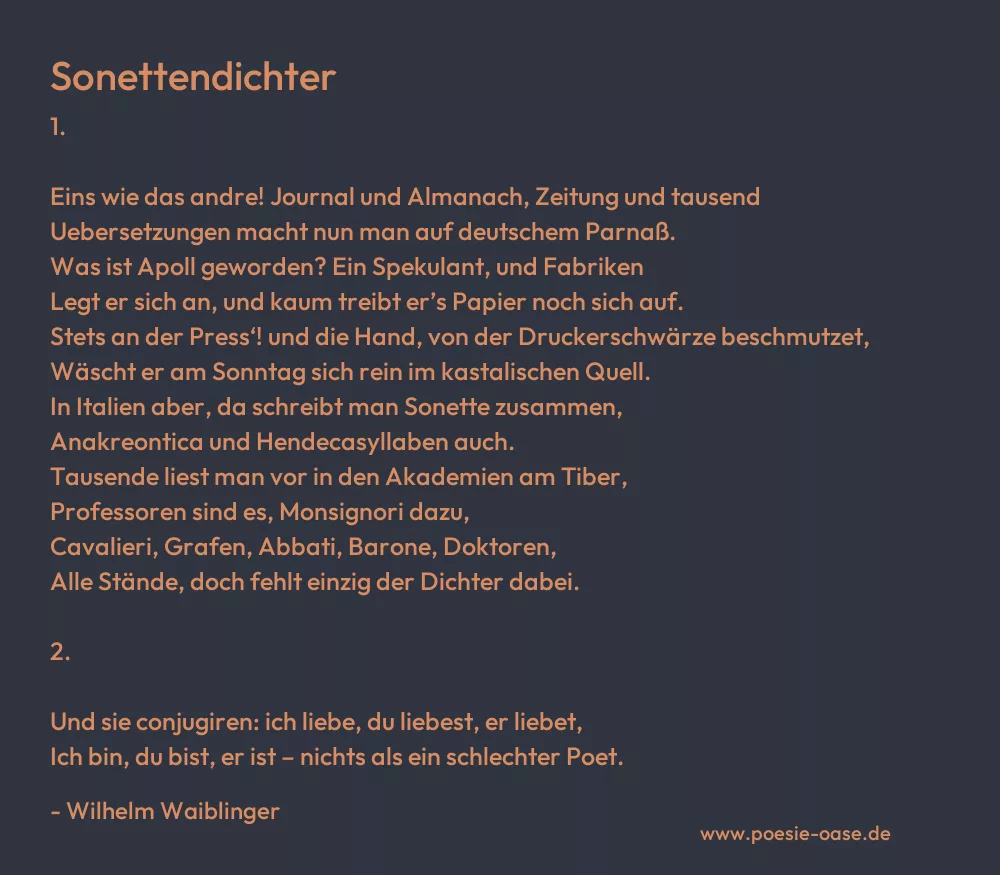Sonettendichter
1.
Eins wie das andre! Journal und Almanach, Zeitung und tausend
Uebersetzungen macht nun man auf deutschem Parnaß.
Was ist Apoll geworden? Ein Spekulant, und Fabriken
Legt er sich an, und kaum treibt er’s Papier noch sich auf.
Stets an der Press‘! und die Hand, von der Druckerschwärze beschmutzet,
Wäscht er am Sonntag sich rein im kastalischen Quell.
In Italien aber, da schreibt man Sonette zusammen,
Anakreontica und Hendecasyllaben auch.
Tausende liest man vor in den Akademien am Tiber,
Professoren sind es, Monsignori dazu,
Cavalieri, Grafen, Abbati, Barone, Doktoren,
Alle Stände, doch fehlt einzig der Dichter dabei.
2.
Und sie conjugiren: ich liebe, du liebest, er liebet,
Ich bin, du bist, er ist – nichts als ein schlechter Poet.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
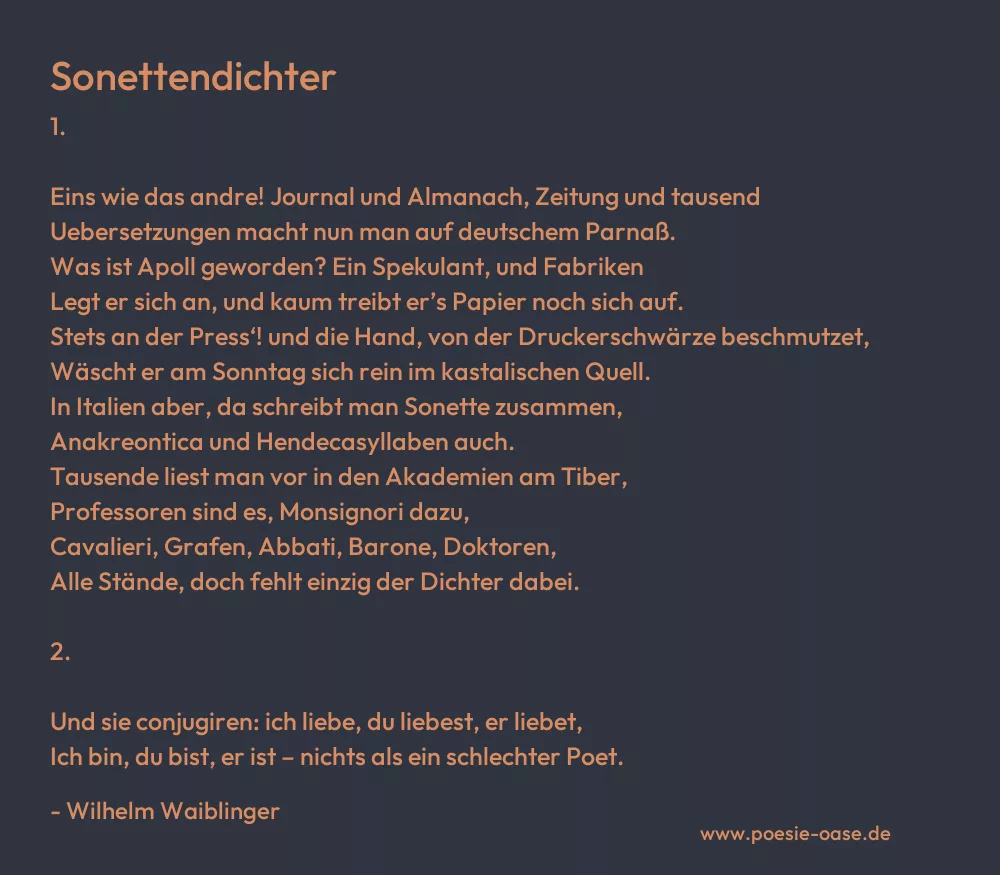
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sonettendichter“ von Wilhelm Waiblinger setzt sich auf kritische Weise mit der Entwicklung der Literatur und der Rolle des Dichters in der modernen Gesellschaft auseinander. Im ersten Teil beschreibt Waiblinger eine Entfremdung des künstlerischen Schaffens von seiner ursprünglichen, poetischen Natur. „Eins wie das andre! Journal und Almanach, Zeitung und tausend / Uebersetzungen macht nun man auf deutschem Parnaß“ – hier wird die Literaturproduktion als mechanisiert und von kommerziellen Interessen bestimmt dargestellt. Der „Parnass“ – der mythische Ort der Dichter – wird zur Produktionsstätte für übersetzte Werke und Publikationen, was die „Heiligkeit“ der Kunst entweihen lässt.
Die Figur des Apoll, einst Symbol der Muse und der Poesie, wird ironisch als „Spekulant“ und „Fabrikant“ dargestellt, was auf den Verlust der ursprünglichen Erhabenheit und den ökonomischen Druck hinweist, dem moderne Dichter und Literatur unterworfen sind. Das Bild von Apoll, der „Stets an der Press‘“ arbeitet und sich von „Druckerschwärze“ reinigt, deutet auf eine Entwertung des schöpferischen Prozesses hin – der Dichter wird zu einem Handwerker, der mit seiner Kunst Geld verdient und sich von der „kastalischen Quelle“ (ein Symbol der Reinheit und Inspiration) nur noch ritualisiert reinigt.
Im Gegensatz dazu wird in Italien, dem traditionellen Zentrum der klassischen Poesie, noch immer das „Sonett“ gepflegt, „Anakreontica und Hendecasyllaben“ werden dort von „Professoren, Monsignori, Cavalieri, Grafen, Abbati, Barone, Doktoren“ gelesen – jedoch, wie Waiblinger ironisch anmerkt, fehlt der wahre Dichter. Diese Szene reflektiert eine Gesellschaft, die zwar die Formen der hohen Poesie pflegt, aber den eigentlichen kreativen Geist des Dichters verloren hat. Der Dichter wird in dieser Darstellung zum „Fremden“ in seiner eigenen Kunst, da er von gesellschaftlichen Eliten auf Distanz gehalten wird.
Im zweiten Teil des Gedichts wird die Bedeutung der Sprache und die Unterscheidung zwischen echtem künstlerischen Ausdruck und der Trivialität der modernen Literatur thematisiert. Das wiederholte „Ich liebe, du liebest, er liebet“ und die „schlechte[r] Poet“ stellt die formale, mechanische Struktur der Poesie in den Vordergrund, die zu einer bloßen grammatikalischen Übung wird. Hierbei wird die Kunst als etwas Entleertes und Künstliches beschrieben, das seine tiefere, emotionalere Bedeutung verloren hat. Waiblinger kritisiert die oberflächliche Nachahmung der großen Poesie und fordert damit eine Rückkehr zu echter, lebendiger Dichtung.
Das Gedicht ist eine scharfe Kritik an der Kommerzialisierung und Entwertung der Kunst sowie an der Entfremdung des Dichters von seiner wahren Berufung. Waiblinger stellt einen scharfen Kontrast zwischen der modernen, mechanisierten Literaturproduktion und der klassischen, poetischen Tradition her, die in der Realität jedoch auch ihre eigenen Schwächen zeigt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.