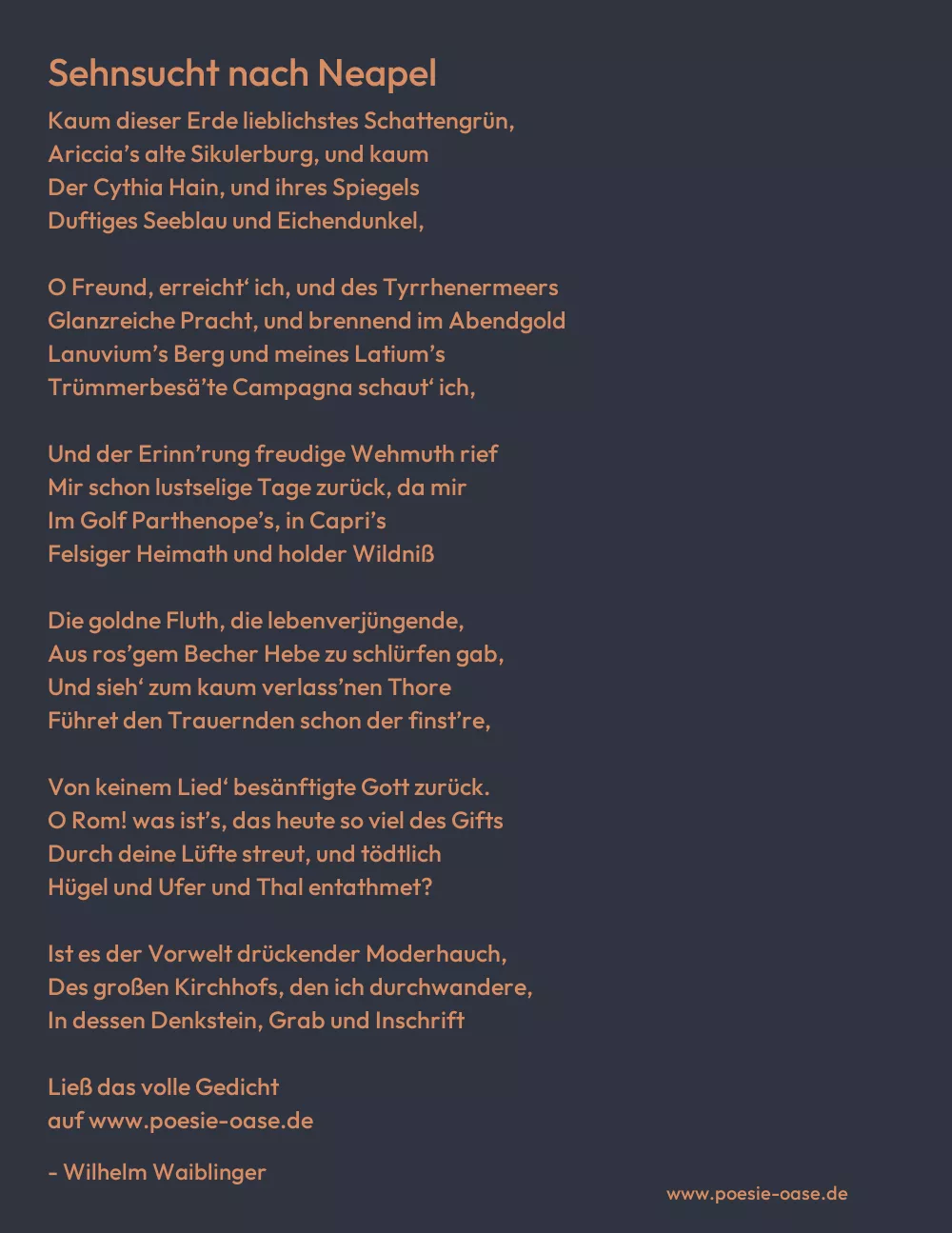Kaum dieser Erde lieblichstes Schattengrün,
Ariccia’s alte Sikulerburg, und kaum
Der Cythia Hain, und ihres Spiegels
Duftiges Seeblau und Eichendunkel,
O Freund, erreicht‘ ich, und des Tyrrhenermeers
Glanzreiche Pracht, und brennend im Abendgold
Lanuvium’s Berg und meines Latium’s
Trümmerbesä’te Campagna schaut‘ ich,
Und der Erinn’rung freudige Wehmuth rief
Mir schon lustselige Tage zurück, da mir
Im Golf Parthenope’s, in Capri’s
Felsiger Heimath und holder Wildniß
Die goldne Fluth, die lebenverjüngende,
Aus ros’gem Becher Hebe zu schlürfen gab,
Und sieh‘ zum kaum verlass’nen Thore
Führet den Trauernden schon der finst’re,
Von keinem Lied‘ besänftigte Gott zurück.
O Rom! was ist’s, das heute so viel des Gifts
Durch deine Lüfte streut, und tödtlich
Hügel und Ufer und Thal entathmet?
Ist es der Vorwelt drückender Moderhauch,
Des großen Kirchhofs, den ich durchwandere,
In dessen Denkstein, Grab und Inschrift
Einsame Wand’rer und ernste Denker
Die Weltgeschichte lasen; vielleicht das Blut
Das hier geströmt Jahrtausende durch, und tief
Befleckt die Erde, welch ein Tiber
Faßt‘ es in seines Gestades Gränze?
Nicht weiß ich’s, Freund, doch sei dir bekannt: Zwar pflegt
Mich treue Sorgfalt: Amor, mein steter Freund,
Wenn längst auch mit gesenktem Flügel,
Ist er doch immer noch mein Begleiter,
Und kürzt der Stunden Kummer und Ungeduld,
In Traum und Schlaf einwiegend das Herz, wenn nicht
Mit Diotimas Lehre, doch mit
Raffael’s Freuden und Benvenuto’s.
Wohl rühm‘ ich deß mich! Aber in Rom dünkt mir,
Als ob im Grab ich schlummr‘, und im Zaubergolf
Neapels Psyche bald zur reinen
Schönheit Elysiums auferstünde.