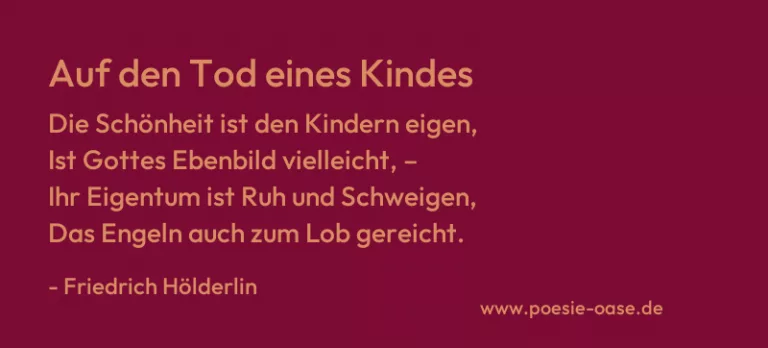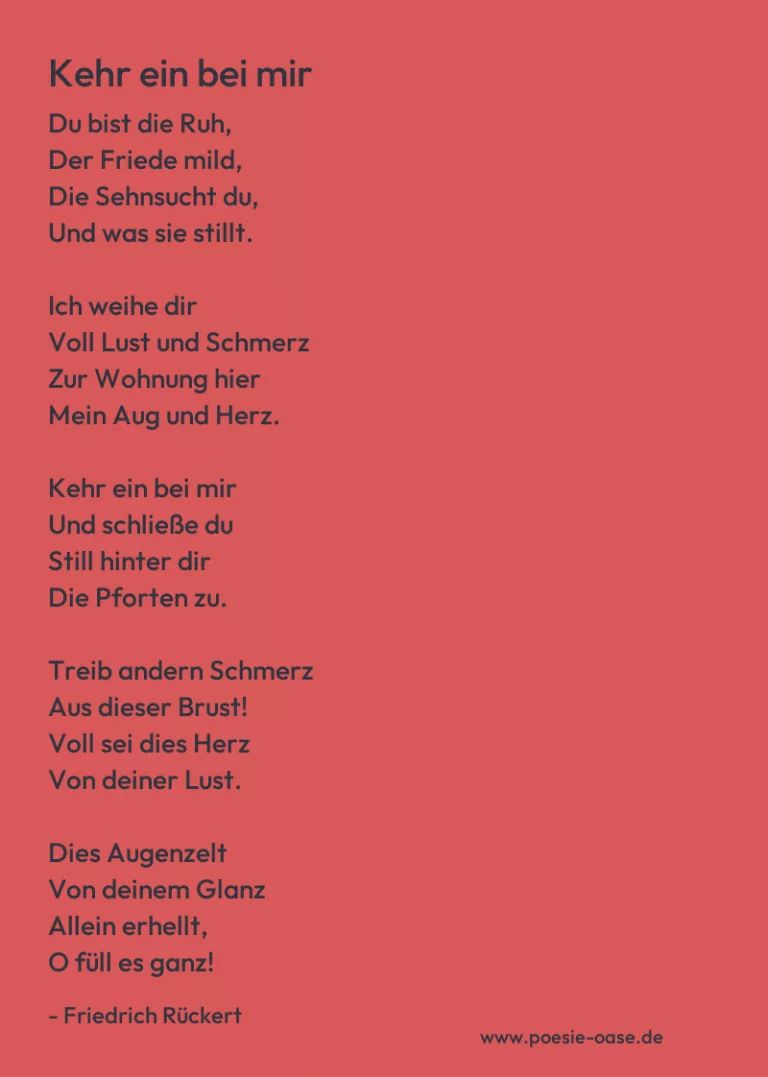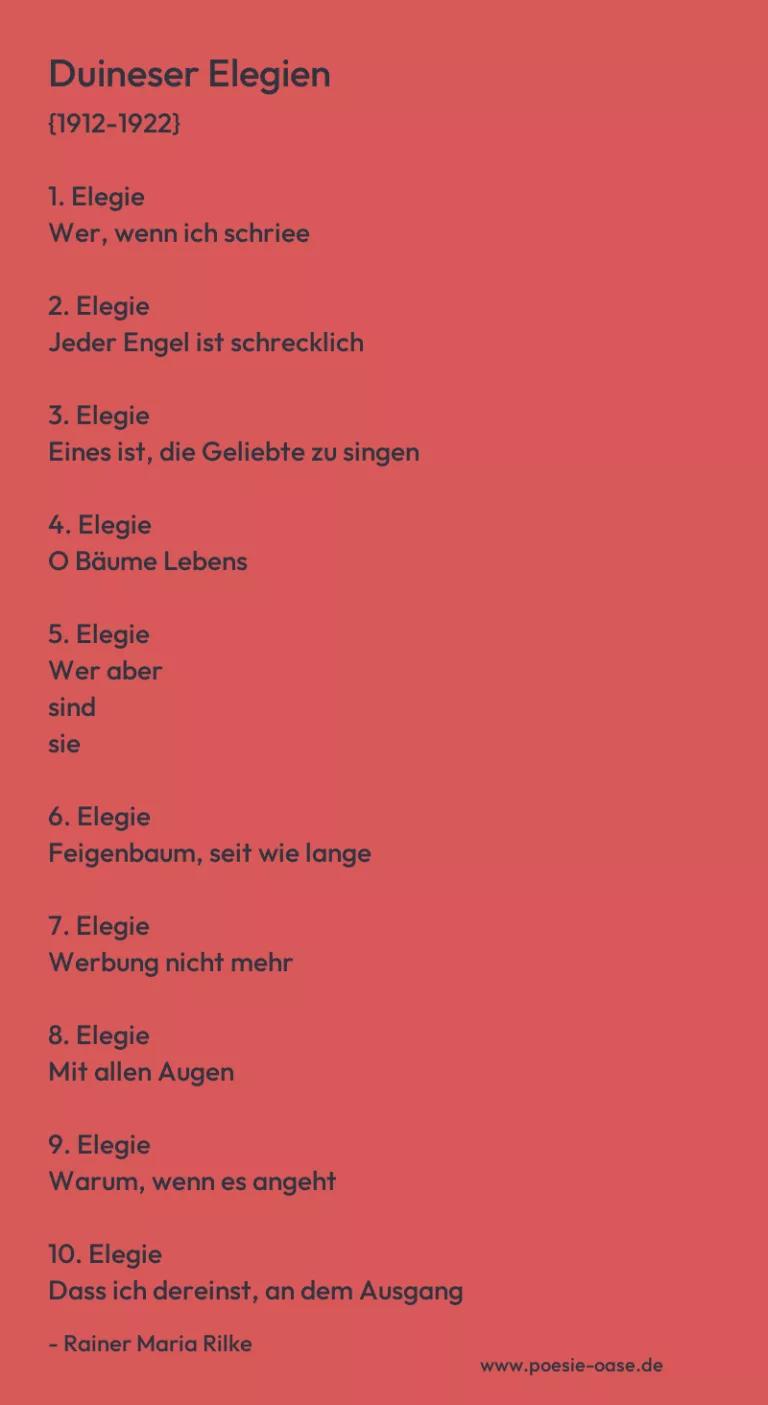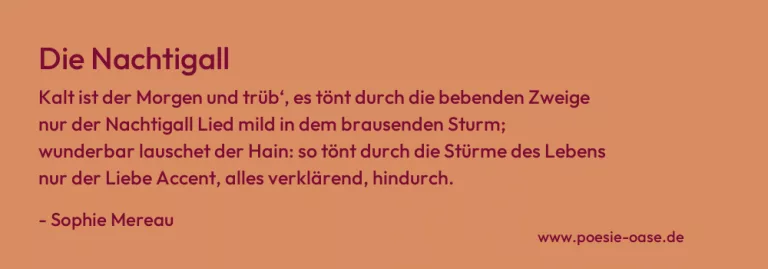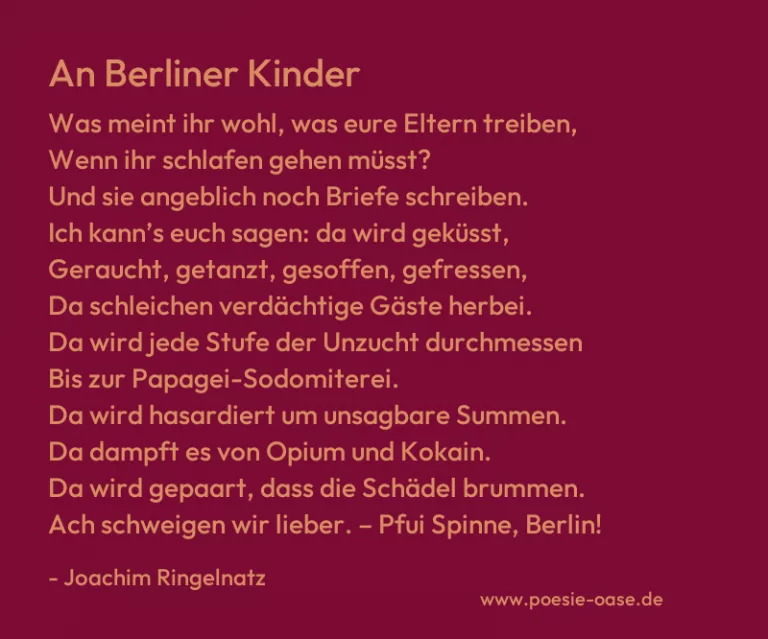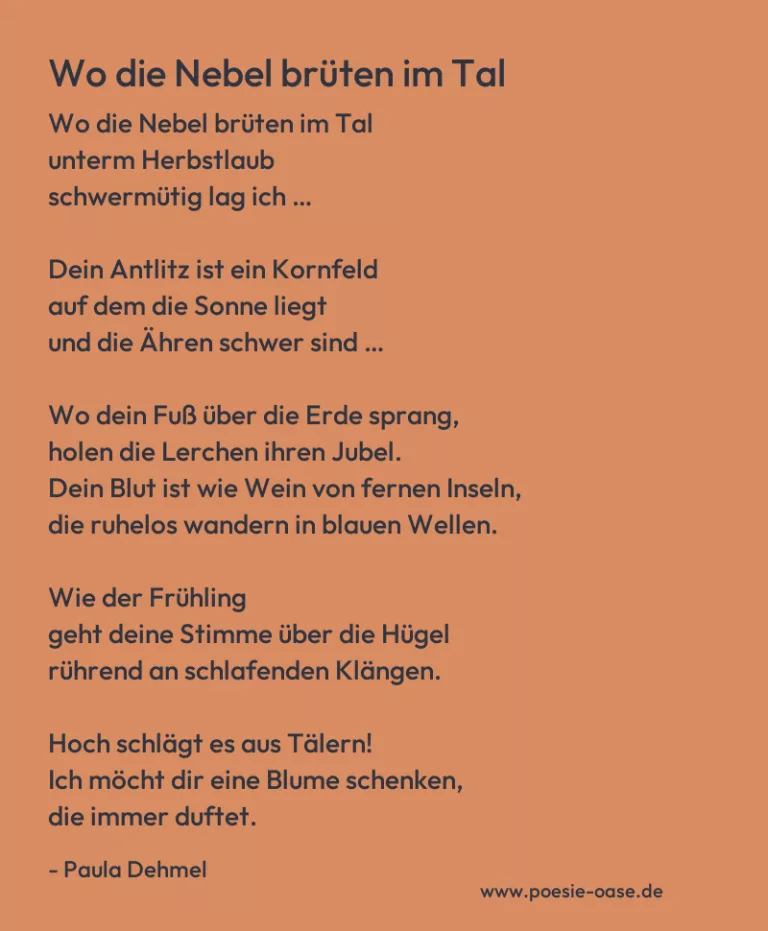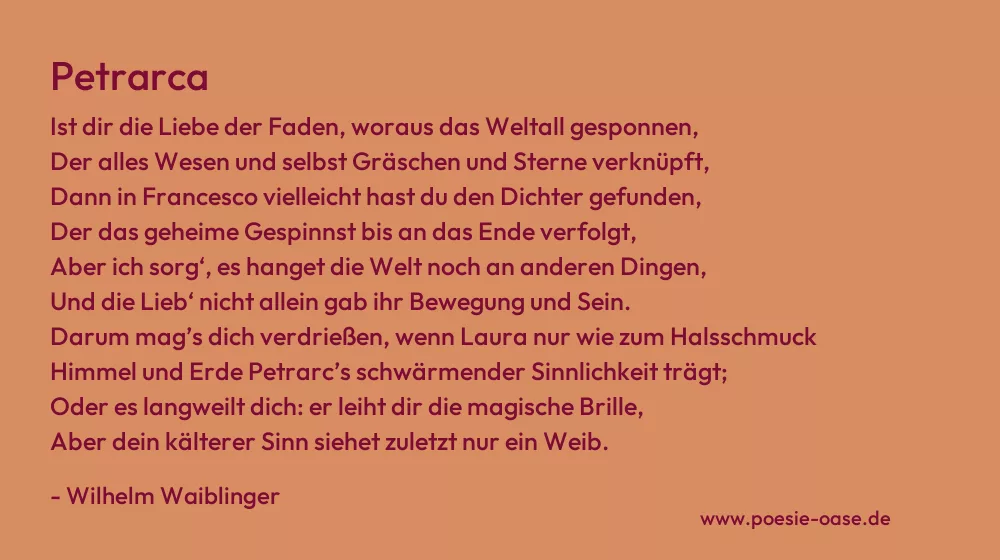Petrarca
Ist dir die Liebe der Faden, woraus das Weltall gesponnen,
Der alles Wesen und selbst Gräschen und Sterne verknüpft,
Dann in Francesco vielleicht hast du den Dichter gefunden,
Der das geheime Gespinnst bis an das Ende verfolgt,
Aber ich sorg‘, es hanget die Welt noch an anderen Dingen,
Und die Lieb‘ nicht allein gab ihr Bewegung und Sein.
Darum mag’s dich verdrießen, wenn Laura nur wie zum Halsschmuck
Himmel und Erde Petrarc’s schwärmender Sinnlichkeit trägt;
Oder es langweilt dich: er leiht dir die magische Brille,
Aber dein kälterer Sinn siehet zuletzt nur ein Weib.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
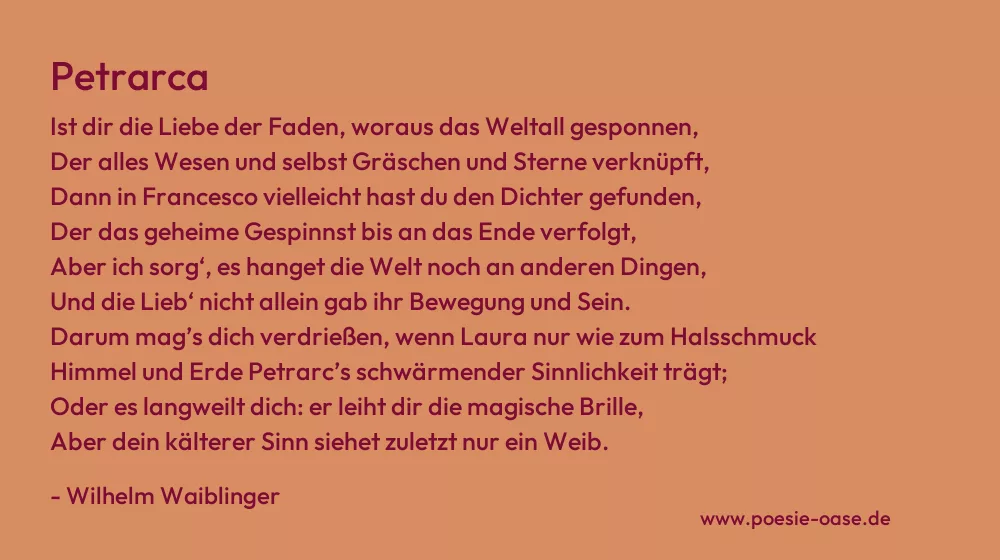
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Petrarca“ von Wilhelm Waiblinger setzt sich kritisch mit der romantisierten und idealisierten Darstellung von Liebe auseinander, die in der Dichtung des Petrarca zu finden ist. Zu Beginn wird die „Liebe“ als der „Faden“ beschrieben, aus dem „das Weltall gesponnen“ wurde, was auf die universelle Bedeutung und Kraft der Liebe verweist. Diese Vorstellung von Liebe als verbindende Kraft, die das ganze Universum zusammenhält, erinnert an die idealisierte, fast göttliche Vorstellung der Liebe, die oft in der Literatur und in der Philosophie des Mittelalters und der Renaissance zu finden ist. In dieser Sichtweise wird Liebe als die treibende Kraft hinter allem, vom winzigen Grashalm bis hin zu den Sternen, dargestellt.
Doch Waiblinger führt in der nächsten Zeile eine kritische Perspektive ein: „Dann in Francesco vielleicht hast du den Dichter gefunden, / Der das geheime Gespinnst bis an das Ende verfolgt“. Hier bezieht sich „Francesco“ auf den Dichter Petrarca, der für seine leidenschaftlichen Gedichte an seine unglücklich geliebte Laura bekannt ist. Waiblinger deutet an, dass Petrarca zwar die „geheimen Fäden“ der Liebe bis zum Ende verfolgt, aber auch eine gewisse Einsamkeit oder Unerreichbarkeit in diesem Streben spürbar ist. Die Liebe, die Petrarca beschreibt, wird hier als eine fast überhöhte und unerreichbare Vision dargestellt, die weniger mit der Realität und den weltlichen Bedürfnissen der Menschen zu tun hat.
In der zweiten Strophe kommt Waiblinger zu der Erkenntnis, dass „die Welt noch an anderen Dingen“ hängt und die Liebe nicht allein das Universum bewegt. Diese Bemerkung bringt eine gewisse Ernüchterung in das Bild der Liebe als universelle Kraft. Die Liebe mag eine wichtige Rolle spielen, aber sie ist nicht die einzige treibende Kraft des Lebens. Der Dichter kritisiert die romantische Überhöhung von Petrarcas Liebe und zeigt, dass es noch viele andere Aspekte gibt, die das Leben und die Welt beeinflussen.
Die letzten Zeilen des Gedichts bringen eine weitere kritische Perspektive auf Petrarcas Dichtung und die Darstellung seiner Laura. „Darum mag’s dich verdrießen, wenn Laura nur wie zum Halsschmuck / Himmel und Erde Petrarc’s schwärmender Sinnlichkeit trägt“ deutet darauf hin, dass die Liebe in Petrarcas Werken möglicherweise als Objekt der Sinnlichkeit und nicht als etwas Tieferes oder Ganzheitlicheres dargestellt wird. Laura wird hier nicht als eigenständige, komplexe Figur beschrieben, sondern als Schmuckstück oder als Projektionsfläche für Petrarcas eigene Sehnsüchte und Schwärmerei.
Schließlich beschreibt Waiblinger, dass der „kältere Sinn“ des Lesers in Petrarcas Werken möglicherweise nur das „Weib“ sieht, was auf eine Entfremdung von der romantischen Idealisierung hinweist. Petrarcas leidenschaftliche Darstellung von Laura wird durch diese kühle, nüchterne Perspektive entzaubert, sodass die Leser nur noch die Oberfläche – die äußere Erscheinung der Liebe – wahrnehmen, anstatt die tiefere emotionale und geistige Verbindung zu erkennen. Waiblinger fordert somit eine differenziertere Sichtweise auf die Liebe und die Dichtung, die sich nicht nur von der sinnlichen Oberfläche leiten lässt, sondern auch die komplexeren, weniger idealisierten Aspekte des Lebens berücksichtigt.
Insgesamt stellt Waiblinger in diesem Gedicht eine kritische Auseinandersetzung mit der überhöhten Darstellung der Liebe in der Literatur dar, insbesondere in der Dichtung Petrarcas. Die Liebe, die als universelle Kraft dargestellt wird, wird hier hinterfragt, indem gezeigt wird, dass die Welt und das Leben auch von anderen Faktoren beeinflusst werden. Waiblinger fordert eine realistischere und differenziertere Sichtweise auf die Liebe und die Kunst.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.