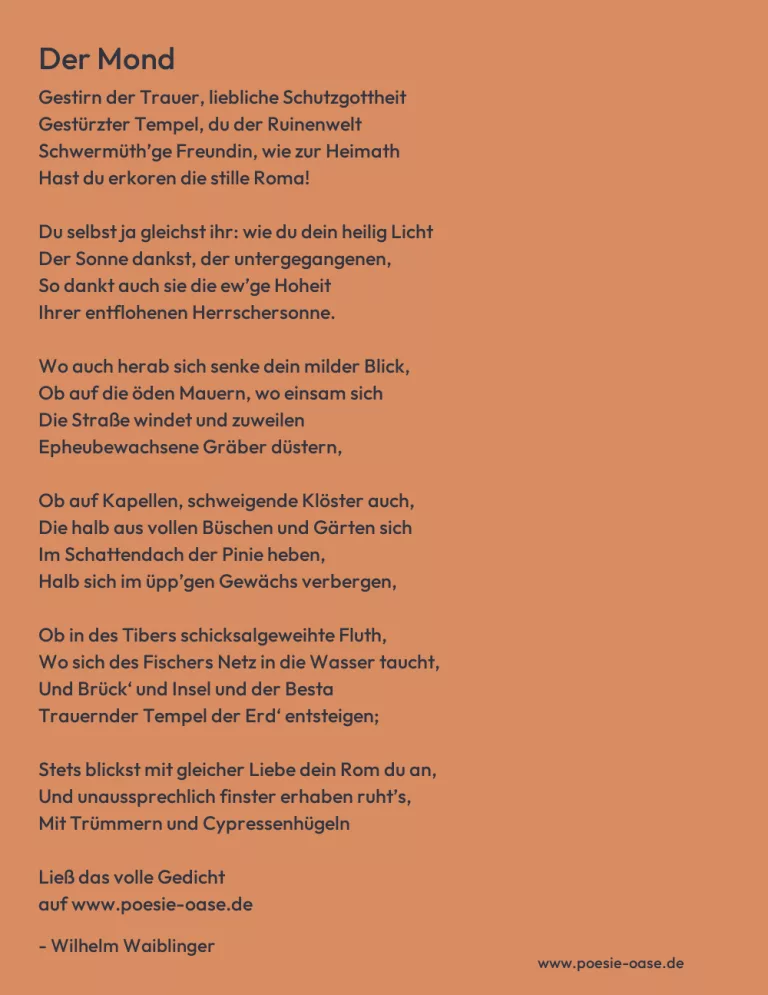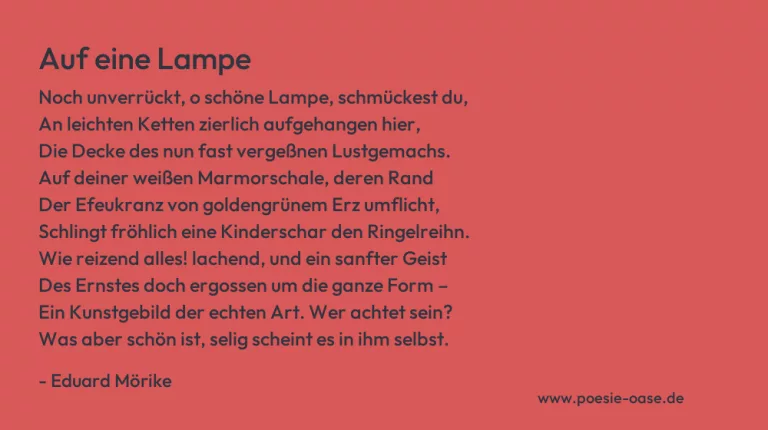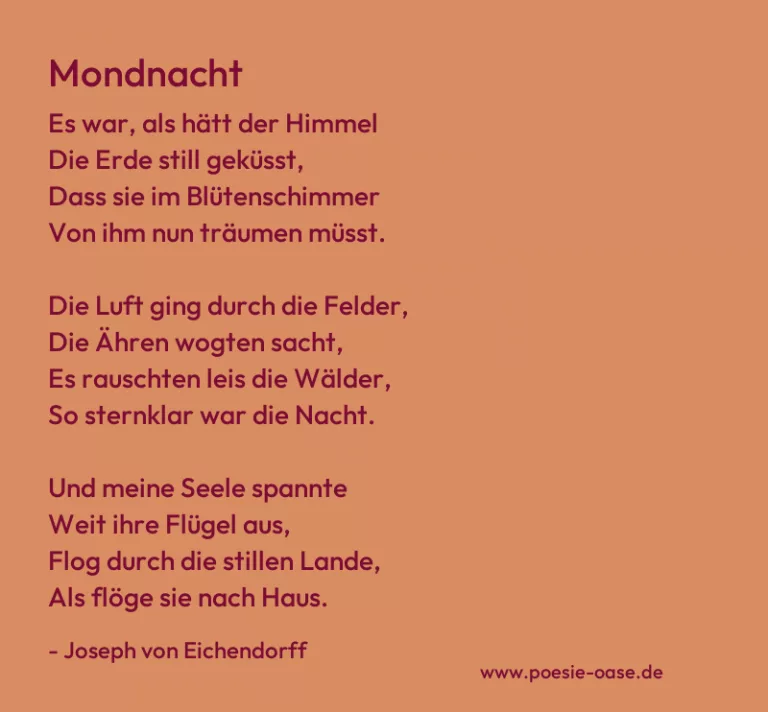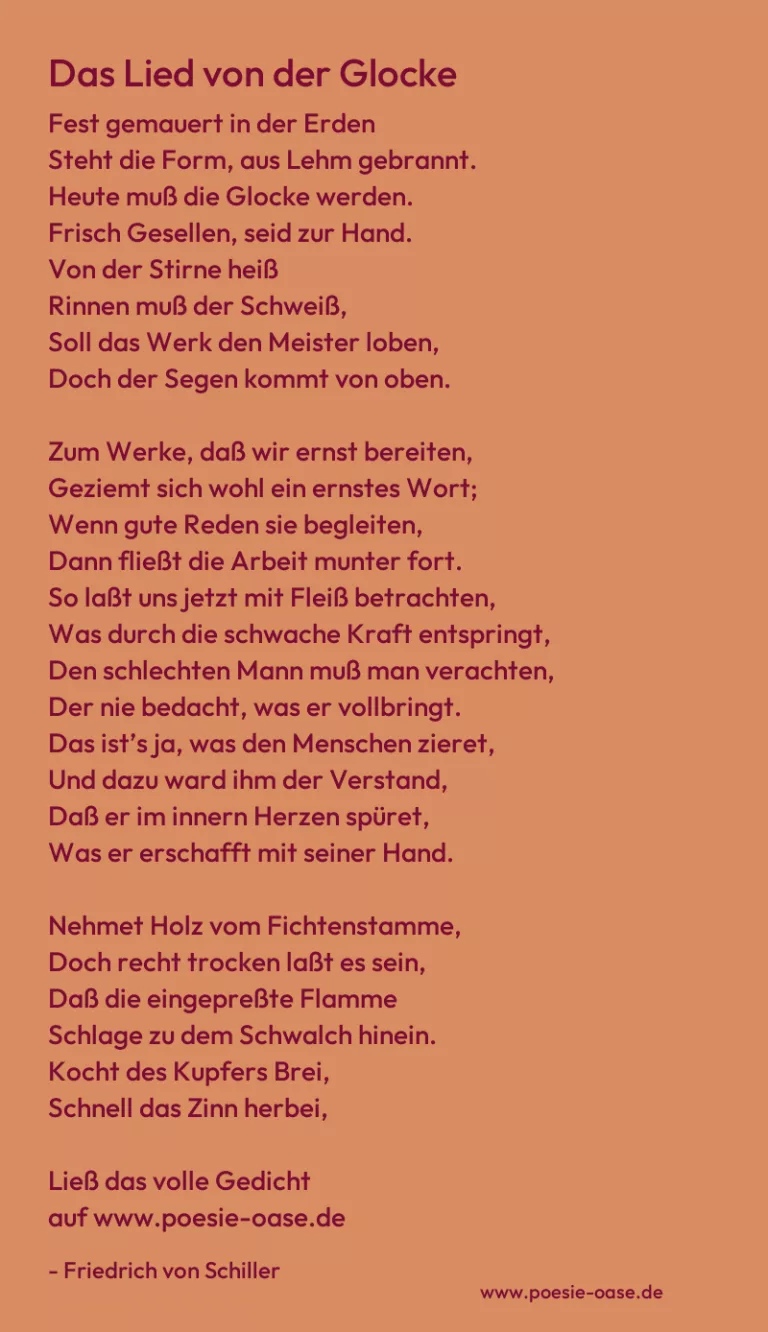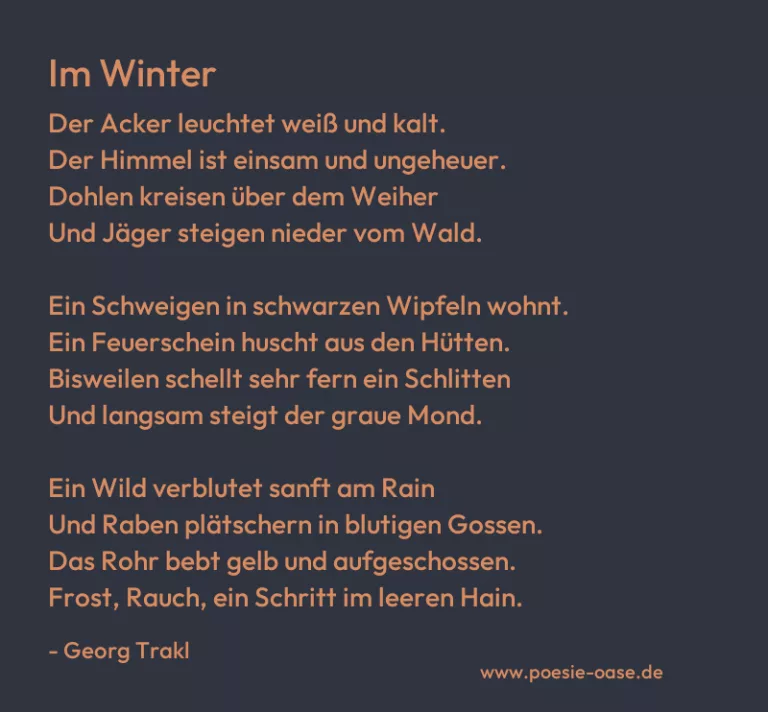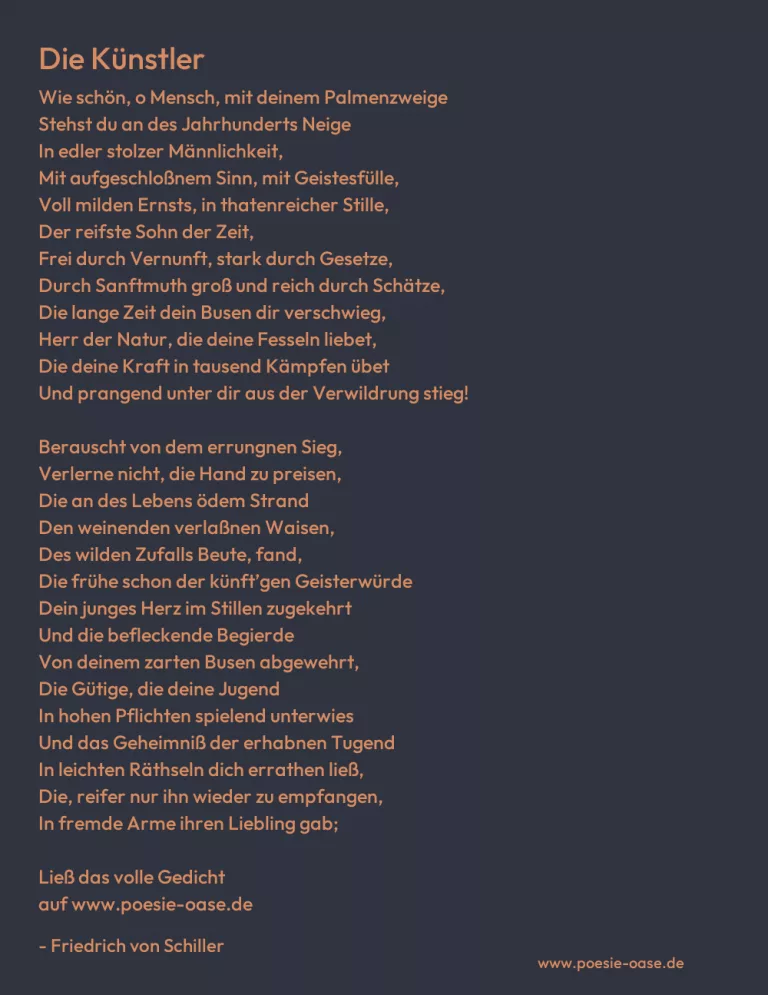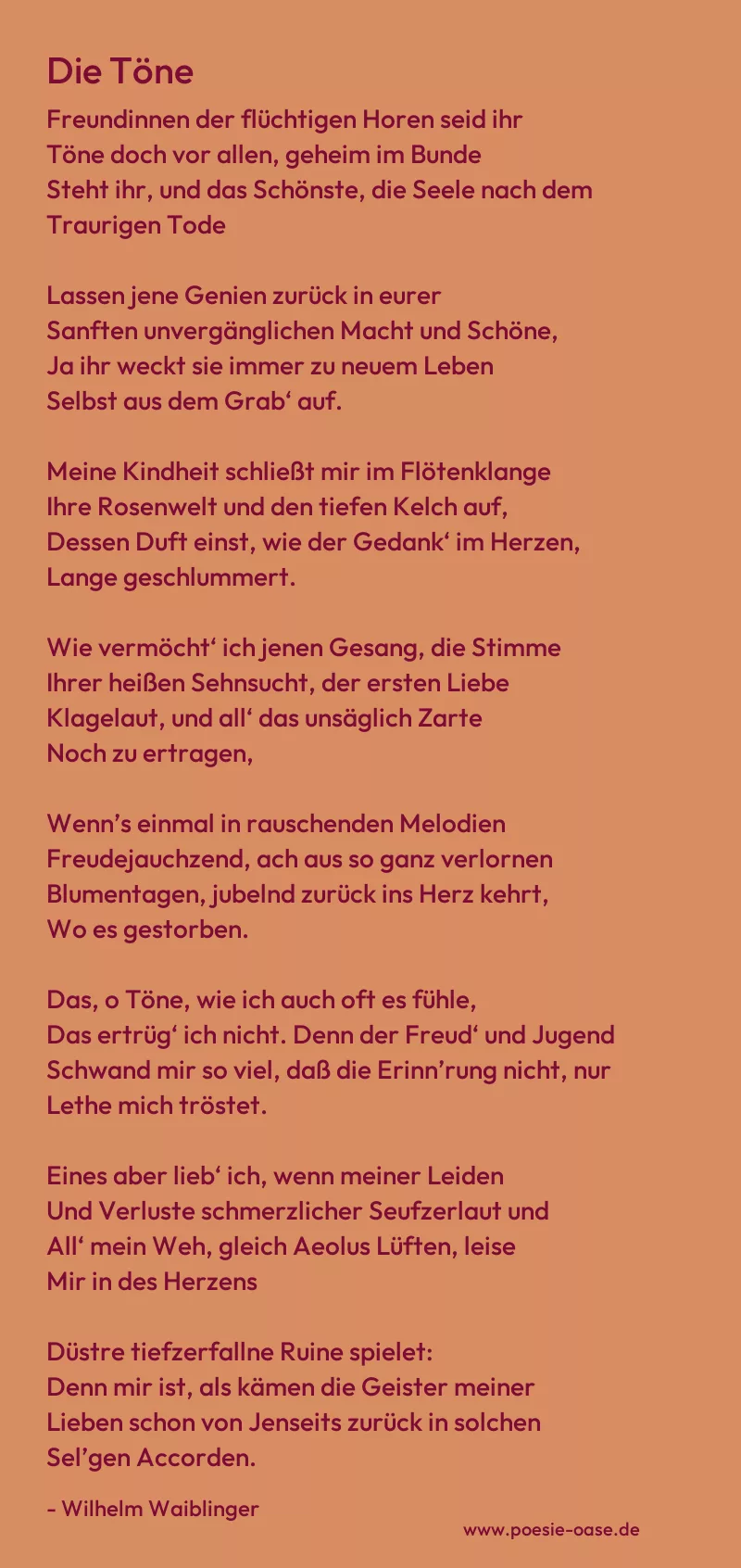Freundinnen der flüchtigen Horen seid ihr
Töne doch vor allen, geheim im Bunde
Steht ihr, und das Schönste, die Seele nach dem
Traurigen Tode
Lassen jene Genien zurück in eurer
Sanften unvergänglichen Macht und Schöne,
Ja ihr weckt sie immer zu neuem Leben
Selbst aus dem Grab‘ auf.
Meine Kindheit schließt mir im Flötenklange
Ihre Rosenwelt und den tiefen Kelch auf,
Dessen Duft einst, wie der Gedank‘ im Herzen,
Lange geschlummert.
Wie vermöcht‘ ich jenen Gesang, die Stimme
Ihrer heißen Sehnsucht, der ersten Liebe
Klagelaut, und all‘ das unsäglich Zarte
Noch zu ertragen,
Wenn’s einmal in rauschenden Melodien
Freudejauchzend, ach aus so ganz verlornen
Blumentagen, jubelnd zurück ins Herz kehrt,
Wo es gestorben.
Das, o Töne, wie ich auch oft es fühle,
Das ertrüg‘ ich nicht. Denn der Freud‘ und Jugend
Schwand mir so viel, daß die Erinn’rung nicht, nur
Lethe mich tröstet.
Eines aber lieb‘ ich, wenn meiner Leiden
Und Verluste schmerzlicher Seufzerlaut und
All‘ mein Weh, gleich Aeolus Lüften, leise
Mir in des Herzens
Düstre tiefzerfallne Ruine spielet:
Denn mir ist, als kämen die Geister meiner
Lieben schon von Jenseits zurück in solchen
Sel’gen Accorden.