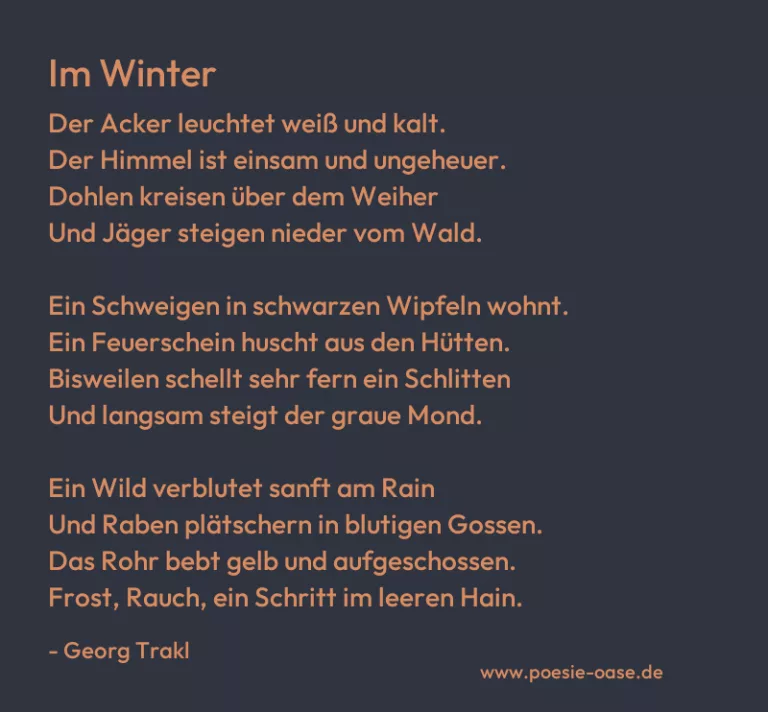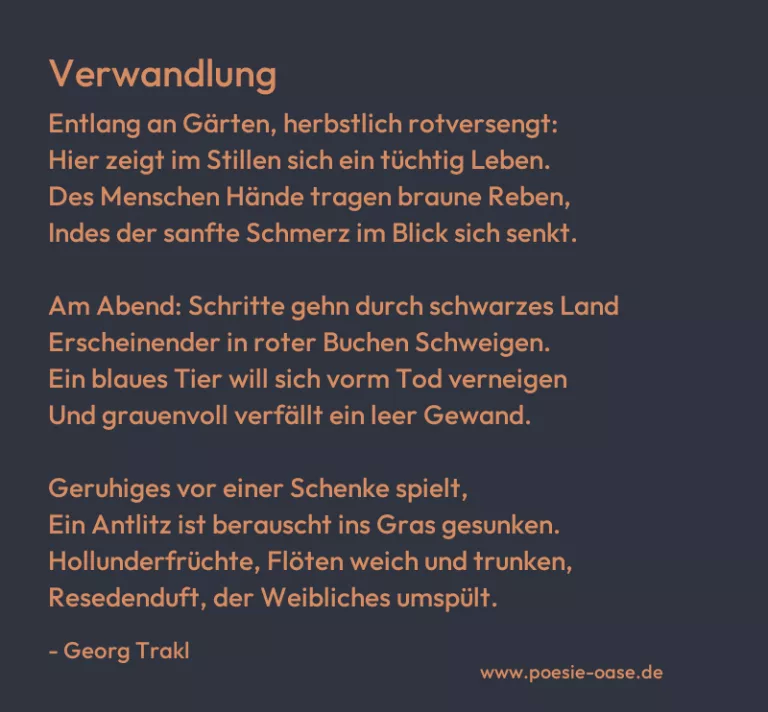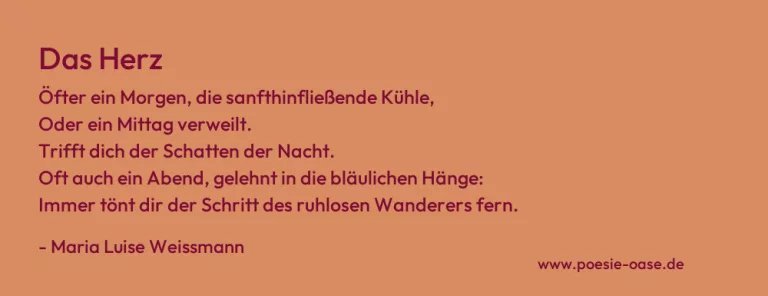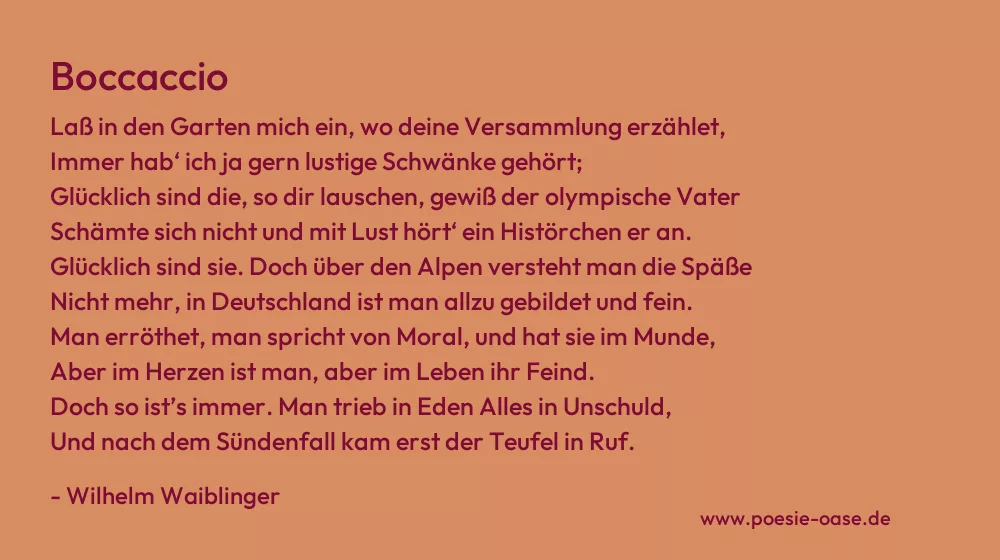Boccaccio
Laß in den Garten mich ein, wo deine Versammlung erzählet,
Immer hab‘ ich ja gern lustige Schwänke gehört;
Glücklich sind die, so dir lauschen, gewiß der olympische Vater
Schämte sich nicht und mit Lust hört‘ ein Histörchen er an.
Glücklich sind sie. Doch über den Alpen versteht man die Späße
Nicht mehr, in Deutschland ist man allzu gebildet und fein.
Man erröthet, man spricht von Moral, und hat sie im Munde,
Aber im Herzen ist man, aber im Leben ihr Feind.
Doch so ist’s immer. Man trieb in Eden Alles in Unschuld,
Und nach dem Sündenfall kam erst der Teufel in Ruf.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
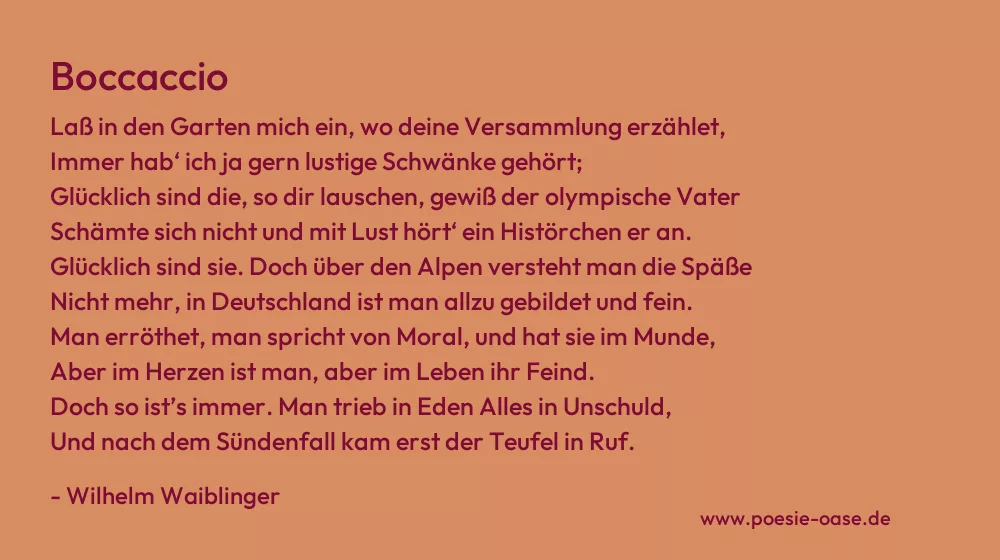
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Boccaccio“ von Wilhelm Waiblinger reflektiert über die kulturellen und moralischen Unterschiede zwischen der antiken, unbefangenen Lebensweise und der bürgerlichen, überkorrekten Haltung der modernen Gesellschaft. Zu Beginn des Gedichts ruft das lyrische Ich einen idealisierten Ort hervor, einen Garten, in dem Geschichten und „lustige Schwänke“ erzählt werden – ein Bild für eine unbeschwerte, natürliche Unterhaltung, die den Charme der antiken Literatur und der Geschichten von Boccaccio widerspiegelt. Boccaccio, der als Meister des heiteren und oft schlüpfrigen Erzählens bekannt ist, wird hier als Symbol für eine Lebensweise dargestellt, die von Ungezwungenheit, Humor und einer gewissen Lebensfreude geprägt ist. Diese Geschichten werden als so ansprechend beschrieben, dass selbst der „olympische Vater“ (Zeus) „mit Lust“ zuhört, was die überzeitliche Anziehungskraft von Erzählkunst und Humor betont.
Das Gedicht setzt sich dann kritisch mit der modernen Gesellschaft auseinander, die diese Art von heiterer und unbeschwerter Unterhaltung nicht mehr zu schätzen weiß. Der Vergleich mit den Alpen und der Bemerkung, dass „man in Deutschland allzu gebildet und fein“ ist, unterstreicht das Bild einer Gesellschaft, die sich von der Ungezwungenheit der antiken Traditionen entfernt hat und stattdessen von einer strengen, übermäßigen Moral geprägt ist. In der modernen Gesellschaft spricht man „von Moral“, aber diese ist, so die scharfe Kritik, im „Herzen“ und im „Leben“ des Einzelnen nicht zu finden. Es wird eine Kluft zwischen den äußeren moralischen Normen und den tatsächlichen Handlungen des Individuums gezogen, die die Gesellschaft heuchlerisch erscheinen lässt.
Im letzten Abschnitt des Gedichts wird ein tieferer, fast philosophischer Bezug zur biblischen Erzählung vom Sündenfall hergestellt. Waiblinger deutet an, dass der Verlust der Unschuld, symbolisiert durch den Sündenfall im Garten Eden, mit einem Verlust an natürlichen und einfachen Freuden einherging. Nachdem die Menschen aus dem Paradies vertrieben wurden, begann die Zivilisation, die mit ihren Regeln, Normen und der „Moral“ verbunden ist. Dies wird als eine Art „Sündenfall“ in der Gesellschaft selbst beschrieben, wobei die einfache Freude und Unbeschwertheit der frühen Menschheit durch die Schwere von gesellschaftlicher Erwartung und moralischer Strenge ersetzt wurde.
Insgesamt kritisiert Waiblinger in diesem Gedicht die übermäßige Ernsthaftigkeit und die Moralismen der modernen Welt und idealisiert eine unbeschwerte, weniger komplexe Zeit, in der Humor und einfache Freude einen höheren Wert hatten. Die Rückkehr zu einer natürlichen Lebensweise, die sich durch Humor, Leichtigkeit und ein gesundes Maß an Unschuld auszeichnet, erscheint ihm als ein Verlust, der mit der „Zivilisation“ und dem Sündenfall verbunden ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.