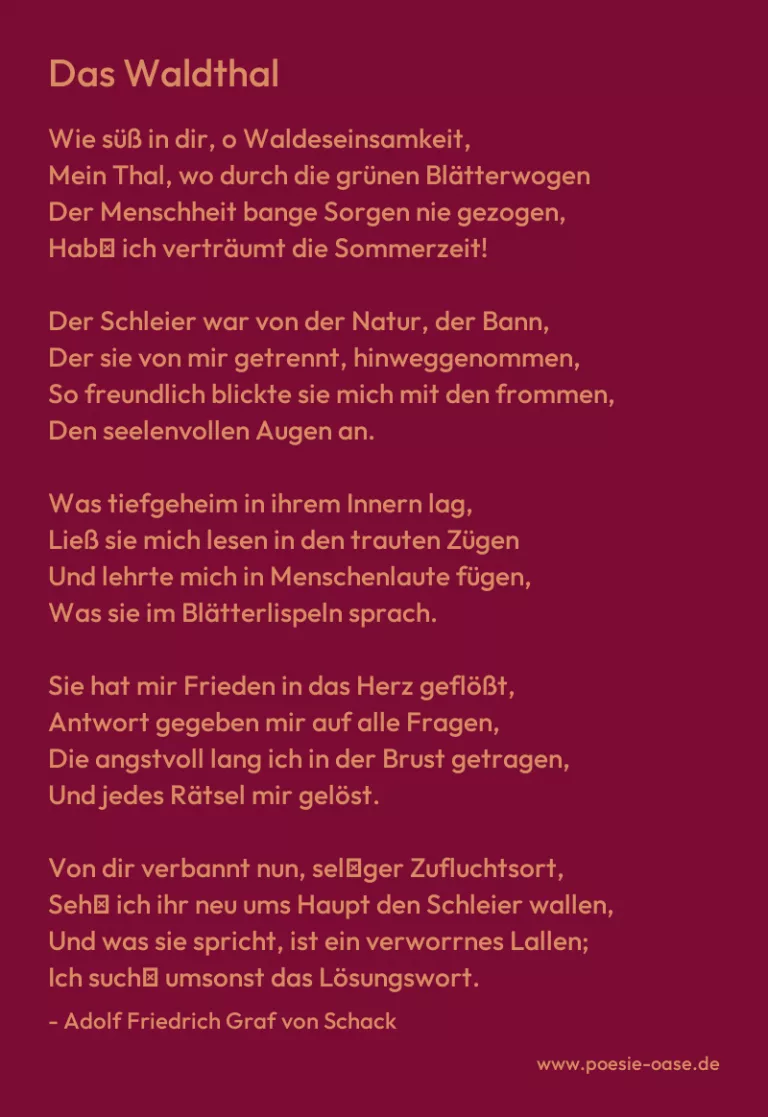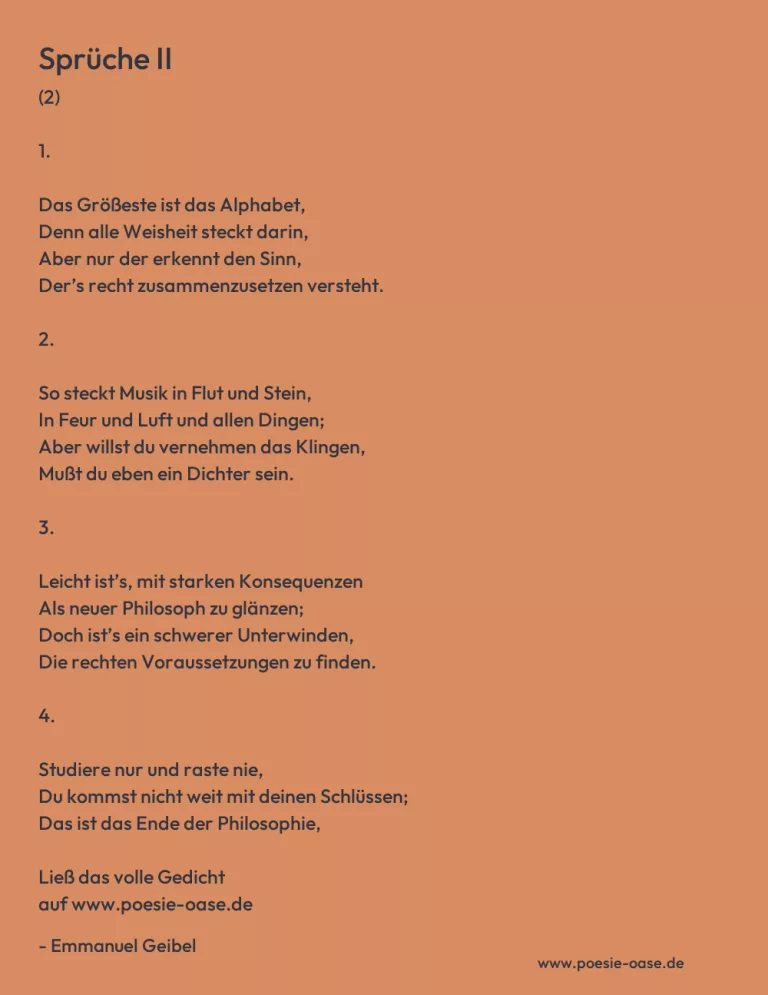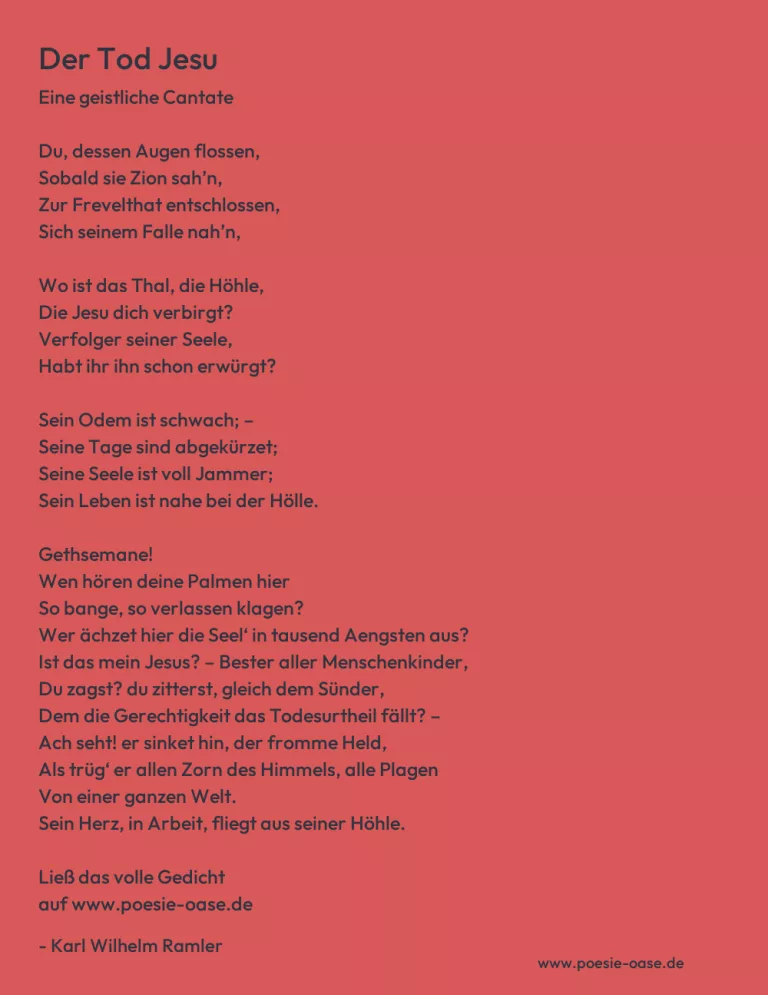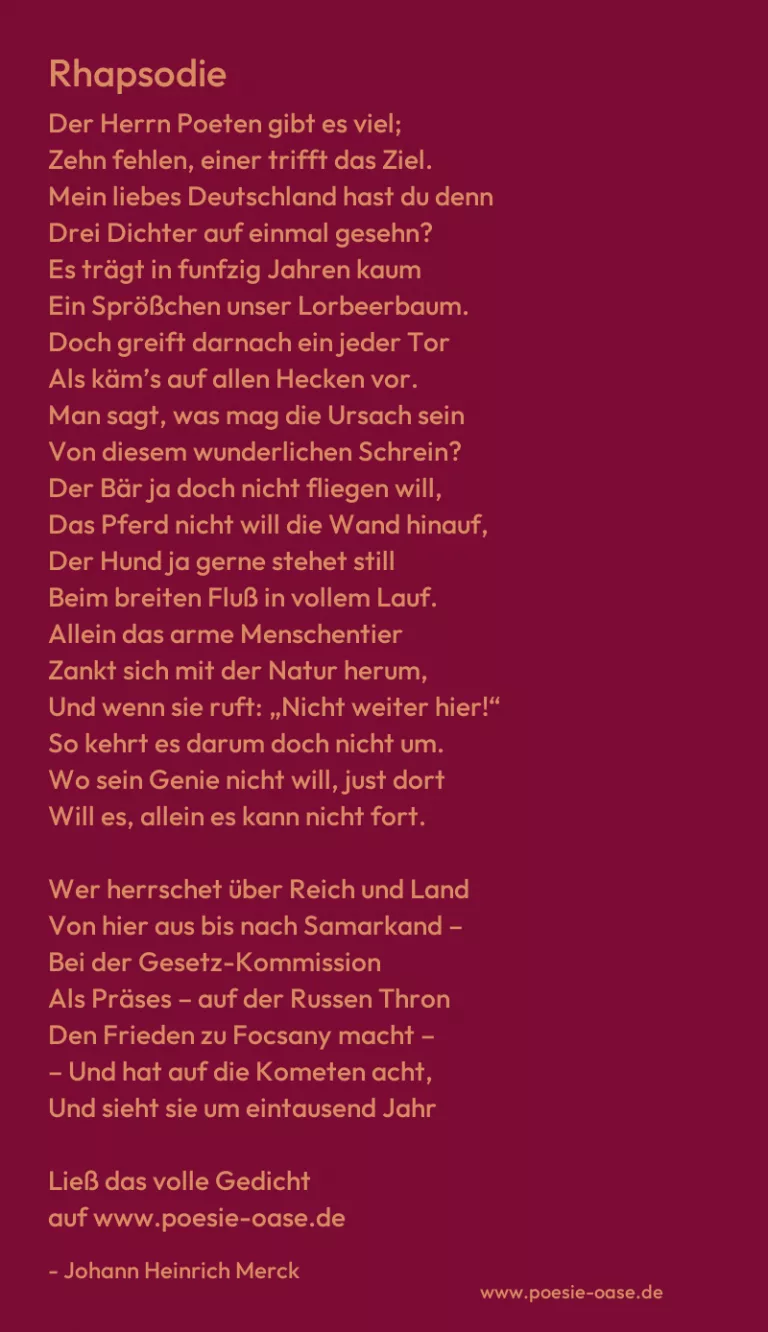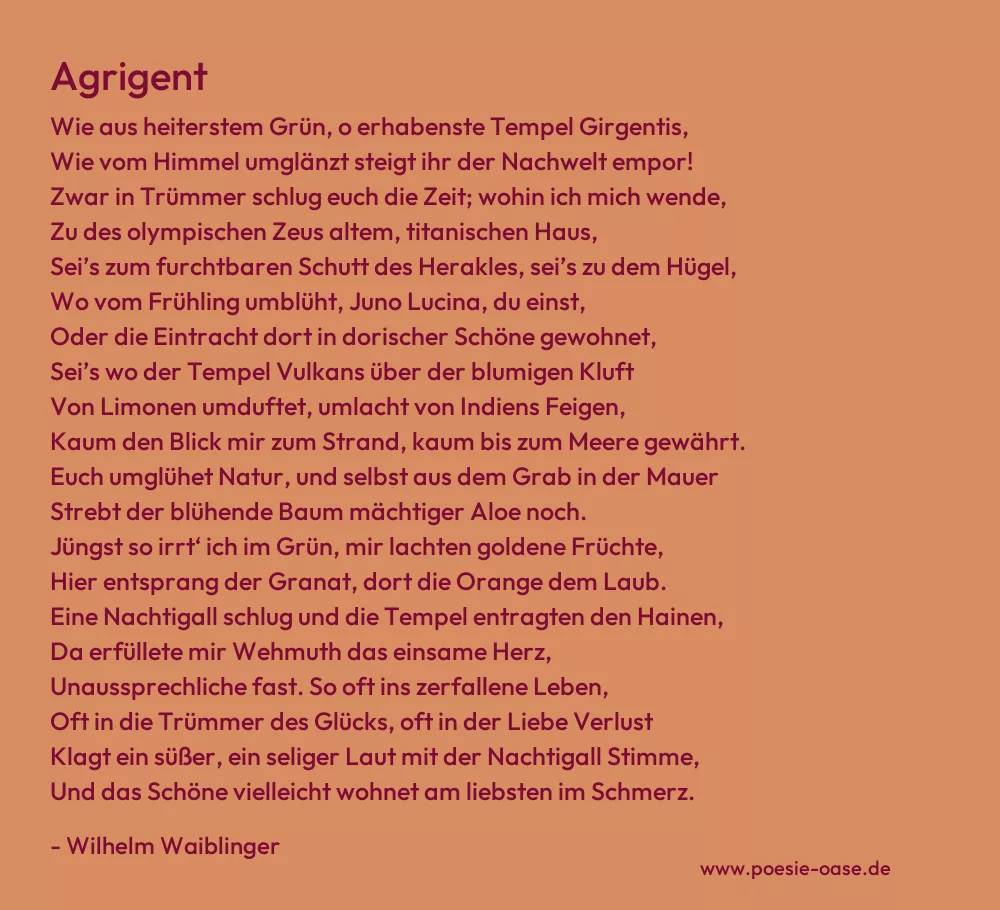Alltag, Emotionen & Gefühle, Frieden, Frühling, Gegenwart, Gemeinfrei, Götter, Helden & Prinzessinnen, Herbst, Jahreszeiten, Natur, Sommer, Weisheiten, Zerstörung
Agrigent
Wie aus heiterstem Grün, o erhabenste Tempel Girgentis,
Wie vom Himmel umglänzt steigt ihr der Nachwelt empor!
Zwar in Trümmer schlug euch die Zeit; wohin ich mich wende,
Zu des olympischen Zeus altem, titanischen Haus,
Sei’s zum furchtbaren Schutt des Herakles, sei’s zu dem Hügel,
Wo vom Frühling umblüht, Juno Lucina, du einst,
Oder die Eintracht dort in dorischer Schöne gewohnet,
Sei’s wo der Tempel Vulkans über der blumigen Kluft
Von Limonen umduftet, umlacht von Indiens Feigen,
Kaum den Blick mir zum Strand, kaum bis zum Meere gewährt.
Euch umglühet Natur, und selbst aus dem Grab in der Mauer
Strebt der blühende Baum mächtiger Aloe noch.
Jüngst so irrt‘ ich im Grün, mir lachten goldene Früchte,
Hier entsprang der Granat, dort die Orange dem Laub.
Eine Nachtigall schlug und die Tempel entragten den Hainen,
Da erfüllete mir Wehmuth das einsame Herz,
Unaussprechliche fast. So oft ins zerfallene Leben,
Oft in die Trümmer des Glücks, oft in der Liebe Verlust
Klagt ein süßer, ein seliger Laut mit der Nachtigall Stimme,
Und das Schöne vielleicht wohnet am liebsten im Schmerz.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
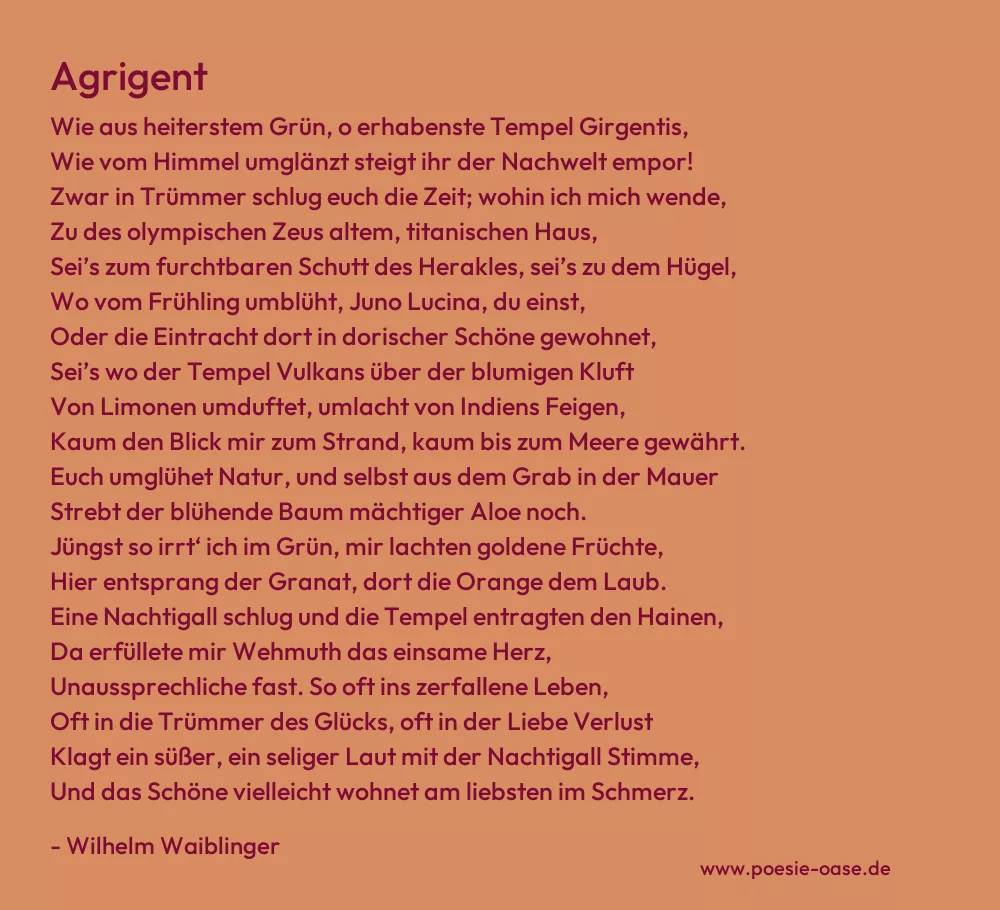
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Agrigent“ von Wilhelm Waiblinger reflektiert über die ruinenhafte Schönheit der antiken Tempel und die Verbindung von Natur, Vergänglichkeit und Erinnerung. Es beginnt mit einer hymnischen Verehrung der „erhabensten Tempel Girgentis“ (Agrigent), die trotz ihrer Zerstörung durch die Zeit immer noch als monumentale Zeugen der Vergangenheit in der Landschaft stehen. Die Tempel, die einst dem göttlichen und überzeitlichen Glauben dienten, erscheinen jetzt in Trümmern, jedoch immer noch „vom Himmel umglänzt“, was die unvergängliche Schönheit und Erhabenheit dieser Ruinen betont. Diese Ruinen sind nicht nur ein Relikt der Vergangenheit, sondern ein bleibendes Symbol für das kulturelle Erbe und die geistige Größe einer untergegangenen Welt.
Waiblinger zieht mehrere historische und mythologische Bezüge zu den Stätten, die er beschreibt – von „des olympischen Zeus altem, titanischen Haus“ bis zu den Tempeln des Herakles und der Juno Lucina. Diese Verweise auf die griechische Mythologie und die Verknüpfung mit berühmten antiken Tempeln unterstreichen die Tragödie und das Drama der Vergänglichkeit. Die einst prächtigen Tempel sind jetzt von der Zeit zerschlagen, doch sie bleiben Teil des Gedächtnisses der Menschheit, eingehüllt von der Natur. Die Natur, die in diesem Gedicht als eine lebendige Kraft dargestellt wird, „umglüht“ diese Ruinen und erinnert an die unaufhörliche Zirkulation von Leben und Tod.
Die Natur erscheint in Waiblingers Gedicht als eine mächtige und gleichzeitig sanfte Kraft. Der „blühende Baum“ der Aloe, der „noch aus dem Grab in der Mauer strebt“, symbolisiert die unaufhörliche Erneuerung und das Leben, das selbst in den Ruinen weiterlebt. Diese Natur, die die Ruinen durchdringt, ist ein bedeutendes Bild für die Beständigkeit des Lebens und des Wachstums, auch wenn die menschliche Schöpfung von Natur aus vergänglich ist. Der Dichter beschreibt die üppige Vegetation, die die Ruinen der antiken Tempel umhüllt – Granatäpfel und Orangen, die aus dem Laub sprießen, und die Nachtigall, deren Gesang in den Ruinen widerhallt. Diese Szenen der natürlichen Schönheit kontrastieren mit der melancholischen Erinnerung an die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens.
In der letzten Strophe drückt das lyrische Ich eine tiefe Wehmut und eine existenzielle Erkenntnis aus. Der Gesang der Nachtigall, der in den Trümmern der Tempel erklingt, wird zu einem Symbol für den Verlust und die Trauer, die mit der Vergänglichkeit des Glücks und der Liebe einhergehen. Der „süße, selige Laut“ der Nachtigall deutet darauf hin, dass in der Erinnerung und im Schmerz eine gewisse Schönheit und ein tiefes Verständnis des Lebens zu finden sind. Die Verbindung von Schönheit und Schmerz im Gedicht legt nahe, dass das Schöne und das Wahre oft in den Ruinen des Vergangenen, in der Trauer und im Verlust wohnen – als Teil des Zyklus von Leben und Tod, von Entstehen und Vergehen. Waiblinger zeigt, dass die wahren Werte und das Schöne in der Vergänglichkeit und der Erinnerung verankert sind und dass Schmerz und Schönheit oft untrennbar miteinander verbunden sind.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.