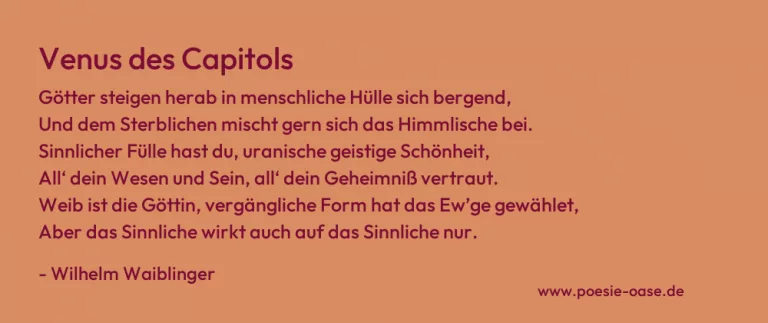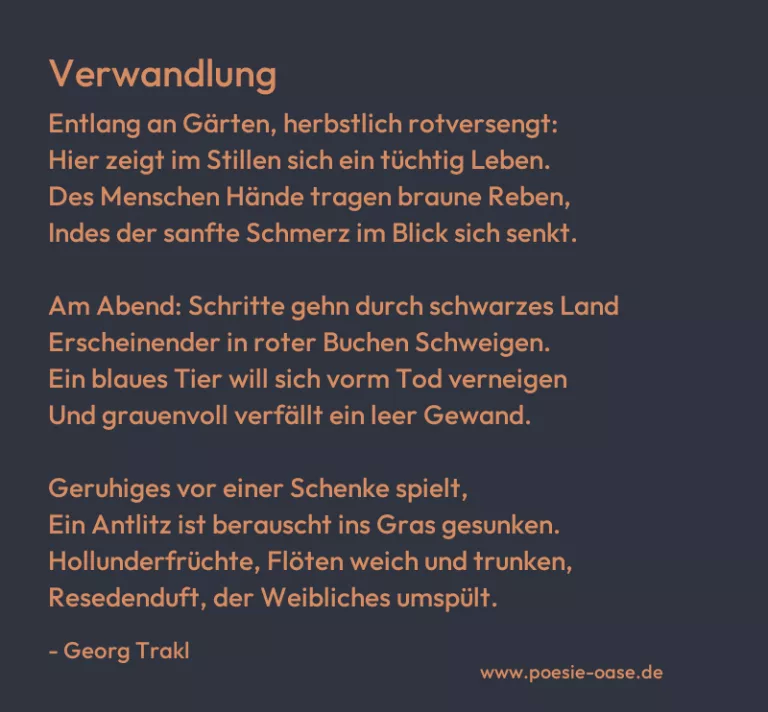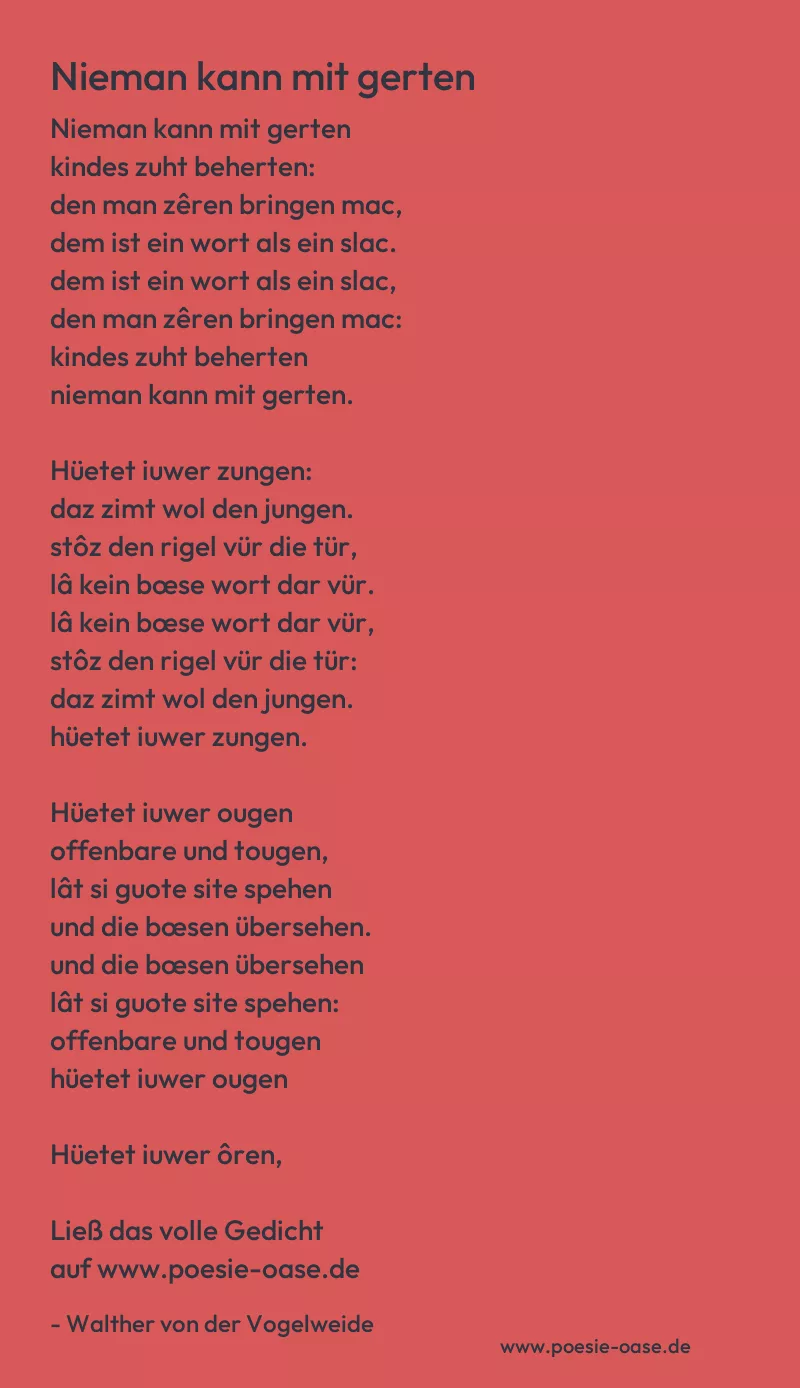Nieman kann mit gerten
Nieman kann mit gerten
kindes zuht beherten:
den man zêren bringen mac,
dem ist ein wort als ein slac.
dem ist ein wort als ein slac,
den man zêren bringen mac:
kindes zuht beherten
nieman kann mit gerten.
Hüetet iuwer zungen:
daz zimt wol den jungen.
stôz den rigel vür die tür,
lâ kein bœse wort dar vür.
lâ kein bœse wort dar vür,
stôz den rigel vür die tür:
daz zimt wol den jungen.
hüetet iuwer zungen.
Hüetet iuwer ougen
offenbare und tougen,
lât si guote site spehen
und die bœsen übersehen.
und die bœsen übersehen
lât si guote site spehen:
offenbare und tougen
hüetet iuwer ougen
Hüetet iuwer ôren,
oder ir sît tôren.
Lât ir bœsiu wort dar in,
daz gunêret iu den sin,
daz gunêret iu den sin,
lât ir bœsiu wort dar in.
oder ir sît tôren,
hüetet iuwer ôren,
Hüetet wol der drîer
leider alze vrîer.
zungen ougen ôren sint
dicke schalchaft, zêren blint.
dicke schalchaft, zêren blint
zungen ougen ôren sint
leider alze vrîer
hüetet wol der drîer.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
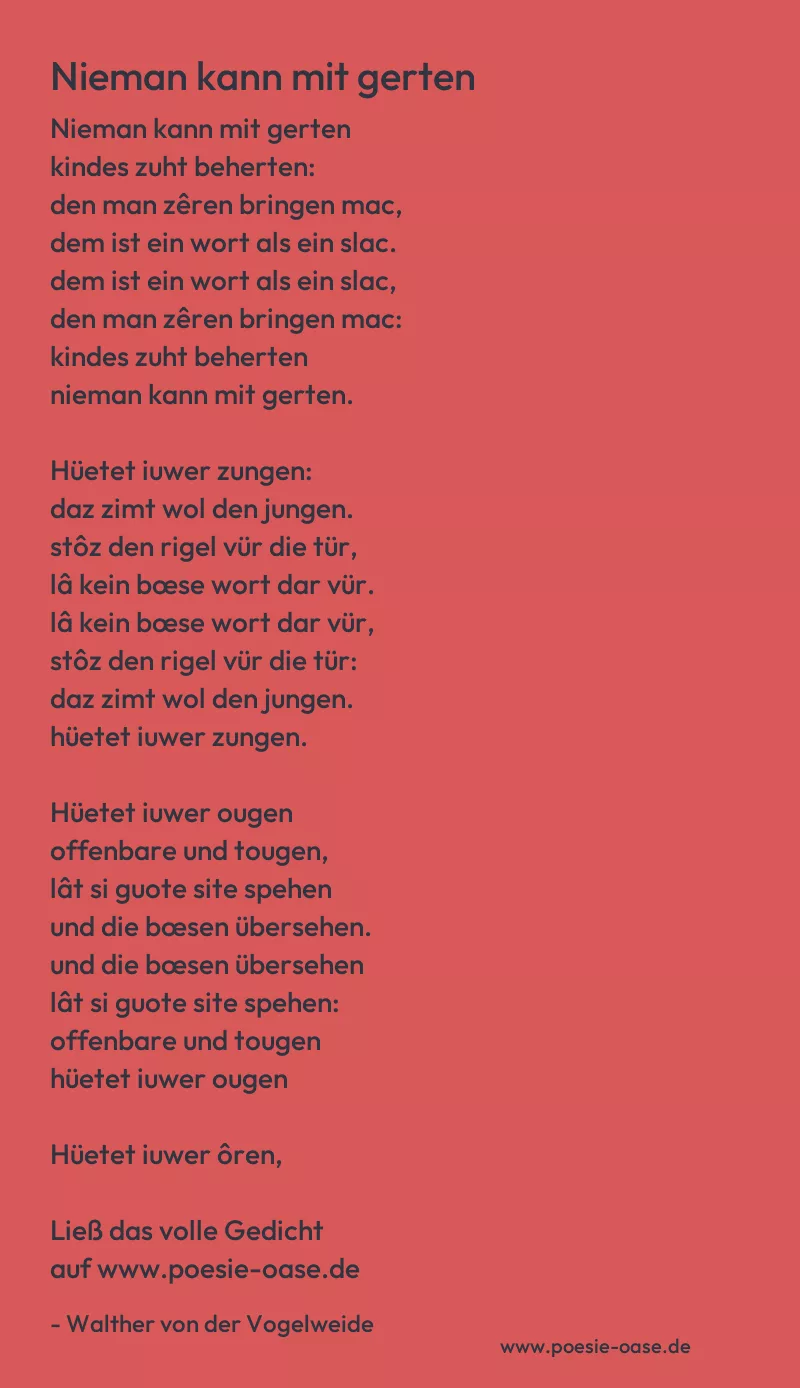
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Nieman kann mit gerten“ von Walther von der Vogelweide ist ein lehrhaftes, moralisierendes Lied, das auf eindringliche Weise zur Selbstzucht und Achtsamkeit im Verhalten aufruft. Es geht dabei weniger um höfische Liebe oder politische Themen, wie sie in vielen anderen Liedern Walthers dominieren, sondern um ethisch-erzieherische Grundsätze – vor allem für die Jugend. In seinen mahnenden Versen vermittelt das Gedicht eine klare Botschaft: Wahre Erziehung und Tugend entstehen nicht durch Gewalt, sondern durch das rechte Wort, das richtige Beispiel und die Kontrolle der Sinne.
Der erste Verskreis thematisiert Erziehung: „Nieman kann mit gerten / kindes zuht beherten“. Damit lehnt Walther körperliche Züchtigung ab – das „Kind“ kann man nicht durch Schläge („gerten“) zur Tugend führen. Viel wirksamer sei ein Wort, ein gutes Beispiel, das wie ein Schlag wirken kann, wenn es richtig verstanden wird. Diese Wiederholung der Verse in umgekehrter Reihenfolge (Kreuzform) ist ein stilistisches Mittel, das der Mahnung zusätzliches Gewicht verleiht.
Die folgenden Strophen widmen sich einzeln der Zunge, den Augen und den Ohren – also den zentralen Sinnesorganen, durch die der Mensch mit der Welt in Kontakt tritt. Die „Zunge“ steht dabei für das gesprochene Wort: Man soll sich hüten, Böses zu sagen, sondern vielmehr Zurückhaltung üben. Die Metapher vom „Rigel vor der Tür“ betont die Notwendigkeit, das eigene Reden zu kontrollieren.
Ähnlich wird der Umgang mit den Augen und Ohren behandelt. Die Augen sollen gute Sitten beobachten, aber das Schlechte übersehen – eine klare Mahnung zur selektiven Wahrnehmung und moralischen Orientierung. Die Ohren wiederum sollen nicht alles hören, insbesondere keine schlechten oder verderblichen Worte, denn diese können den Verstand verderben („daz gunêret iu den sin“). Wer unkritisch alles aufnimmt, so Walther, ist ein Narr.
Die letzte Strophe fasst diese drei Sinne zusammen: „zungen ougen ôren sint / dicke schalchaft, zêren blint“. Sie sind oft schnell dabei („schalchaft“), aber wenig urteilsfähig („blint“). Deshalb sollen die Menschen besonders auf sie achten, denn sie sind „leider alze vrîer“ – zu ungebunden, zu leichtfertig im Umgang. Diese Mahnung zur inneren Disziplin und Achtsamkeit hat auch heute noch erstaunliche Aktualität und macht das Gedicht zu einem zeitlosen Text ethischer Reflexion.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.