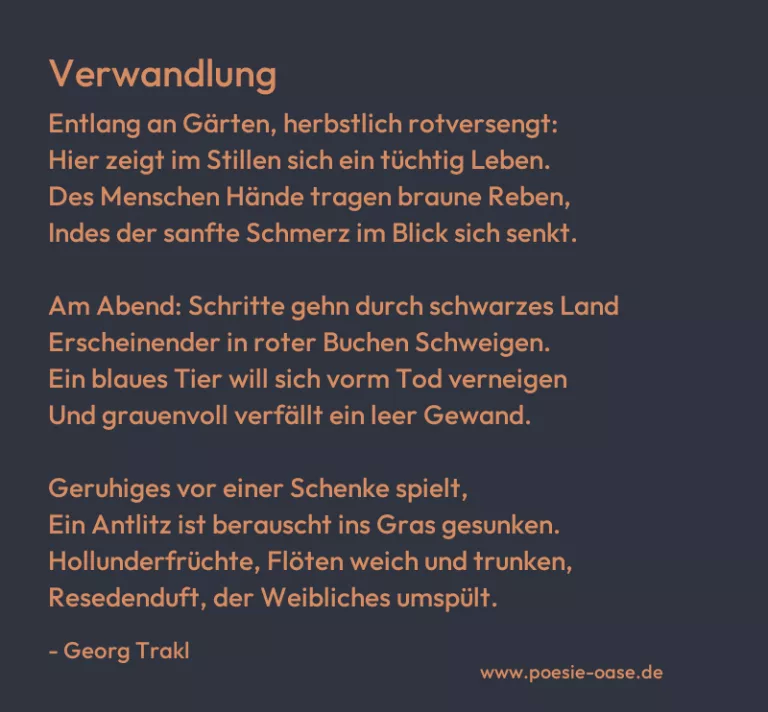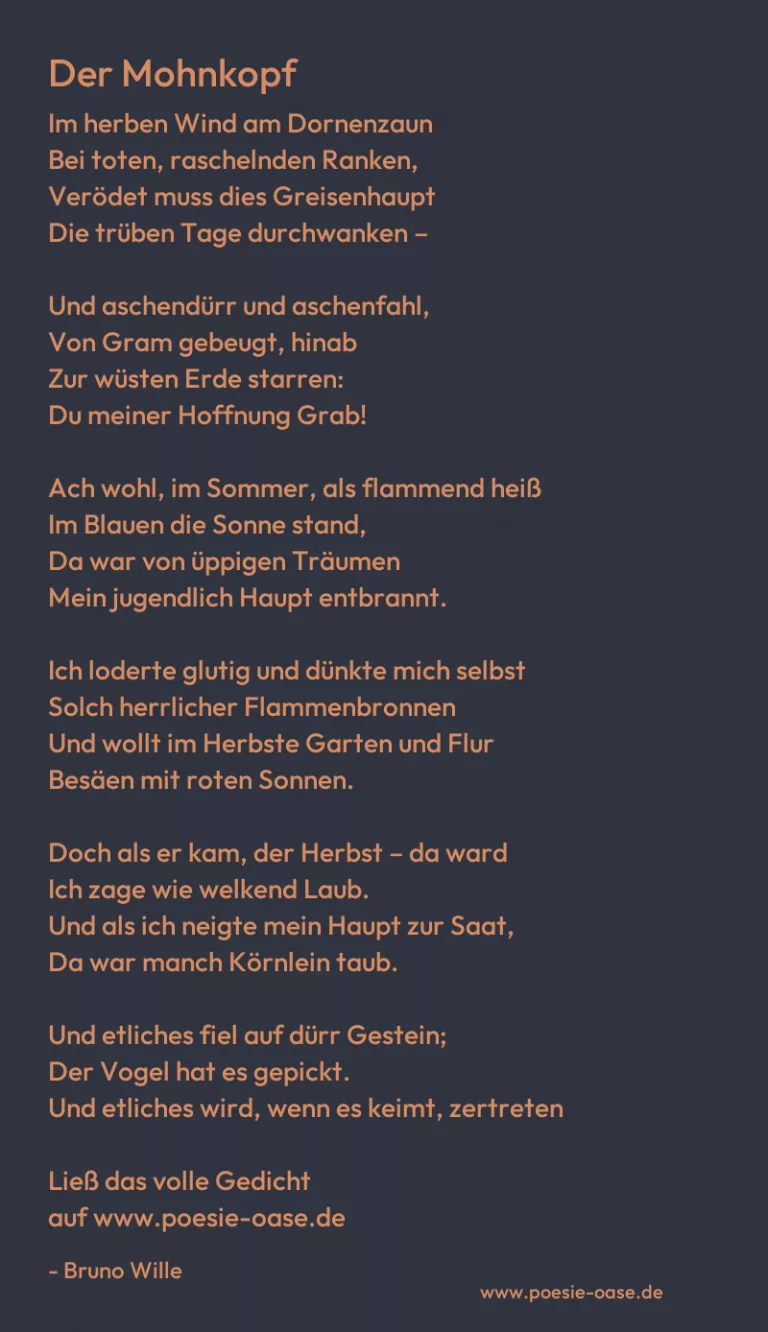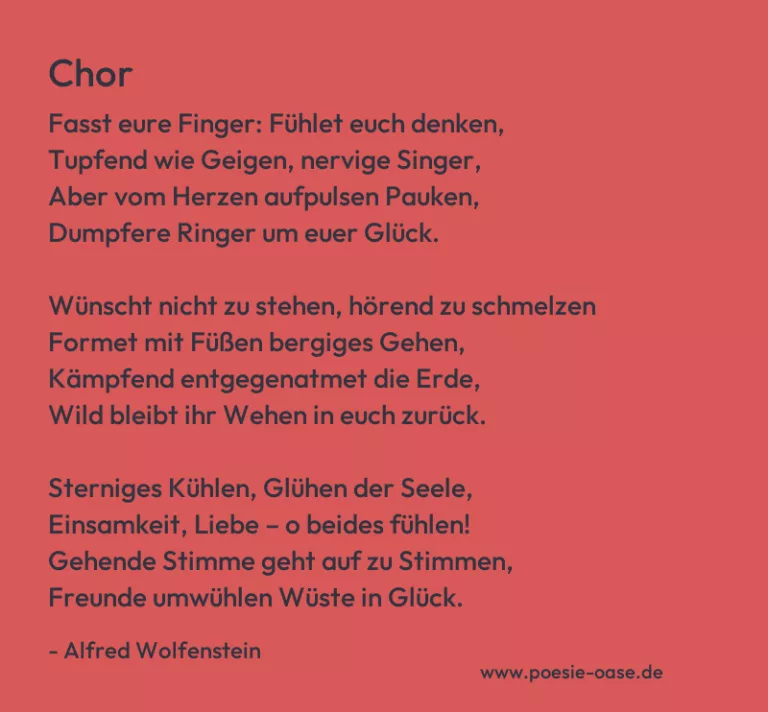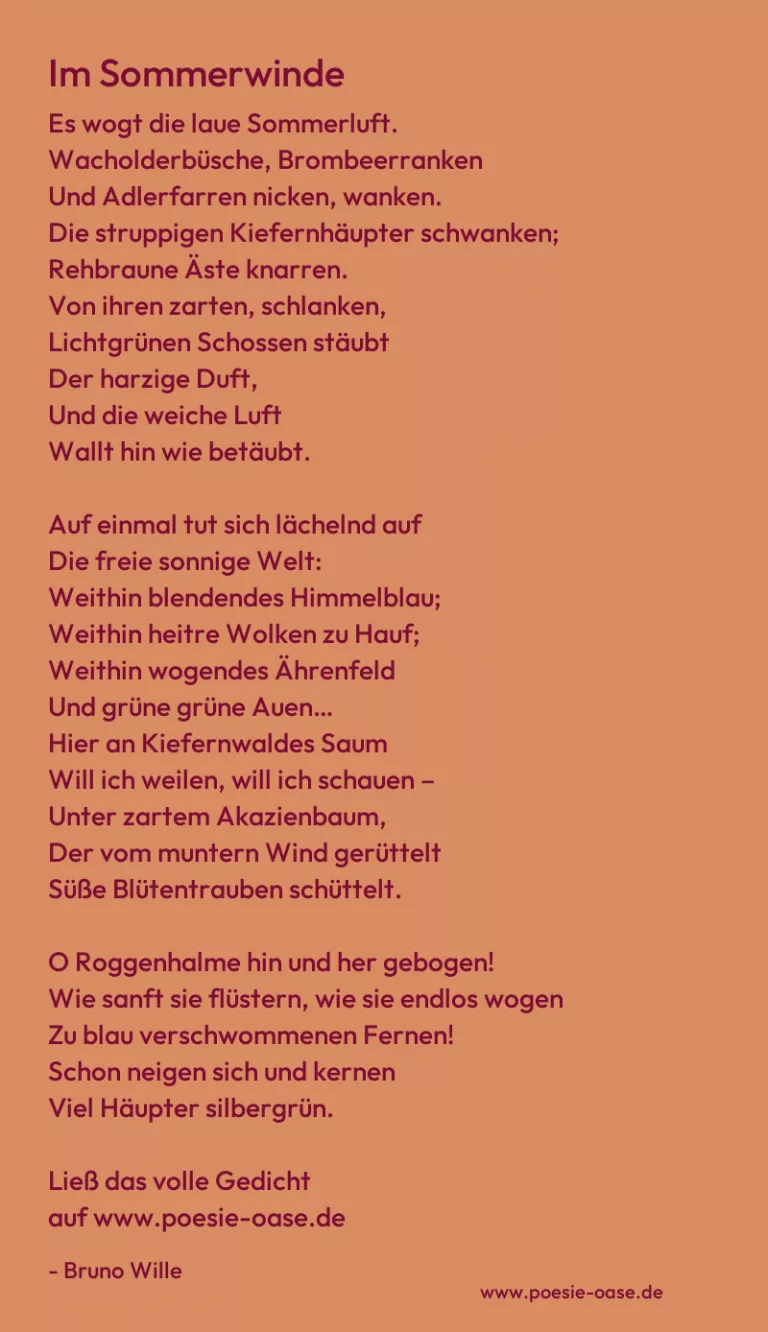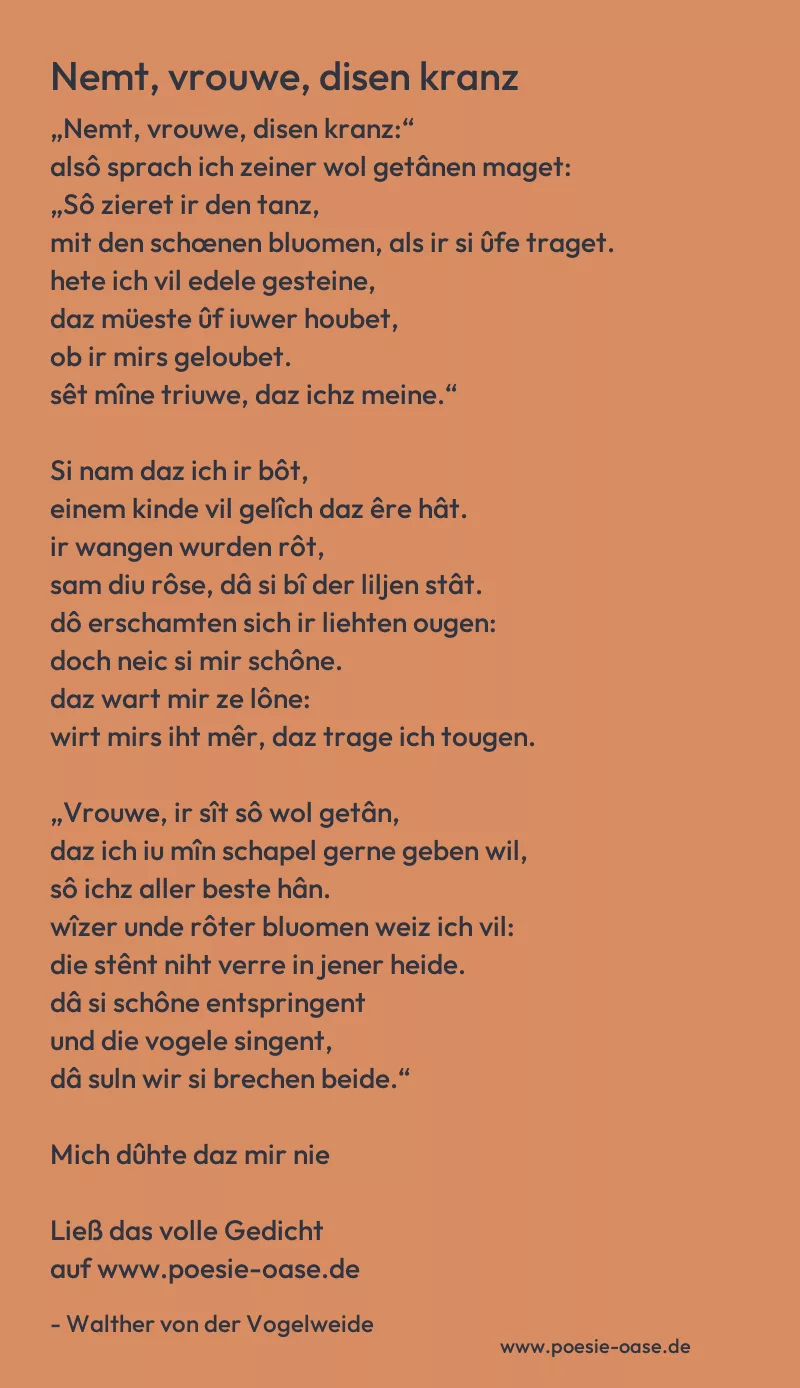Nemt, vrouwe, disen kranz
„Nemt, vrouwe, disen kranz:“
alsô sprach ich zeiner wol getânen maget:
„Sô zieret ir den tanz,
mit den schœnen bluomen, als ir si ûfe traget.
hete ich vil edele gesteine,
daz müeste ûf iuwer houbet,
ob ir mirs geloubet.
sêt mîne triuwe, daz ichz meine.“
Si nam daz ich ir bôt,
einem kinde vil gelîch daz êre hât.
ir wangen wurden rôt,
sam diu rôse, dâ si bî der liljen stât.
dô erschamten sich ir liehten ougen:
doch neic si mir schône.
daz wart mir ze lône:
wirt mirs iht mêr, daz trage ich tougen.
„Vrouwe, ir sît sô wol getân,
daz ich iu mîn schapel gerne geben wil,
sô ichz aller beste hân.
wîzer unde rôter bluomen weiz ich vil:
die stênt niht verre in jener heide.
dâ si schône entspringent
und die vogele singent,
dâ suln wir si brechen beide.“
Mich dûhte daz mir nie
lieber wurde, danne mir ze muote was.
die bluomenvielen ie
vondem boumebî uns nider an daz gras.
seht, dô muoste ich von vreuden lachen.
dô ich sô wünnecliche
was in troume rîche,
dô tagete ez und muose ich wachen.
Mir ist von ir geschehen,
daz ich disen sumer allen meiden muoz
vaste under dougen sehen:
lîhte wirt mir einiu: sôst mir sorgen buoz.
Waz ob si gêt an disem tanze?
vrouwe, durch iuwer güete
rucket ûf die hüete.
ouwê gesæhe ich si under kranze!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
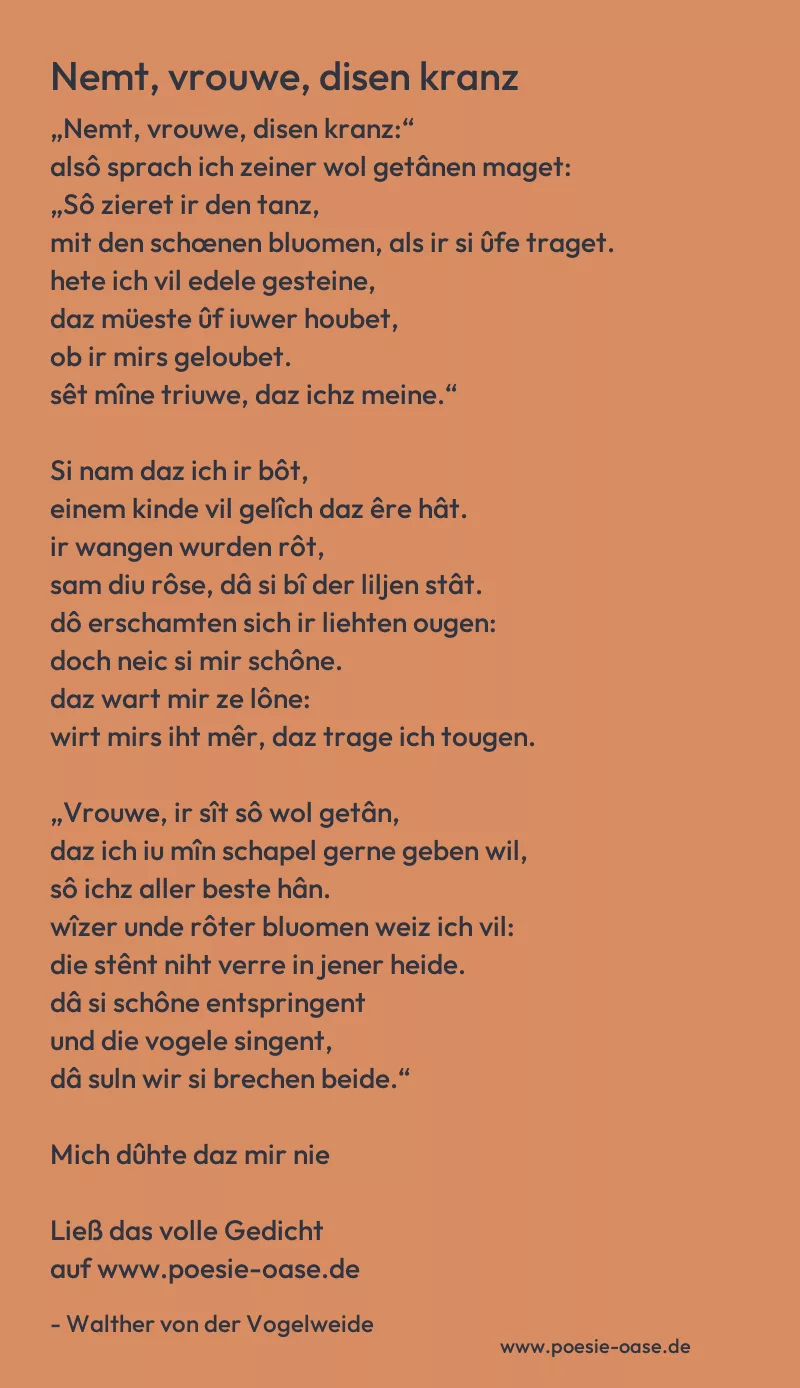
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Nemt, vrouwe, disen kranz“ von Walther von der Vogelweide ist ein fein nuanciertes Beispiel für die mittelhochdeutsche Minnepoesie, das mit zarten Naturbildern, höfischer Geste und subtiler Emotionalität spielt. Im Zentrum steht die Übergabe eines Kranzes – Symbol der Verehrung und Schönheit – an eine edle Frau, die in ihrer Reaktion sowohl höfische Zurückhaltung als auch leise Gegenliebe zeigt. Walther verbindet in diesem Gedicht Motive der traditionellen Hohen Minne mit Elementen der Erlebnislyrik und einem Hauch von Selbstironie.
Der Sprecher überreicht der Dame einen Kranz aus Blumen, da er ihr aus Treue und Bewunderung ein Geschenk machen will. Die höfische Redeweise („sêt mîne triuwe, daz ichz meine“) unterstreicht seine Aufrichtigkeit, während der symbolhafte Akt des Kranzgebens die Übergabe von Lob und Ehre bedeutet. Hätte er Edelsteine, so würde er ihr diese geben – doch stattdessen schenkt er ihr das, was er hat: natürliche Schönheit. In diesem Verzicht auf materiellen Wert und die Hinwendung zur Natur klingt eine Gegenposition zur materiell geprägten höfischen Welt an.
Die Reaktion der Frau wird mit hoher Sensibilität beschrieben: Sie nimmt den Kranz schüchtern entgegen, ihre Wangen erröten „sam diu rôse, dâ si bî der liljen stât“ – ein klassisches, anmutiges Bild, das die Schönheit der Frau in floraler Metaphorik spiegelt. Ihr gesenktes Auge, das dennoch Zuneigung verrät, wirkt wie ein stilles Zeichen des Einverständnisses. Die Szene bleibt in Andeutung, aber gerade das macht ihren Reiz aus: Die Zurückhaltung wird zur Form der höfischen Annäherung.
In der dritten Strophe steigert sich das poetische Spiel: Der Sprecher lädt die Dame ein, gemeinsam Blumen zu pflücken – ein Bild für ein mögliches näheres Miteinander. Die Verknüpfung von Natur, Liebe und Frühling ist typisch für die Minnepoesie, doch Walther bleibt konkret und sinnlich: Blühende Heide, singende Vögel, das gemeinsame Brechen der Blumen – hier wird die Utopie einer harmonischen Verbindung greifbar.
Die vierte Strophe offenbart die Wende: Was wie ein schönes Erlebnis erscheint, entpuppt sich als Traum. Das Erwachen bringt Ernüchterung, und mit ihm kehrt die Realität der Zurückhaltung zurück. Die letzte Strophe bleibt offen in ihrer Hoffnung: Vielleicht erscheint sie ja wieder, vielleicht tanzt sie unter den Kränzen – vielleicht wird aus dem Traum ein echtes Erlebnis. Die Spannung zwischen Wunsch und Wirklichkeit, zwischen höfischem Ideal und persönlichem Gefühl, bleibt bestehen.
Walthers Gedicht ist ein meisterhaft komponiertes Spiel zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Natur und höfischer Konvention. Der Kranz als Symbol der Liebe und des Lobs durchzieht das Gedicht ebenso wie die leise Sehnsucht nach Erfüllung. Dabei bleibt der Ton zart, die Empfindung kontrolliert, doch gerade darin liegt die Tiefe und Schönheit dieser Minneklage.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.