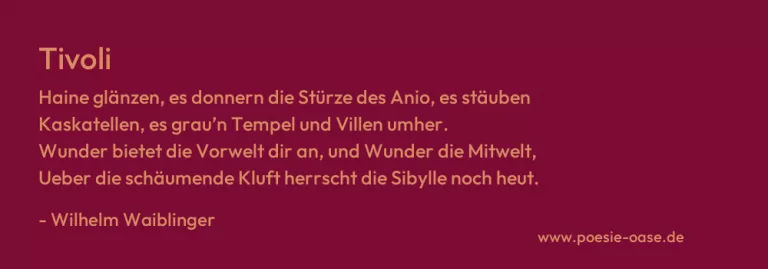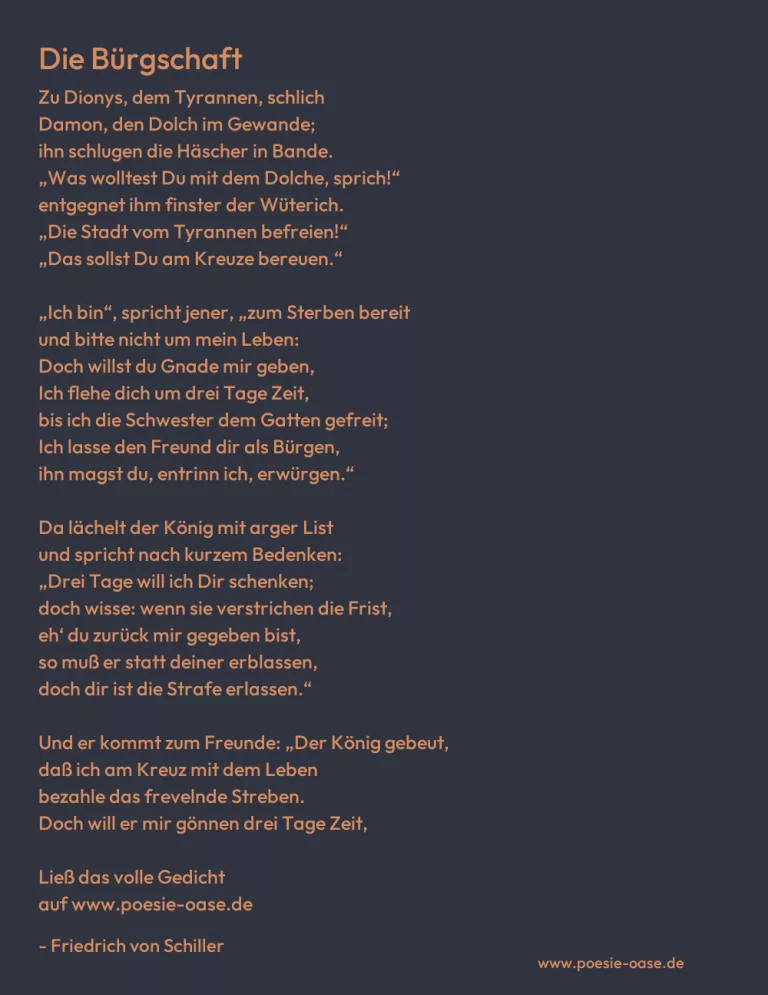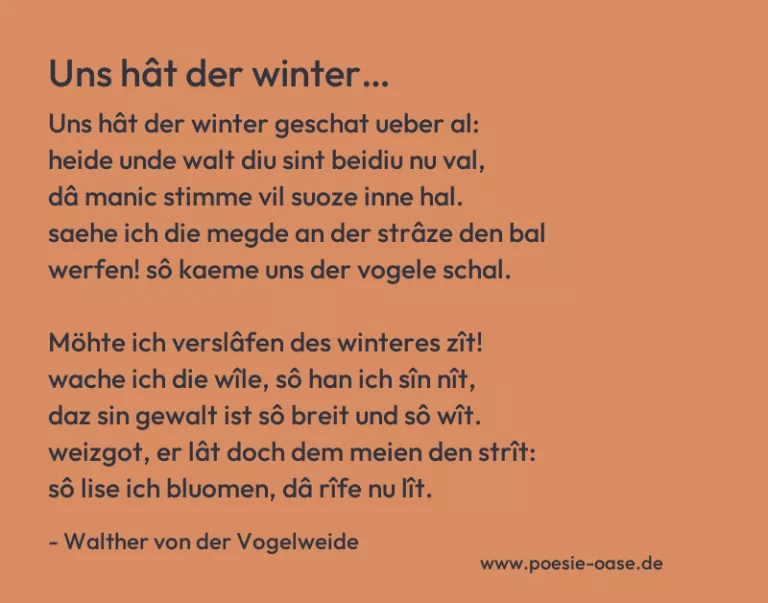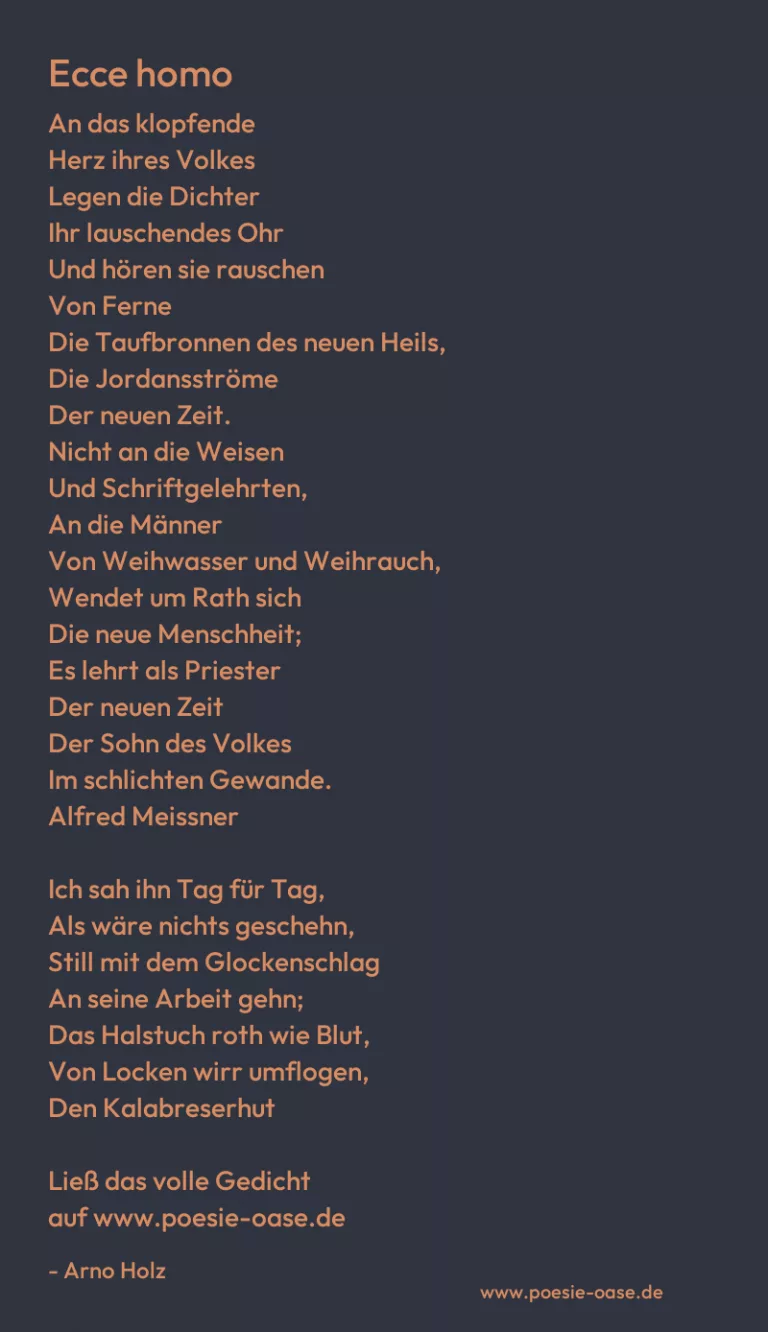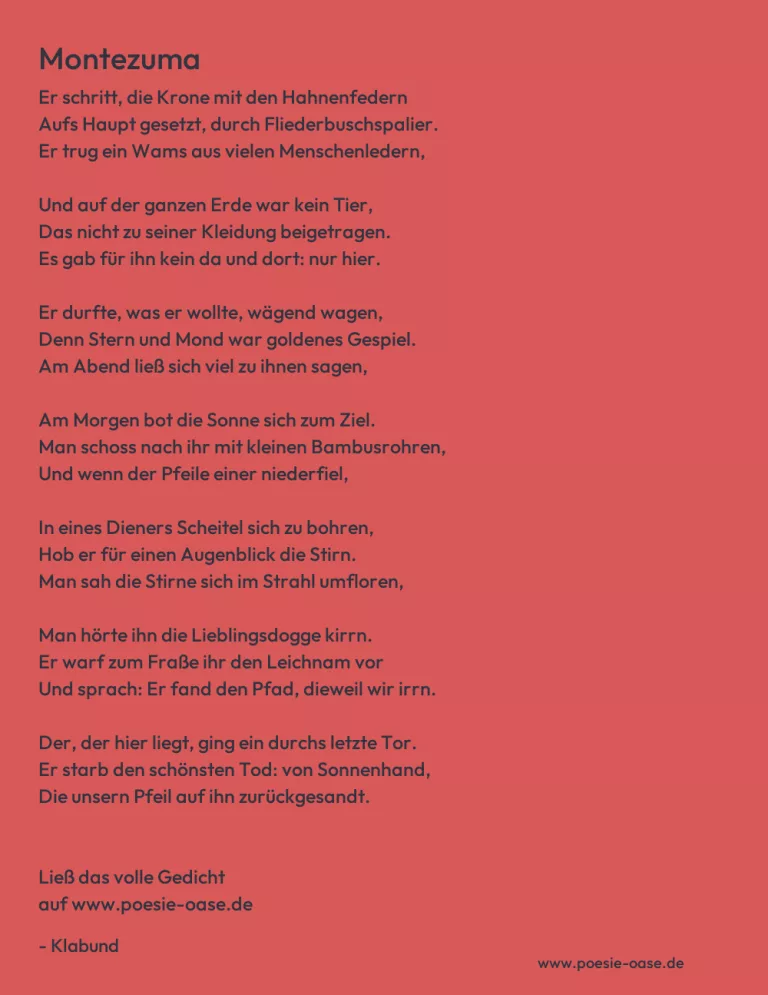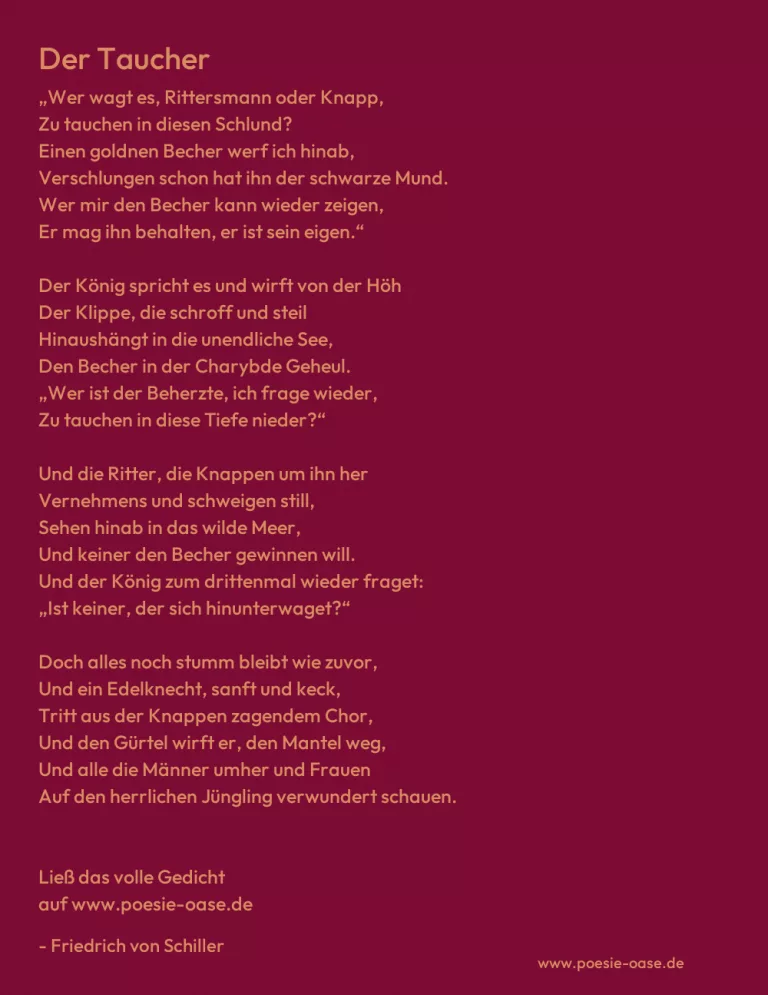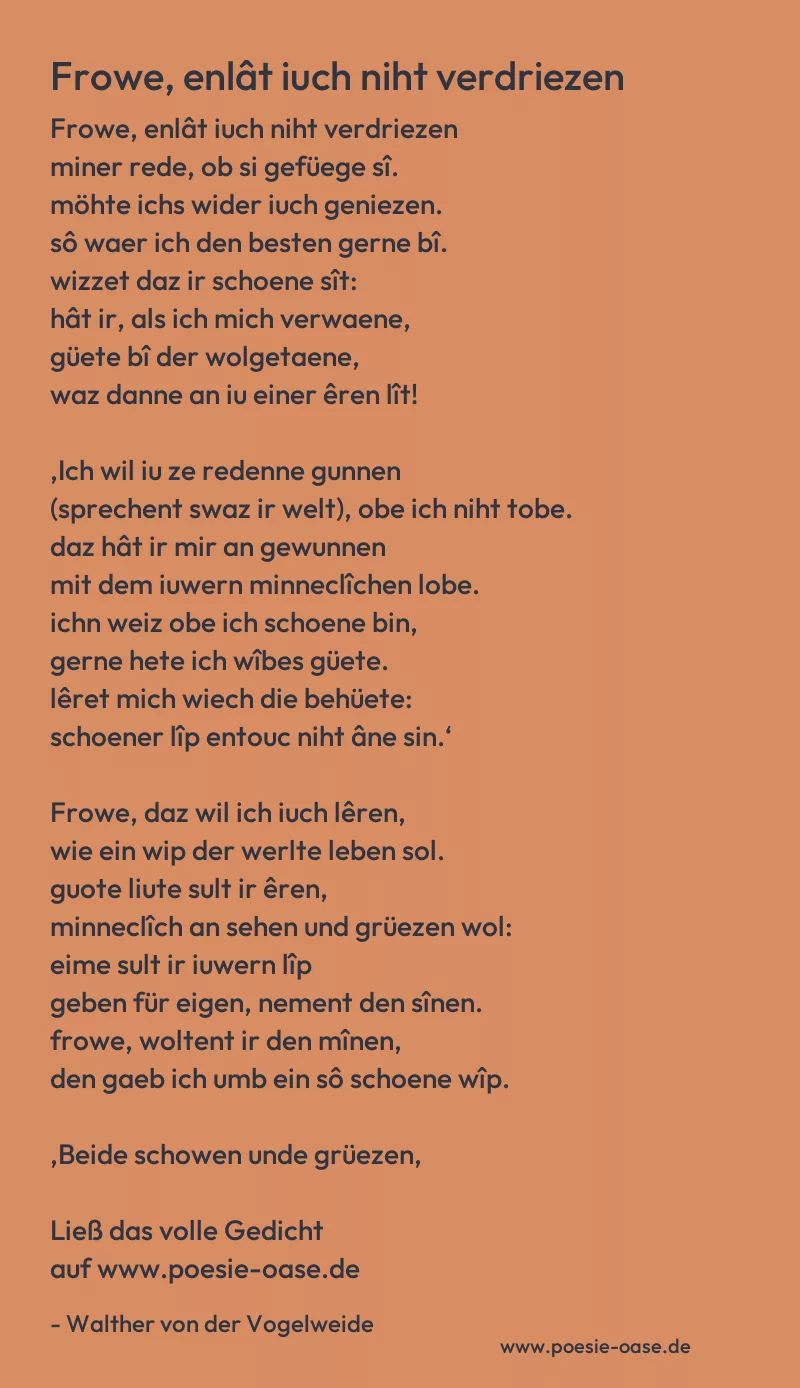Frowe, enlât iuch niht verdriezen
Frowe, enlât iuch niht verdriezen
miner rede, ob si gefüege sî.
möhte ichs wider iuch geniezen.
sô waer ich den besten gerne bî.
wizzet daz ir schoene sît:
hât ir, als ich mich verwaene,
güete bî der wolgetaene,
waz danne an iu einer êren lît!
‚Ich wil iu ze redenne gunnen
(sprechent swaz ir welt), obe ich niht tobe.
daz hât ir mir an gewunnen
mit dem iuwern minneclîchen lobe.
ichn weiz obe ich schoene bin,
gerne hete ich wîbes güete.
lêret mich wiech die behüete:
schoener lîp entouc niht âne sin.‘
Frowe, daz wil ich iuch lêren,
wie ein wip der werlte leben sol.
guote liute sult ir êren,
minneclîch an sehen und grüezen wol:
eime sult ir iuwern lîp
geben für eigen, nement den sînen.
frowe, woltent ir den mînen,
den gaeb ich umb ein sô schoene wîp.
‚Beide schowen unde grüezen,
swaz ich mich dar an versûmet hân,
daz wil ich vil gerne büezen.
ir hânt hovelîch an mir getân:
tuont durch mînen willen mê,
sît niht wan mîn redegeselle.
in weiz nieman dem ich welle
nemen den lîp: ez taete im lihte wê.‘
Frowe, lânt michz alsô wâgen:
ich bin dicke komen ûz groezer nôt:
unde lânts iuch niht betrâgen:
stirbe ab ich, sô bin ich sanfte tôt.
‚hêrre, ich wil noch langer leben.
lîhte ist iu der lîp unmaere:
waz bedorfte ich solher swaere,
solt ich mînen lîp umb iuwern geben?‘
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
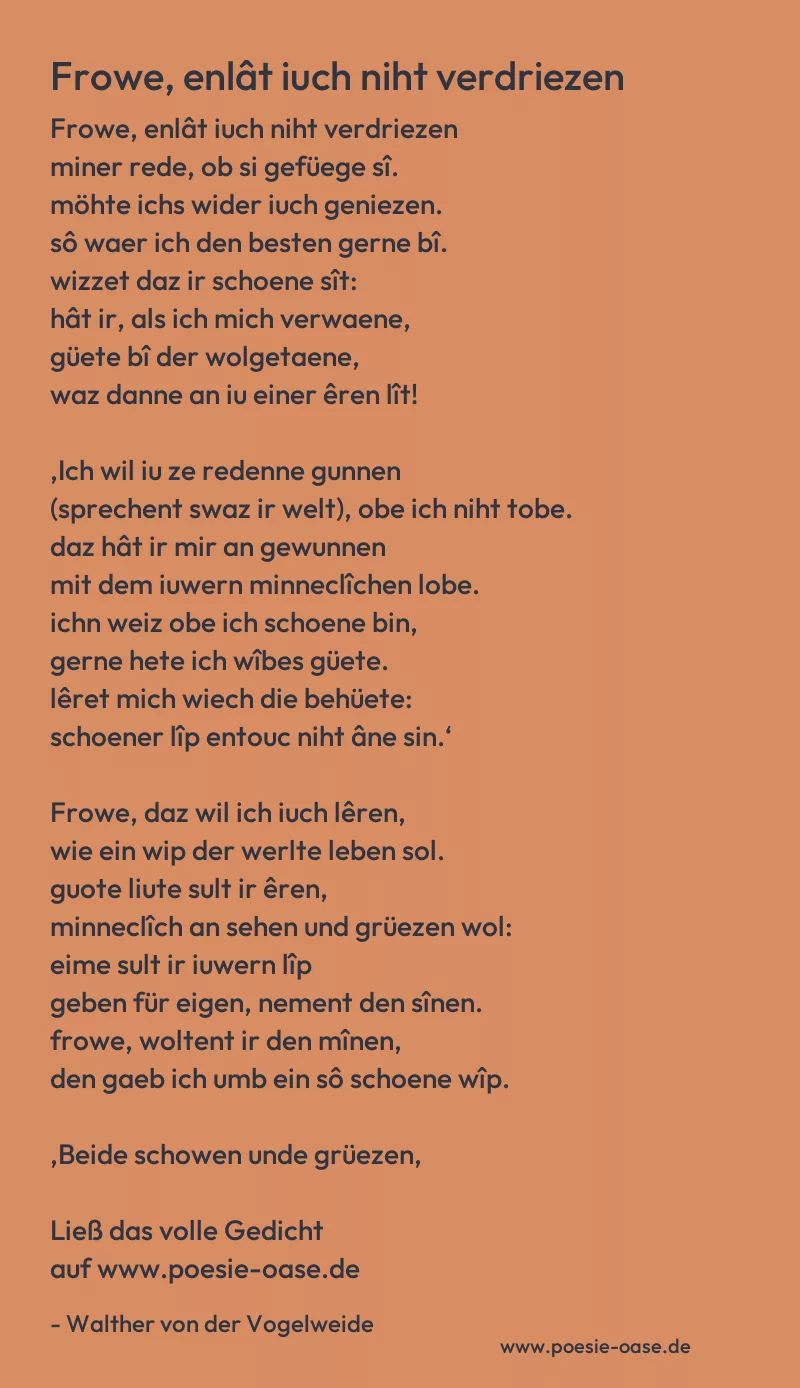
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Frowe, enlât iuch niht verdriezen“ von Walther von der Vogelweide gehört zur Tradition des mittelalterlichen Minnesangs, zeigt jedoch eine besondere Lebendigkeit durch den Wechsel von männlicher und weiblicher Stimme. In Form eines Dialogs zwischen einem Minnesänger und einer Frau wird die höfische Liebe nicht nur idealisiert, sondern auch kritisch hinterfragt. Der Sänger nähert sich der Frau mit dem Wunsch nach Erwiderung seiner Gefühle, die Frau hingegen begegnet ihm mit höfischer Zurückhaltung und kluger Skepsis.
Zunächst bittet der Sprecher die Frau, seine Rede nicht als ungebührlich zu empfinden. Er lobt ihre Schönheit und vermutet, dass sie auch Güte besitze – ein klassisches Minnesang-Motiv, das die äußere Schönheit mit inneren Tugenden verknüpft. Die höfische Form bewahrt er, doch schwingt in seinen Worten auch eine Hoffnung auf eine tiefere Verbindung mit. Die Antwort der Frau zeigt eine höfische Bildung: Sie gesteht, nicht zu wissen, ob sie schön sei, doch sie strebe Güte an und bittet darum, belehrt zu werden, wie sie sich sittsam verhalten solle – eine Mischung aus Demut und Selbstbestimmung.
Der Sänger gibt sich daraufhin als Lehrer höfischen Verhaltens: Eine Frau solle gute Menschen ehren, freundlich grüßen und sich einem Mann ganz hingeben, wenn sie sich denn für ihn entscheide. Dass er dabei subtil um ihre Zuneigung wirbt („woltent ir den mînen“), macht deutlich, dass hinter dem höfischen Ton ein persönliches Begehren steht. Die Frau bleibt standhaft: Zwar will sie Fehler aus der Vergangenheit wiedergutmachen und erkennt sein höfisches Verhalten an, doch erklärt sie, dass sie niemandem ihren Leib geben möchte, selbst wenn sie ihn noch so gern habe – zu groß wäre die Gefahr, verletzt zu werden.
Im letzten Austausch steigert sich der Sänger dramatisch: Er kommt aus „groezer nôt“, droht mit dem Tod aus Liebesleid, sollte sie ihn abweisen. Die Frau bleibt pragmatisch: Warum solle sie ihr Leben für ihn aufgeben, wenn sein Leiden vielleicht nur von kurzer Dauer sei? Diese Antwort entlarvt die übertriebene Rhetorik des Minnesängers und bricht mit der Vorstellung einer Frau, die sich aus bloßer Höflichkeit oder Mitleid hingibt.
Walther von der Vogelweide spielt in diesem Gedicht auf kluge Weise mit den Konventionen des Minnesangs. Die höfische Sprache dient nicht nur der Werbung, sondern wird auch zum Mittel kritischer Reflexion über Geschlechterrollen, emotionale Erpressung und die Autonomie der Frau. Das Gedicht offenbart dabei nicht nur die Schönheit höfischer Dichtung, sondern auch ihre inneren Spannungen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.