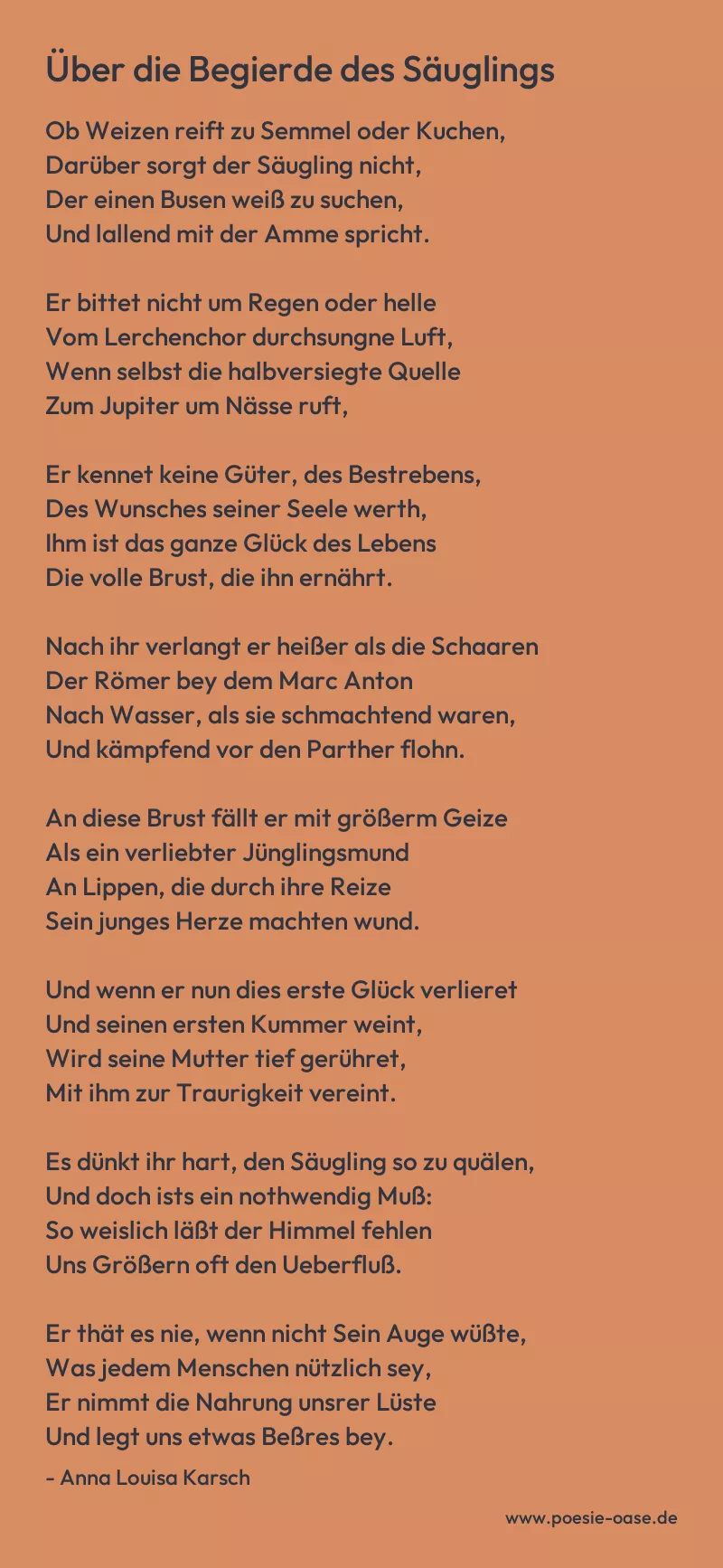Ob Weizen reift zu Semmel oder Kuchen,
Darüber sorgt der Säugling nicht,
Der einen Busen weiß zu suchen,
Und lallend mit der Amme spricht.
Er bittet nicht um Regen oder helle
Vom Lerchenchor durchsungne Luft,
Wenn selbst die halbversiegte Quelle
Zum Jupiter um Nässe ruft,
Er kennet keine Güter, des Bestrebens,
Des Wunsches seiner Seele werth,
Ihm ist das ganze Glück des Lebens
Die volle Brust, die ihn ernährt.
Nach ihr verlangt er heißer als die Schaaren
Der Römer bey dem Marc Anton
Nach Wasser, als sie schmachtend waren,
Und kämpfend vor den Parther flohn.
An diese Brust fällt er mit größerm Geize
Als ein verliebter Jünglingsmund
An Lippen, die durch ihre Reize
Sein junges Herze machten wund.
Und wenn er nun dies erste Glück verlieret
Und seinen ersten Kummer weint,
Wird seine Mutter tief gerühret,
Mit ihm zur Traurigkeit vereint.
Es dünkt ihr hart, den Säugling so zu quälen,
Und doch ists ein nothwendig Muß:
So weislich läßt der Himmel fehlen
Uns Größern oft den Ueberfluß.
Er thät es nie, wenn nicht Sein Auge wüßte,
Was jedem Menschen nützlich sey,
Er nimmt die Nahrung unsrer Lüste
Und legt uns etwas Beßres bey.