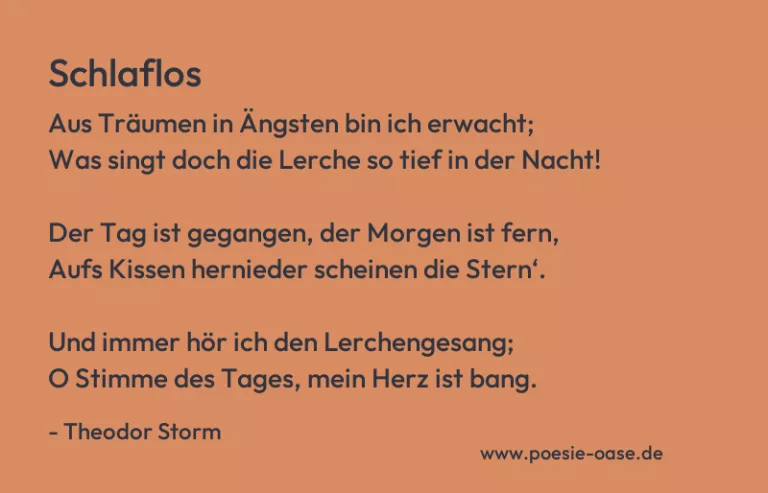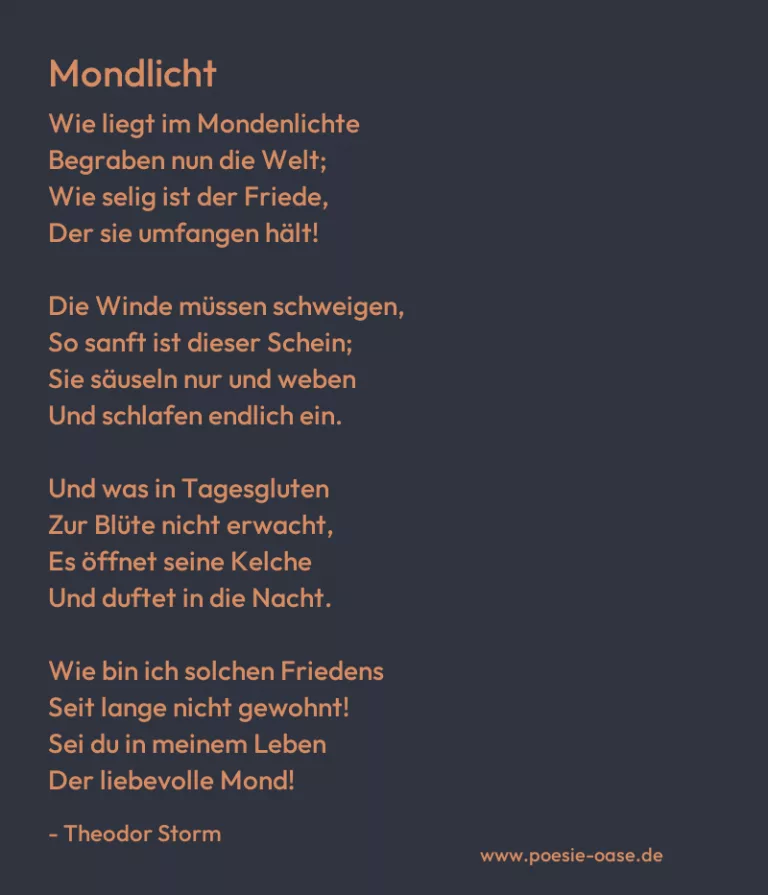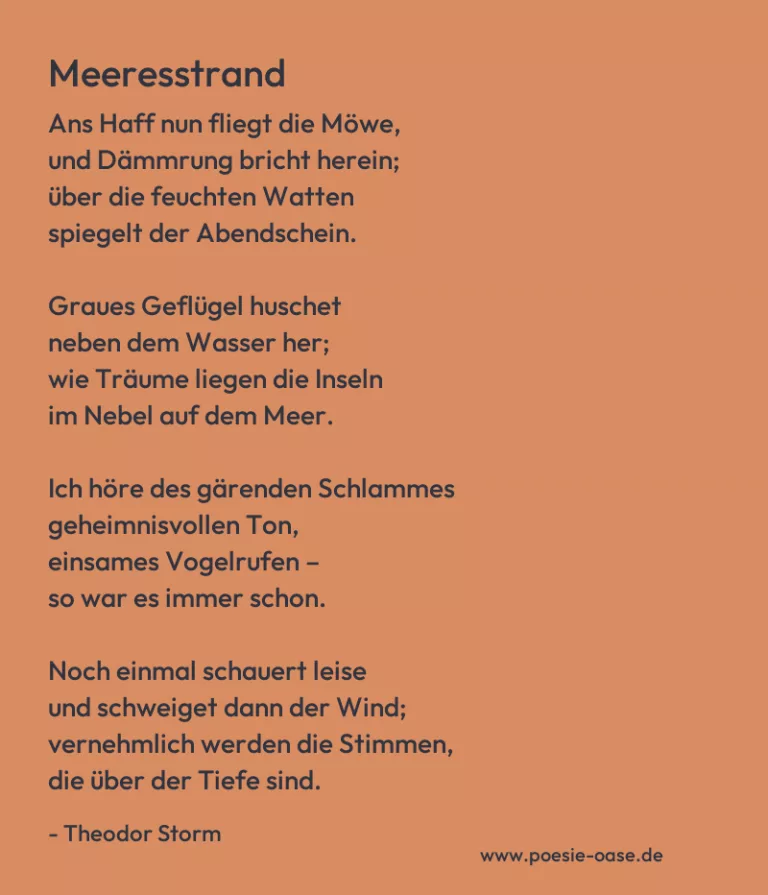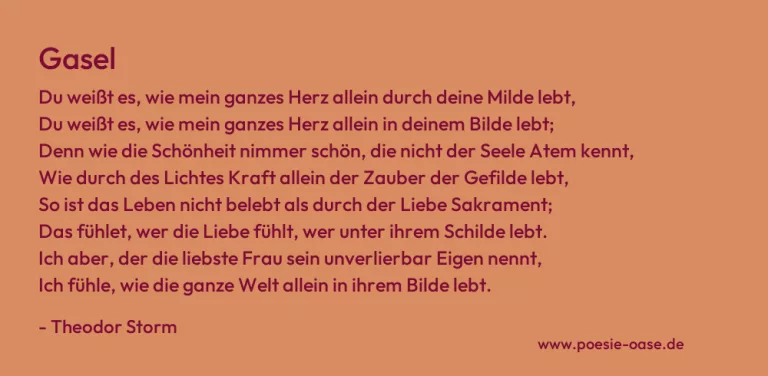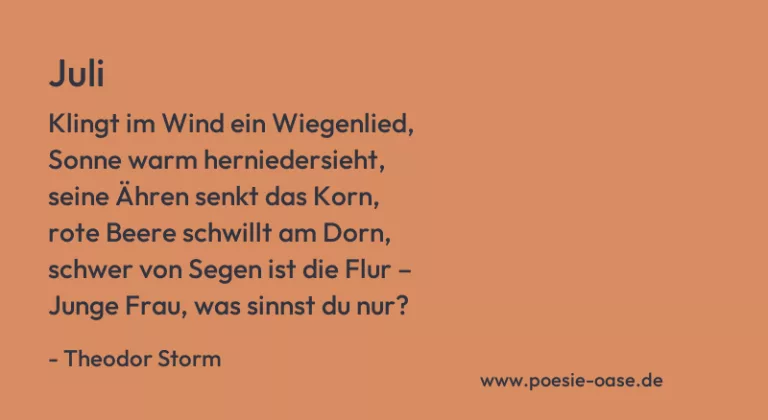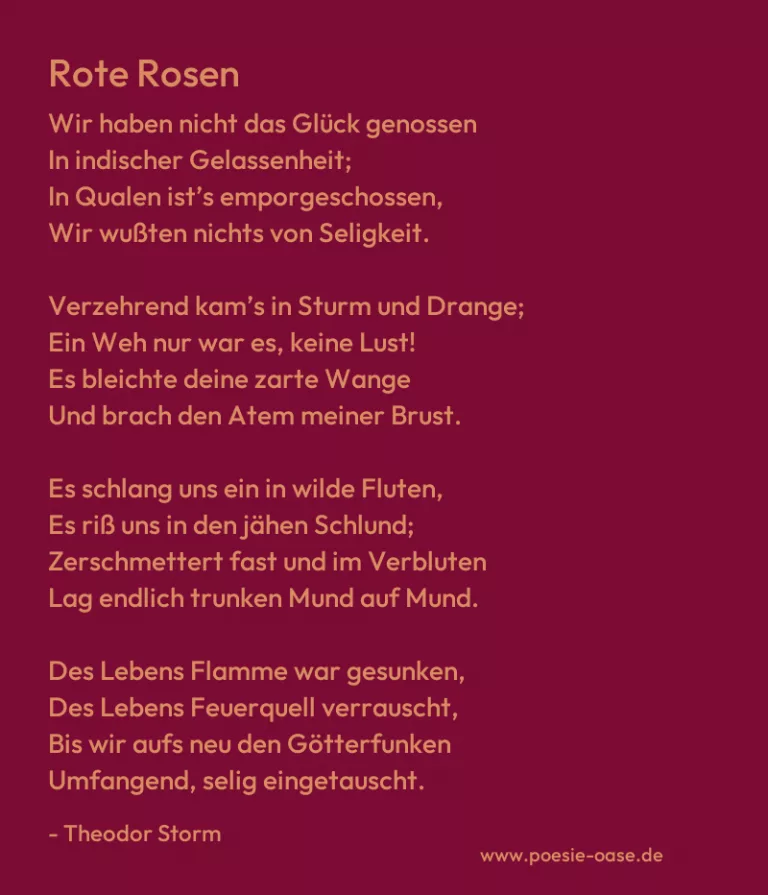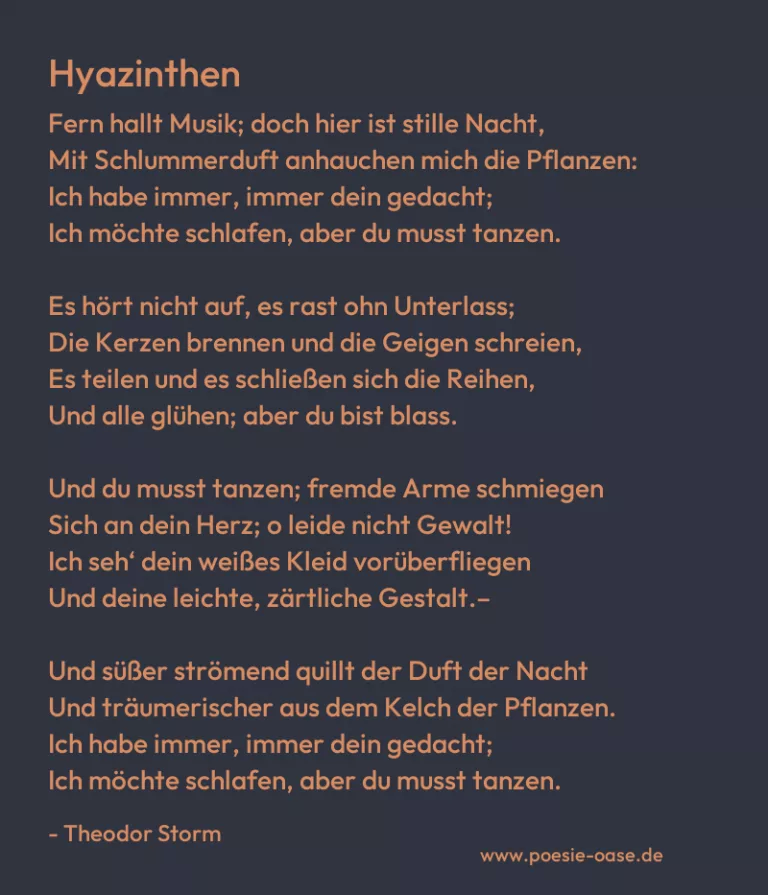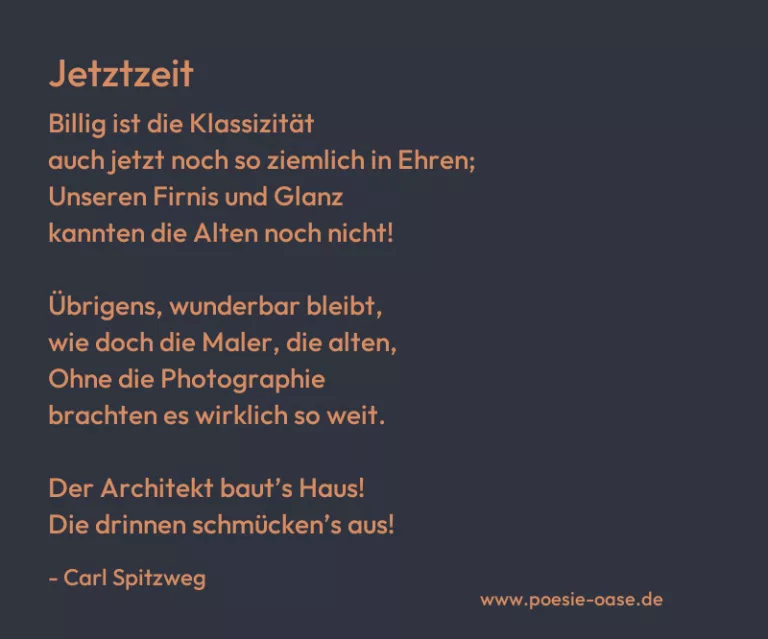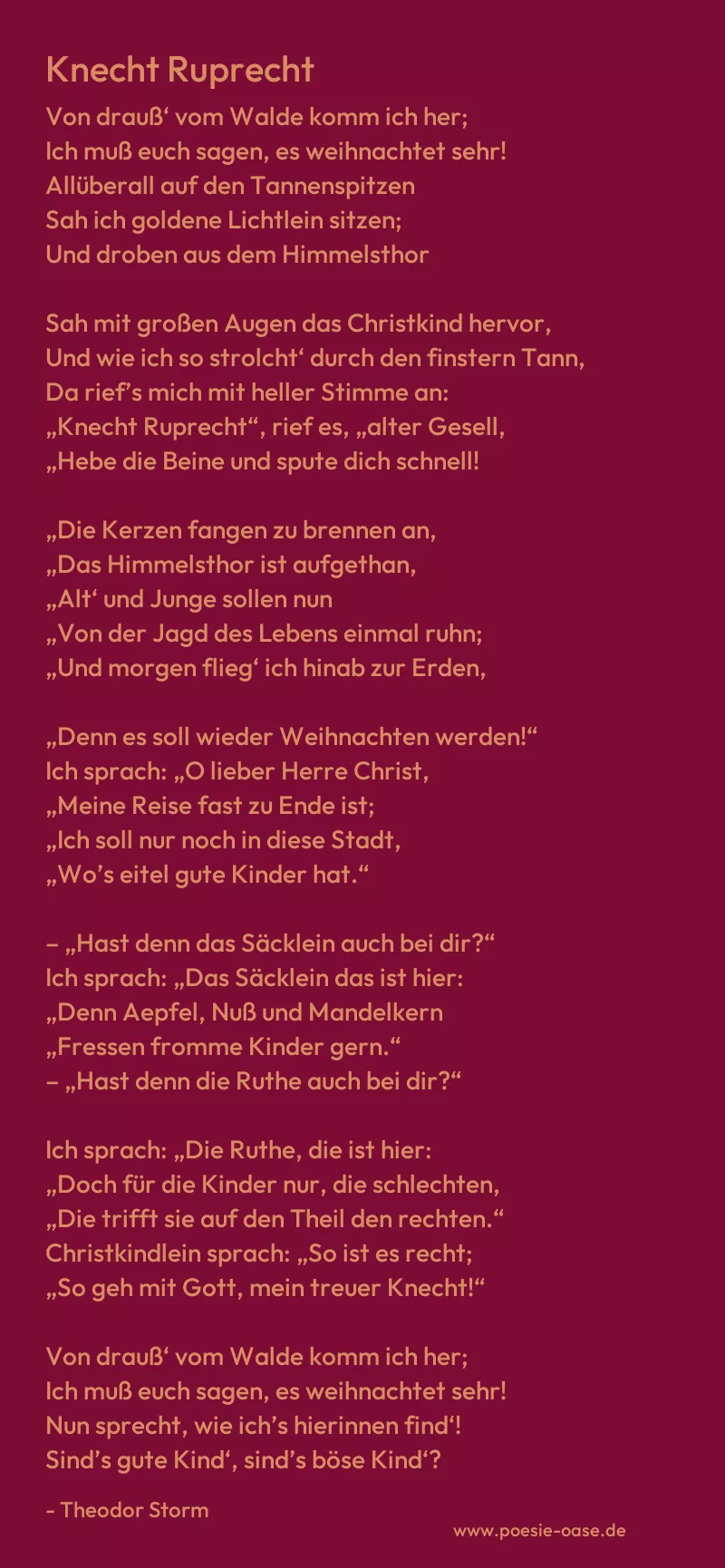Von drauß‘ vom Walde komm ich her;
Ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr!
Allüberall auf den Tannenspitzen
Sah ich goldene Lichtlein sitzen;
Und droben aus dem Himmelsthor
Sah mit großen Augen das Christkind hervor,
Und wie ich so strolcht‘ durch den finstern Tann,
Da rief’s mich mit heller Stimme an:
„Knecht Ruprecht“, rief es, „alter Gesell,
„Hebe die Beine und spute dich schnell!
„Die Kerzen fangen zu brennen an,
„Das Himmelsthor ist aufgethan,
„Alt‘ und Junge sollen nun
„Von der Jagd des Lebens einmal ruhn;
„Und morgen flieg‘ ich hinab zur Erden,
„Denn es soll wieder Weihnachten werden!“
Ich sprach: „O lieber Herre Christ,
„Meine Reise fast zu Ende ist;
„Ich soll nur noch in diese Stadt,
„Wo’s eitel gute Kinder hat.“
– „Hast denn das Säcklein auch bei dir?“
Ich sprach: „Das Säcklein das ist hier:
„Denn Aepfel, Nuß und Mandelkern
„Fressen fromme Kinder gern.“
– „Hast denn die Ruthe auch bei dir?“
Ich sprach: „Die Ruthe, die ist hier:
„Doch für die Kinder nur, die schlechten,
„Die trifft sie auf den Theil den rechten.“
Christkindlein sprach: „So ist es recht;
„So geh mit Gott, mein treuer Knecht!“
Von drauß‘ vom Walde komm ich her;
Ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr!
Nun sprecht, wie ich’s hierinnen find‘!
Sind’s gute Kind‘, sind’s böse Kind‘?