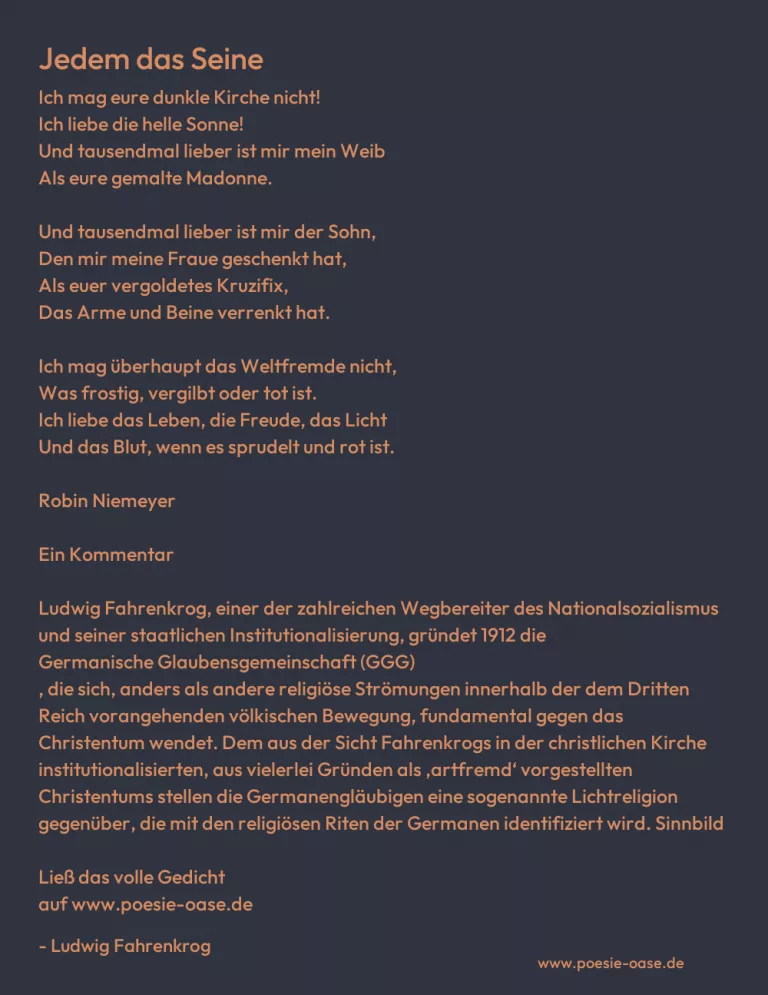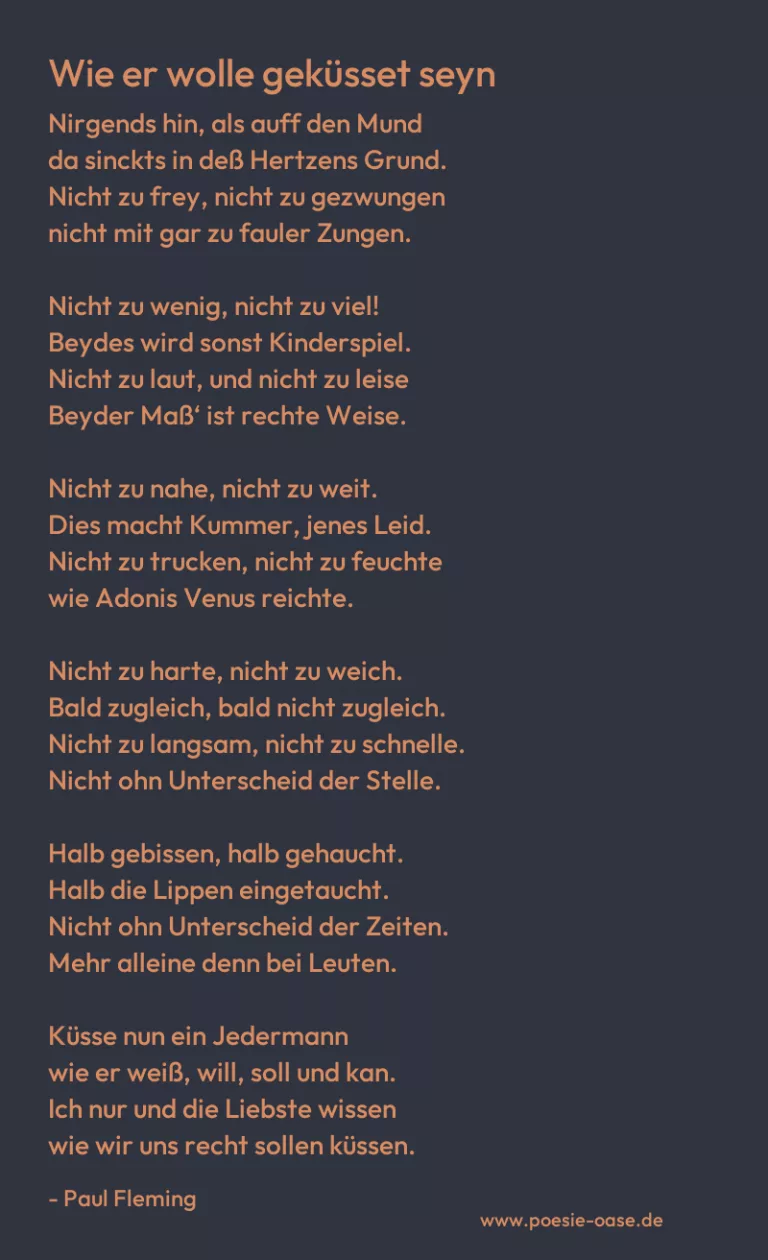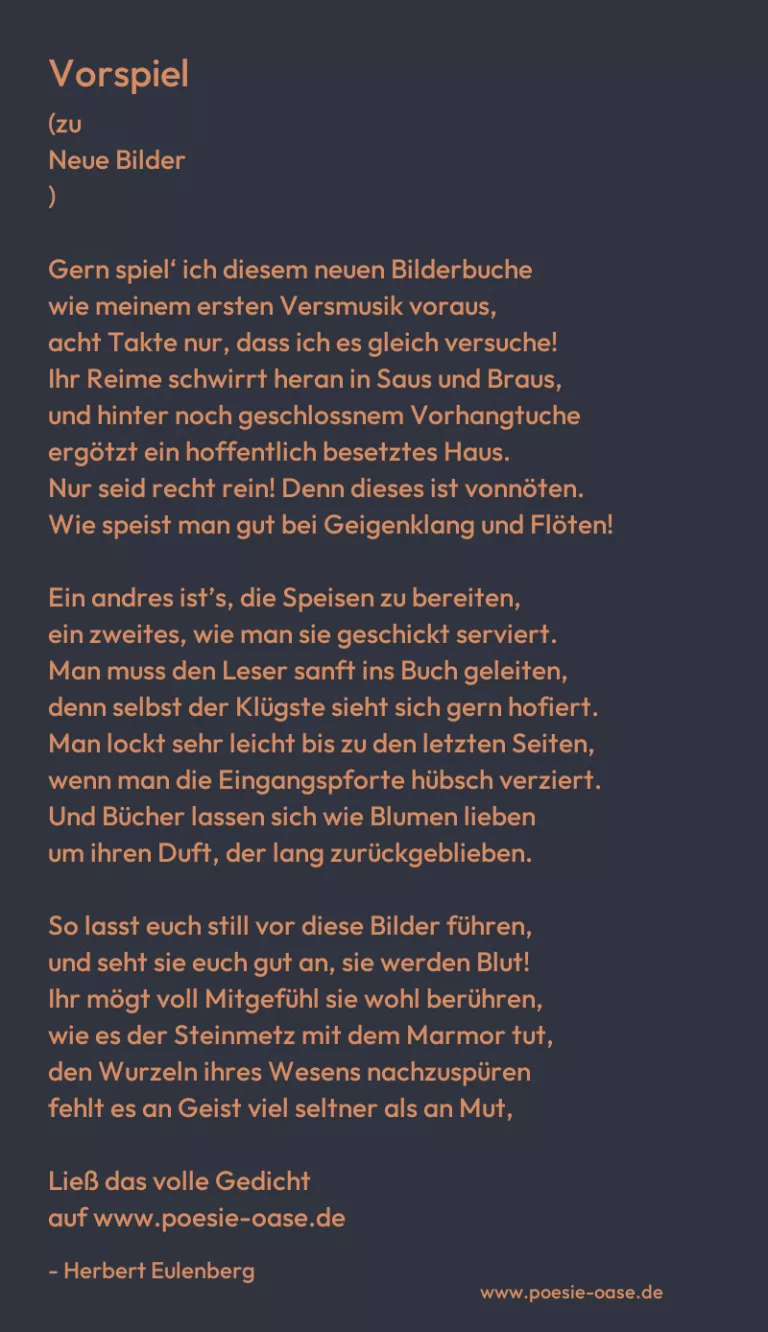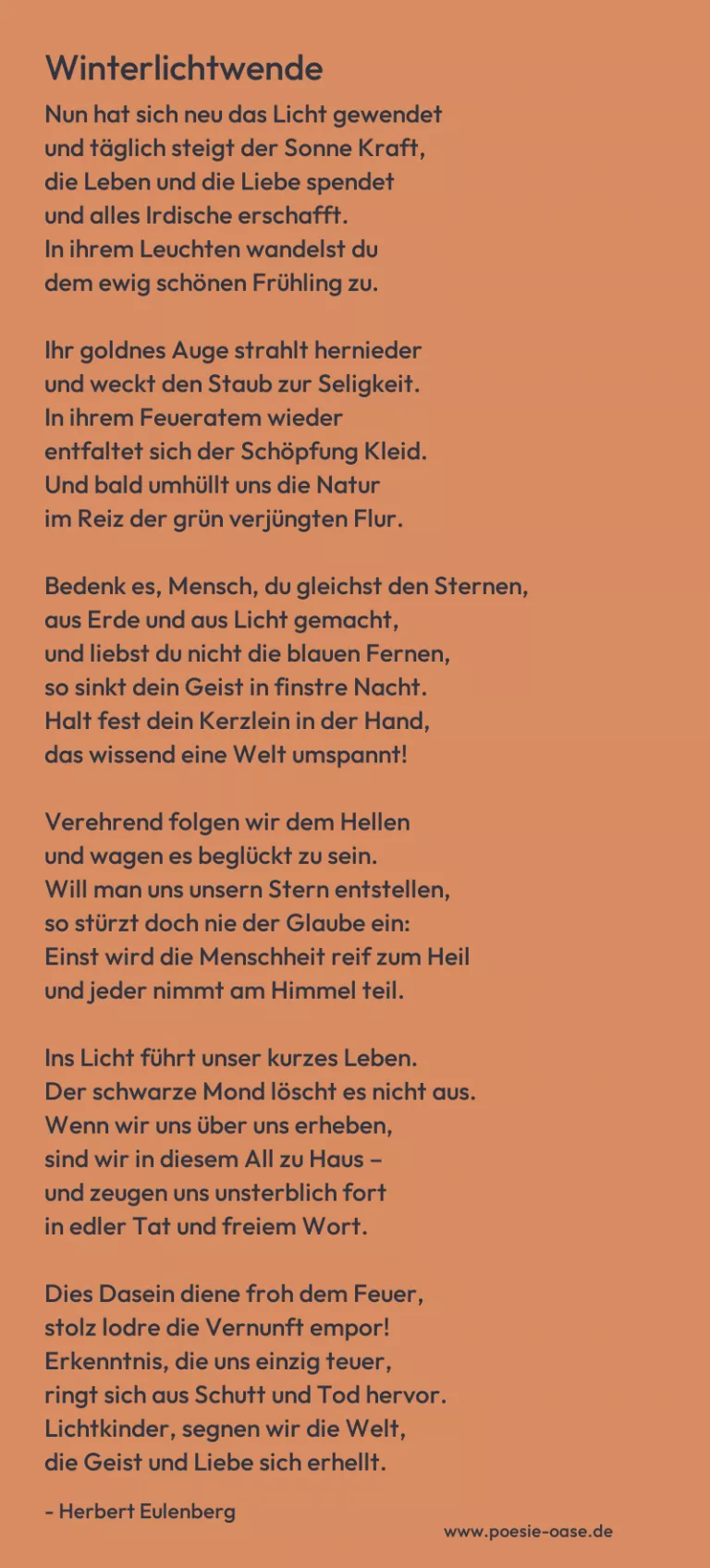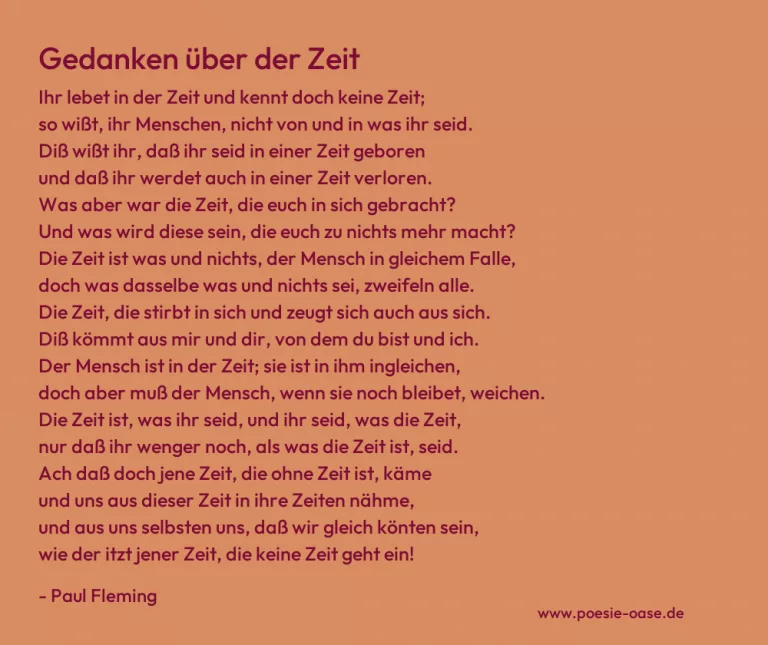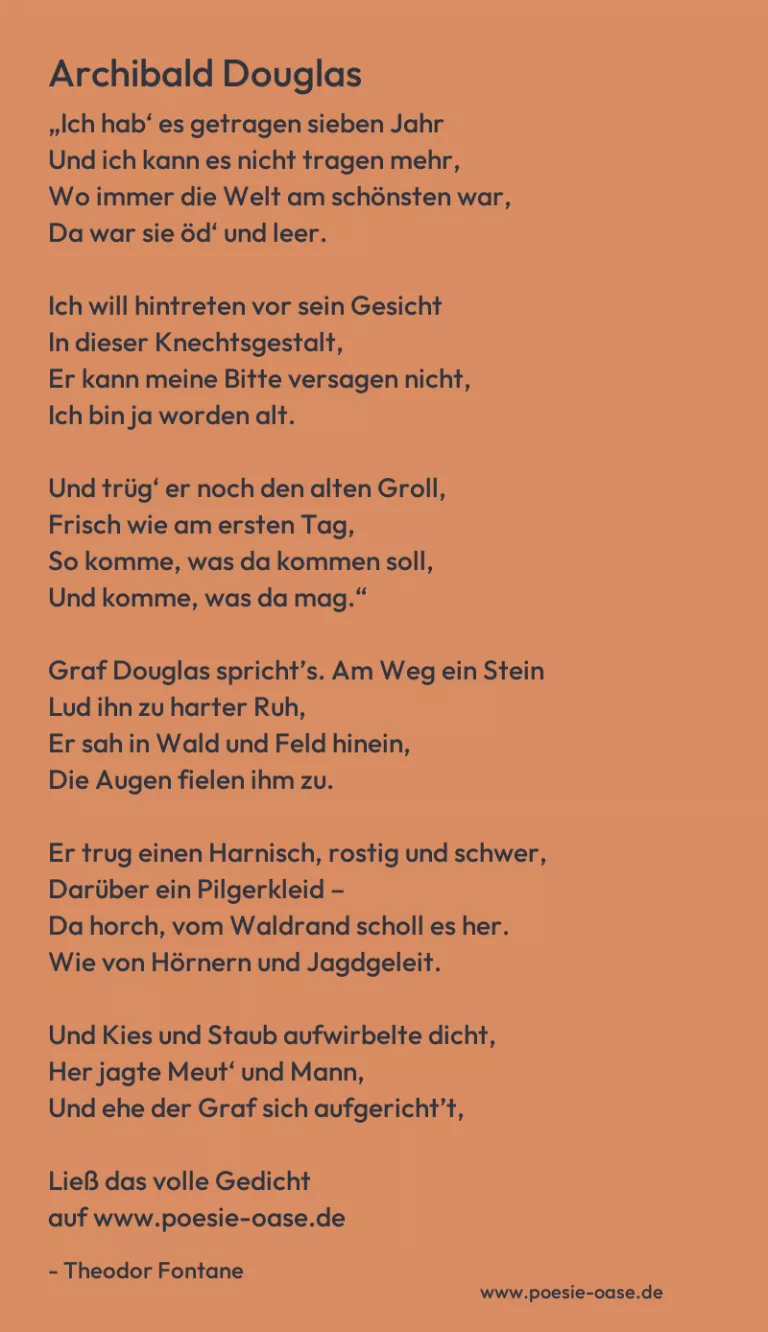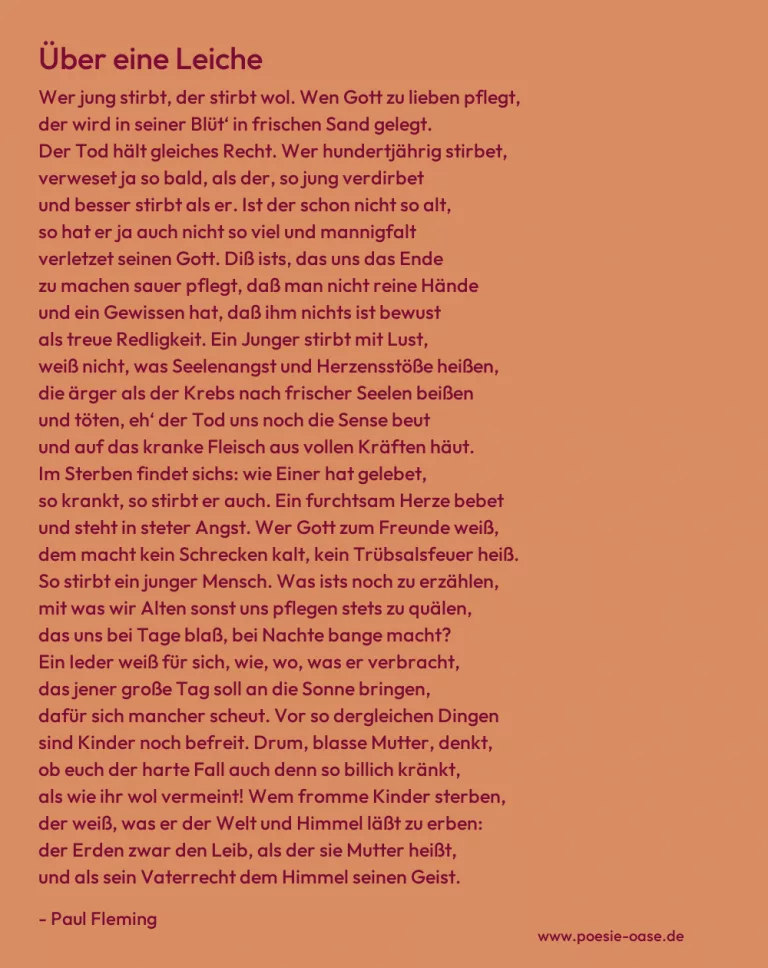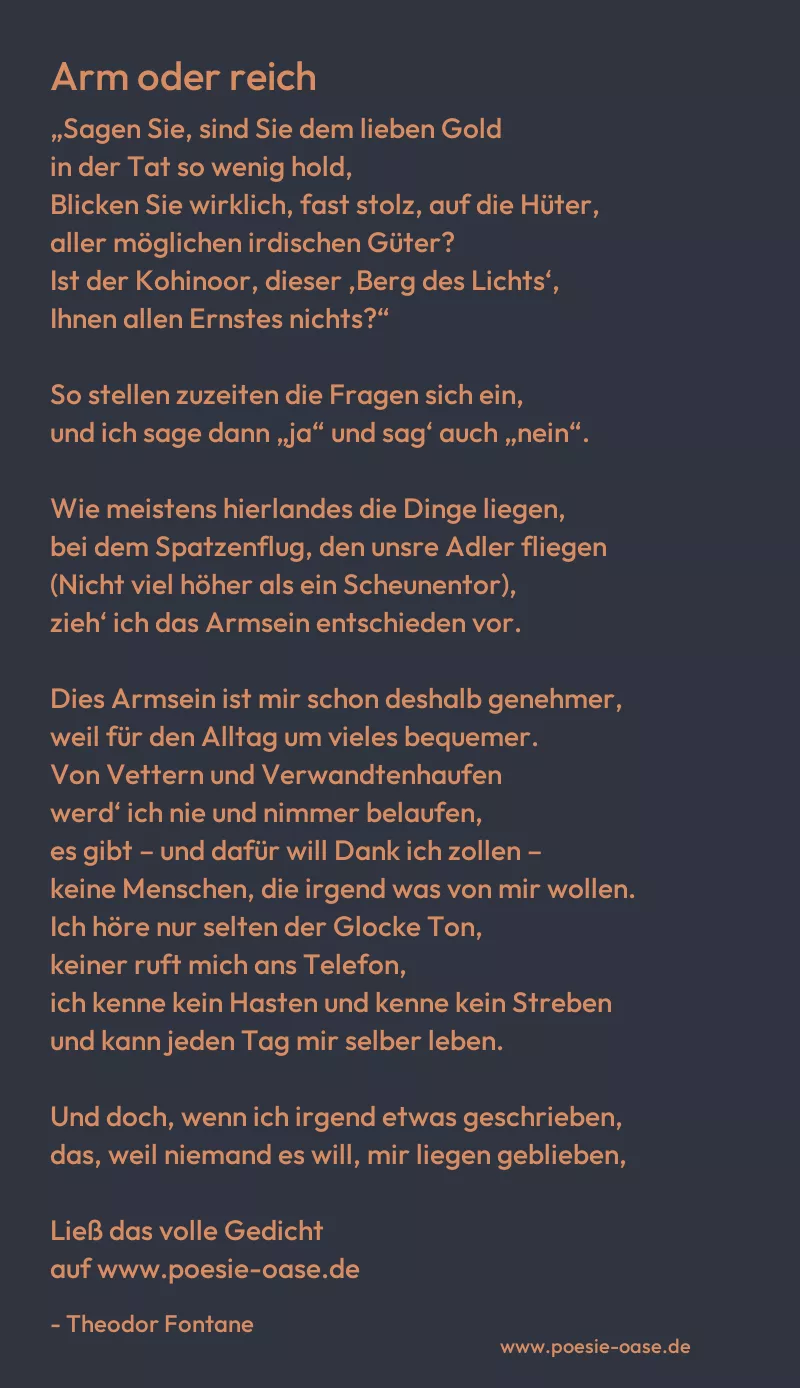„Sagen Sie, sind Sie dem lieben Gold
in der Tat so wenig hold,
Blicken Sie wirklich, fast stolz, auf die Hüter,
aller möglichen irdischen Güter?
Ist der Kohinoor, dieser ‚Berg des Lichts‘,
Ihnen allen Ernstes nichts?“
So stellen zuzeiten die Fragen sich ein,
und ich sage dann „ja“ und sag‘ auch „nein“.
Wie meistens hierlandes die Dinge liegen,
bei dem Spatzenflug, den unsre Adler fliegen
(Nicht viel höher als ein Scheunentor),
zieh‘ ich das Armsein entschieden vor.
Dies Armsein ist mir schon deshalb genehmer,
weil für den Alltag um vieles bequemer.
Von Vettern und Verwandtenhaufen
werd‘ ich nie und nimmer belaufen,
es gibt – und dafür will Dank ich zollen –
keine Menschen, die irgend was von mir wollen.
Ich höre nur selten der Glocke Ton,
keiner ruft mich ans Telefon,
ich kenne kein Hasten und kenne kein Streben
und kann jeden Tag mir selber leben.
Und doch, wenn ich irgend etwas geschrieben,
das, weil niemand es will, mir liegen geblieben,
oder wenn ich Druckfehler ausgereutet,
da weiß ich recht wohl, was Geld bedeutet.
Und wenn man trotzdem, zu dieser Frist,
den Respekt vor dem Gelde bei mir vermißt,
so liegt das daran ganz allein:
Ich finde die Summen hier immer zu klein.
Was, um mich herum hier, mit Golde sich ziert,
ist meistens derartig, daß mich’s geniert;
Der Grünkramhändler, der Weißbierbudiker,
der Tantenbecourer, der Erbschaftsschlieker,
der Züchter von Southdownhammelherden,
Hoppegartenbarone mit Rennstallpferden,
Wuchrer, hochfahrend und untertänig –
sie haben mir alle viel viel zu wenig.
Mein Intresse für Gold und derlei Stoff
beginnt erst beim Fürsten Demidoff,
bei Yussupoff und bei Dolgorucky,
bei Sklavenhaltern aus Süd-Kentucky,
bei Mackay und Gould, bei Bennet und Astor,
hierlandes schmeckt alles nach Hungerpastor –
erst in der Höhe von Van der Bilt
seh‘ ich mein Ideal gestillt:
Der Nil müßte durch ein Nil-Reich laufen,
China würd‘ ich meistbietend verkaufen,
einen Groß-Admiral würd‘ ich morgen ernennen,
der müßte die englische Flotte verbrennen,
auf daß, Gott segne seine Hände,
das Kattun-Christentum aus der Welt verschwände.
So reich sein, das könnte mich verlocken –
sonst bin ich für Brot in die Suppe brocken.