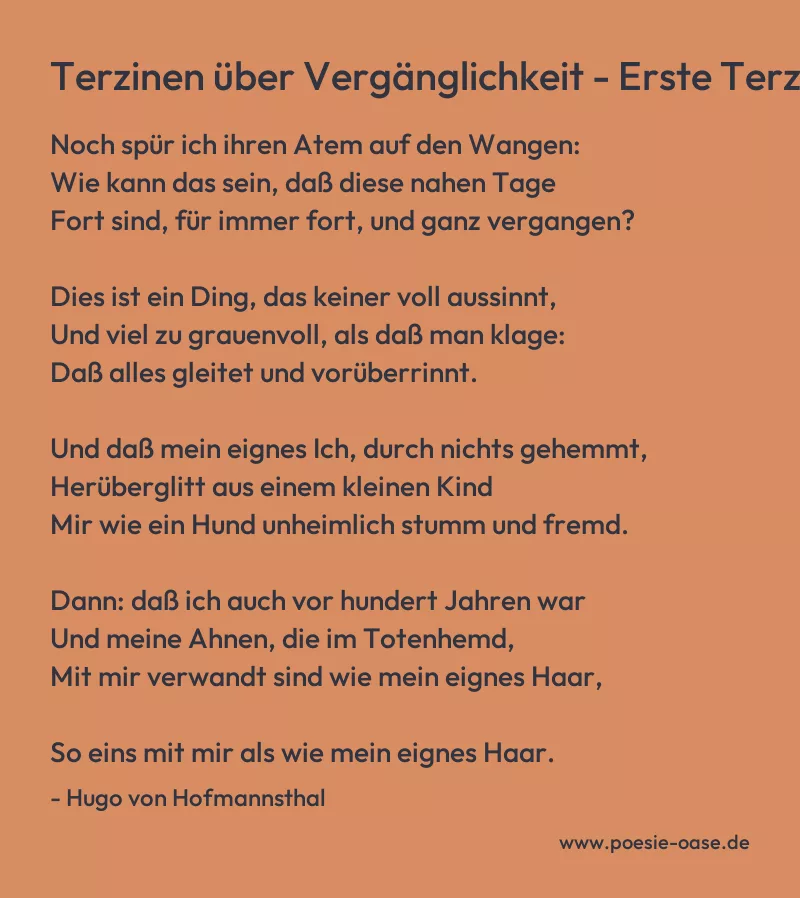Terzinen über Vergänglichkeit – Erste Terzine
Noch spür ich ihren Atem auf den Wangen:
Wie kann das sein, daß diese nahen Tage
Fort sind, für immer fort, und ganz vergangen?
Dies ist ein Ding, das keiner voll aussinnt,
Und viel zu grauenvoll, als daß man klage:
Daß alles gleitet und vorüberrinnt.
Und daß mein eignes Ich, durch nichts gehemmt,
Herüberglitt aus einem kleinen Kind
Mir wie ein Hund unheimlich stumm und fremd.
Dann: daß ich auch vor hundert Jahren war
Und meine Ahnen, die im Totenhemd,
Mit mir verwandt sind wie mein eignes Haar,
So eins mit mir als wie mein eignes Haar.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
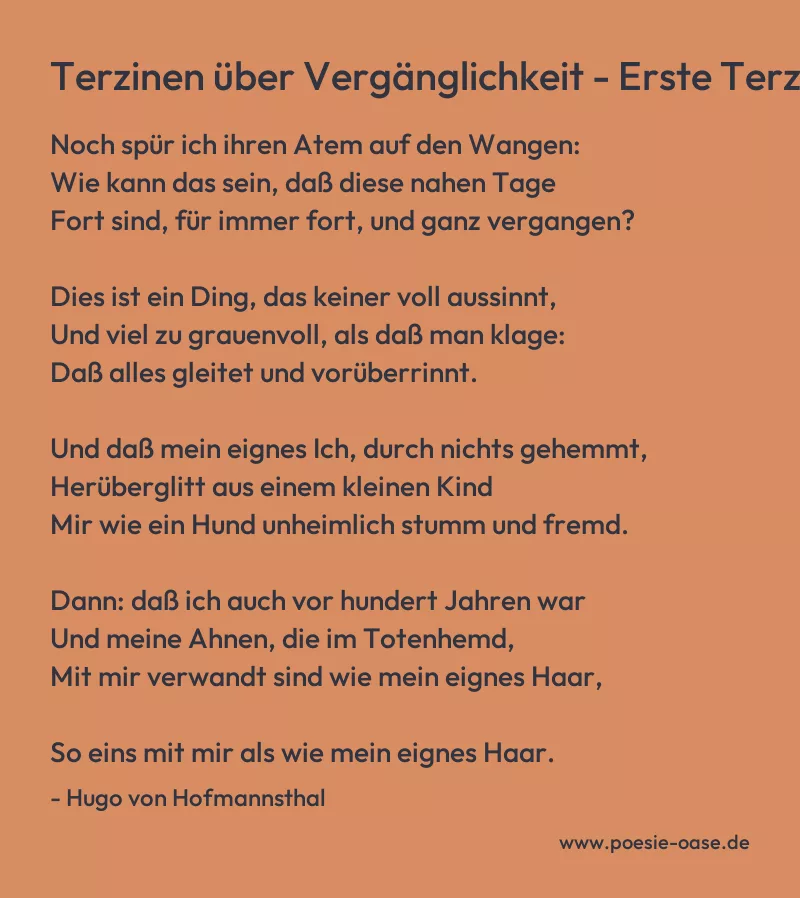
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Terzinen über Vergänglichkeit – Erste Terzine“ von Hugo von Hofmannsthal thematisiert auf ergreifende Weise die Erfahrung des Verfalls und der Nichtigkeit des menschlichen Lebens. Der Dichter stellt sich der unaufhaltsamen Flucht der Zeit und der daraus resultierenden Vergänglichkeit.
Die ersten Verse offenbaren die noch immer präsente Erinnerung an vergangene Momente, repräsentiert durch den „Atem auf den Wangen“. Dieser sinnliche Eindruck kontrastiert mit dem Wissen um die Unwiederbringlichkeit dieser „nahen Tage“, die „fort sind, für immer fort, und ganz vergangen“. Das Gedicht wirft eine existentielle Frage auf: Wie kann etwas, das so unmittelbar erlebt wurde, so schnell entschwinden? Die Antwort, dass dies etwas ist, „das keiner voll aussinnt“, unterstreicht die Unbegreiflichkeit und letztliche Unfassbarkeit des Vergänglichkeitsthemas. Die Formulierung deutet auf die Überforderung des menschlichen Verstandes durch dieses Phänomen hin, verbunden mit einer gewissen Ehrfurcht vor dem Mysterium des Lebens.
Die zweite Strophe vertieft die Reflexion und beschreibt die allgemeine Vergänglichkeit des Seins. Die Metapher des „Gleitens“ und „Vorüberrinnens“ verdeutlicht, dass alles in stetigem Fluss ist und sich ständig verändert. Besonders bemerkenswert ist die persönliche Betrachtung des eigenen Ichs. Das eigene Selbst, die Identität des Dichters, wird als etwas wahrgenommen, das sich durch die Zeit verändert, sich von der Kindheit entfremdet und nun „unheimlich stumm und fremd“ wirkt. Dieses Gefühl der Entfremdung vom eigenen Ich ist ein zentrales Motiv, das die Tragik der Vergänglichkeit verdeutlicht, da die eigene Identität keine Konstante ist, sondern ebenfalls dem Wandel unterworfen ist.
Die dritte Terzine erweitert die Perspektive und bezieht die eigene Vergangenheit und die Ahnen mit ein. Die Erkenntnis, dass man bereits „vor hundert Jahren war“ und mit den Ahnen, die bereits im Tod ruhen, durch die eigene Existenz verbunden ist, verdeutlicht die zyklische Natur des Lebens und Sterbens. Die Metapher des „Haares“ unterstreicht die enge Verbundenheit und die Teilhabe an der Vergangenheit. Das Haar symbolisiert etwas, das Teil des Körpers ist und untrennbar mit ihm verbunden ist, genau wie die Ahnen mit dem eigenen Sein. Diese Zeilen lassen eine tiefe Melancholie und das Bewusstsein der menschlichen Vergänglichkeit, aber auch der Verbundenheit über Generationen hinweg spüren.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.