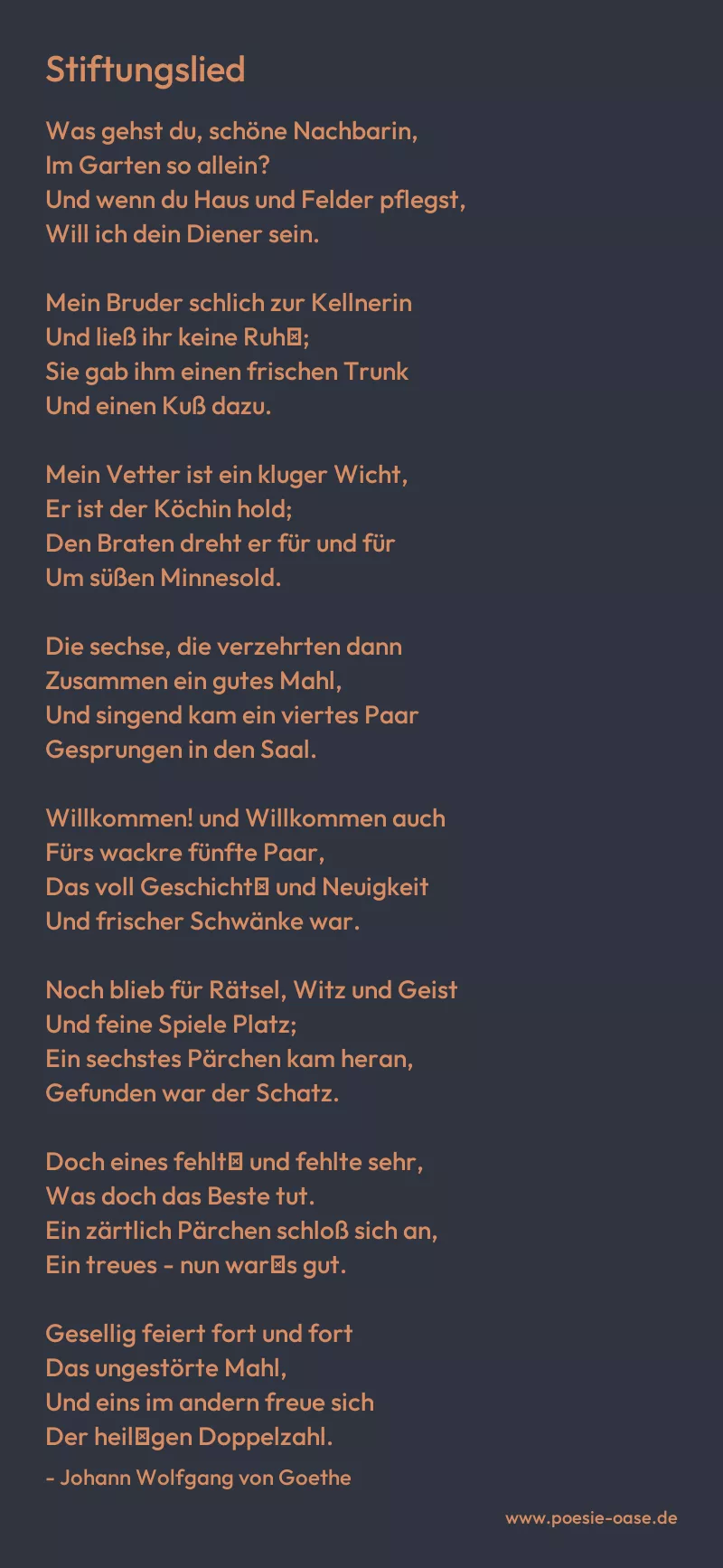Stiftungslied
Was gehst du, schöne Nachbarin,
Im Garten so allein?
Und wenn du Haus und Felder pflegst,
Will ich dein Diener sein.
Mein Bruder schlich zur Kellnerin
Und ließ ihr keine Ruh′;
Sie gab ihm einen frischen Trunk
Und einen Kuß dazu.
Mein Vetter ist ein kluger Wicht,
Er ist der Köchin hold;
Den Braten dreht er für und für
Um süßen Minnesold.
Die sechse, die verzehrten dann
Zusammen ein gutes Mahl,
Und singend kam ein viertes Paar
Gesprungen in den Saal.
Willkommen! und Willkommen auch
Fürs wackre fünfte Paar,
Das voll Geschicht′ und Neuigkeit
Und frischer Schwänke war.
Noch blieb für Rätsel, Witz und Geist
Und feine Spiele Platz;
Ein sechstes Pärchen kam heran,
Gefunden war der Schatz.
Doch eines fehlt′ und fehlte sehr,
Was doch das Beste tut.
Ein zärtlich Pärchen schloß sich an,
Ein treues – nun war′s gut.
Gesellig feiert fort und fort
Das ungestörte Mahl,
Und eins im andern freue sich
Der heil′gen Doppelzahl.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
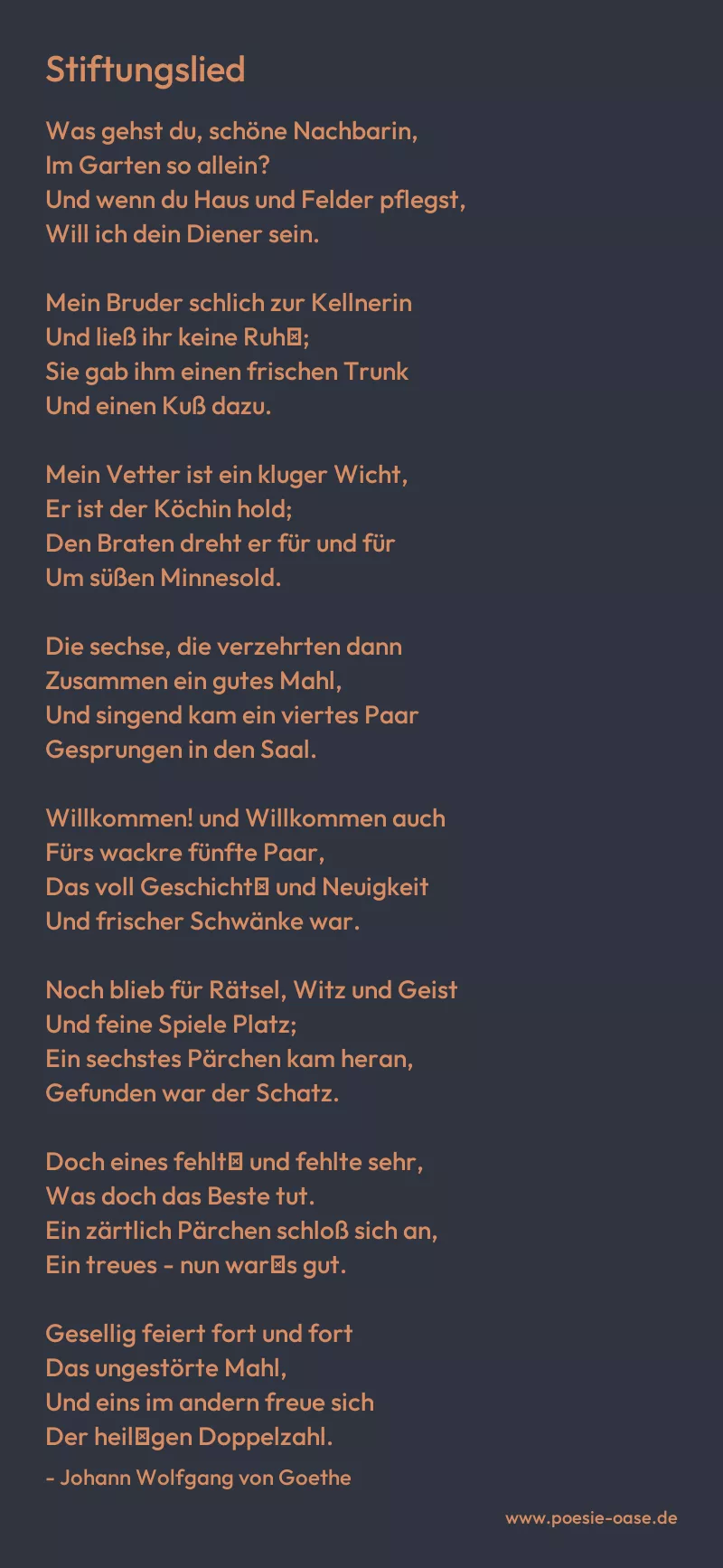
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Stiftungslied“ von Johann Wolfgang von Goethe beschreibt eine fröhliche und ausgelassene Gesellschaft, die sich in einem Garten versammelt hat und ein Festmahl abhält. Der Text gliedert sich in einzelne Strophen, die jeweils Paare von Personen in den Mittelpunkt stellen, die auf unterschiedliche Weise an der Feier teilnehmen. Die ersten Strophen skizzieren einzelne Charaktere und ihre Beziehungen zu anderen Personen, wobei die Liebe und das Vergnügen im Vordergrund stehen.
Die verschiedenen Paare werden in ihren jeweiligen Rollen und Vorlieben dargestellt: Die „schöne Nachbarin“ wird vom Ich-Erzähler umworben, während der Bruder sich der Kellnerin zuwendet und der Vetter die Köchin umgarnt, um an den Freuden des Lebens teilzuhaben. Die folgenden Strophen widmen sich dem Essen, der Geselligkeit und dem Unterhaltungswert des Abends. Es wird gelacht, gesungen und gespielt. Goethe zeichnet ein Bild der Lebensfreude und der Gemeinschaft, in der jeder seinen Platz findet und seinen Beitrag zum Gelingen des Festes leistet. Die stetige Zunahme der Paare, die an dem Fest teilnehmen, deutet auf das wachsende Gemeinschaftsgefühl hin.
Der Höhepunkt des Gedichts ist das Hinzutreten eines „zärtlichen Pärchens“, das die Vollständigkeit des Festes markiert, da das letzte Paar die „treue“ Beziehung repräsentiert, die das Fest erst vollkommen macht. Die Schlussstrophe feiert die Harmonie und das Zusammensein der Gruppe, indem sie die „heil′gen Doppelzahl“ hervorhebt, die sich an dem ungestörten Festmahl erfreut. Dies deutet auf eine Idealisierung der Gemeinschaft hin, in der jeder seinen Platz hat und die Liebe sowie die Verbundenheit im Mittelpunkt stehen.
Goethes „Stiftungslied“ kann somit als ein Loblied auf die menschliche Gesellschaft und die Bedeutung der Gemeinschaft interpretiert werden. Das Gedicht zelebriert die Freude am Zusammensein, die Liebe, das Vergnügen und die gegenseitige Wertschätzung. Die einfache Sprache und die lebendigen Bilder machen das Gedicht zugänglich und laden den Leser ein, an der fröhlichen Feier teilzuhaben. Das Fehlen von Komplexität lenkt den Fokus auf die Freude am Leben und die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen, die das Fest erst zu etwas Besonderem machen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.