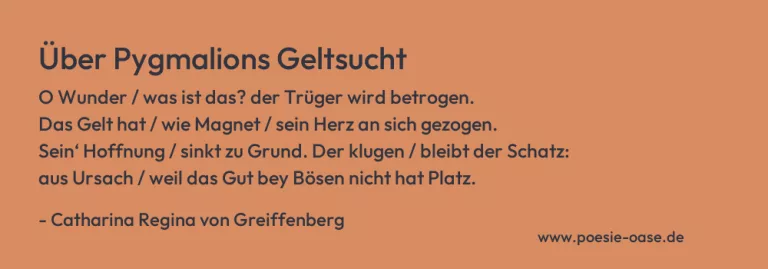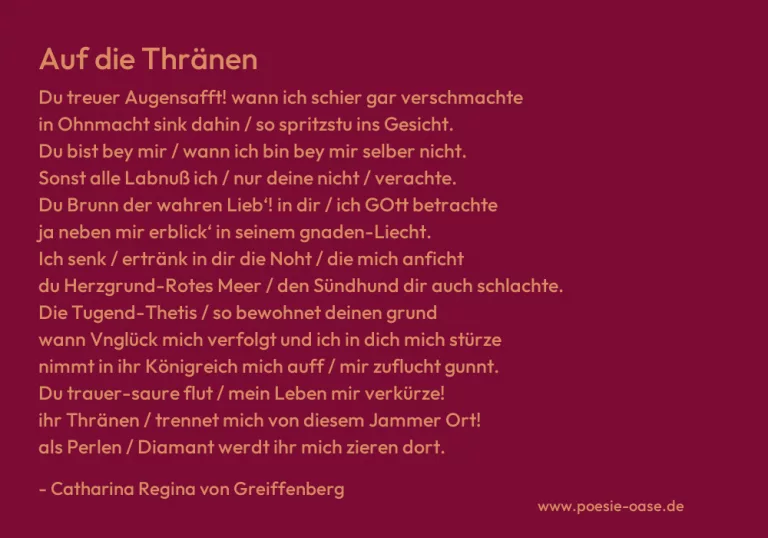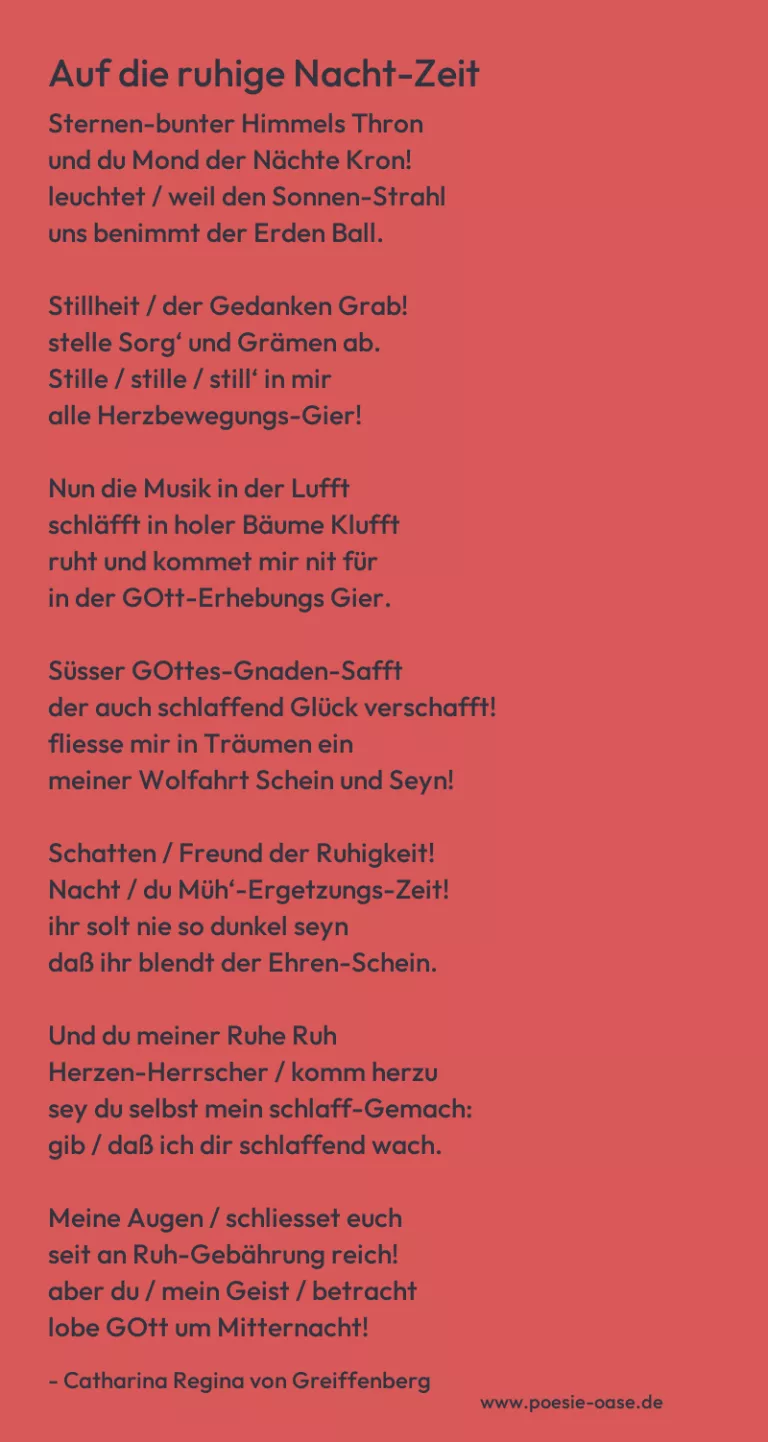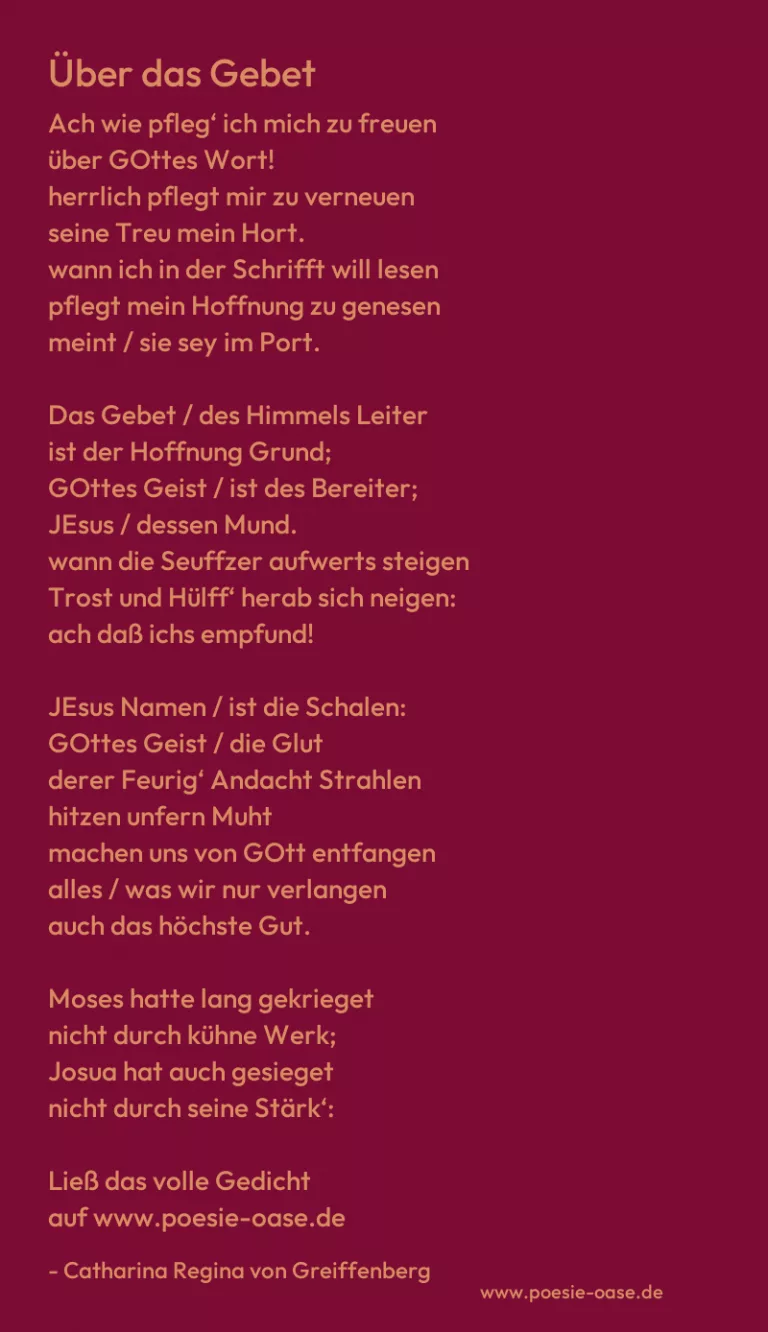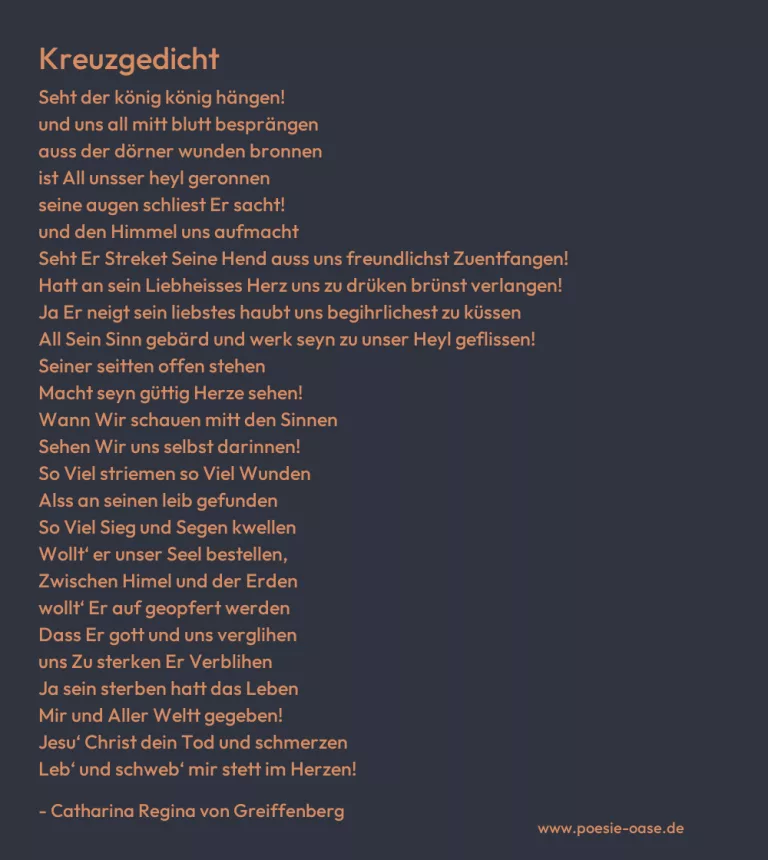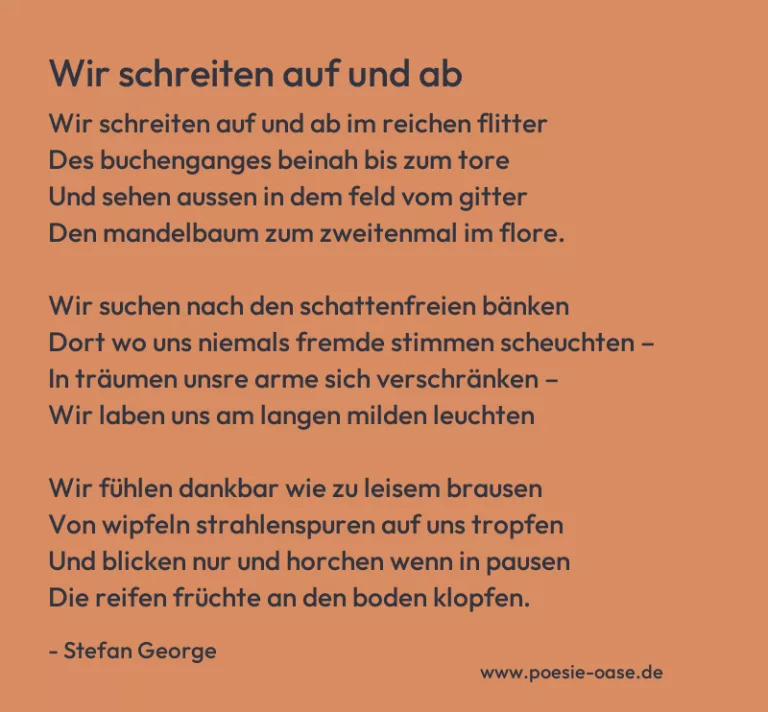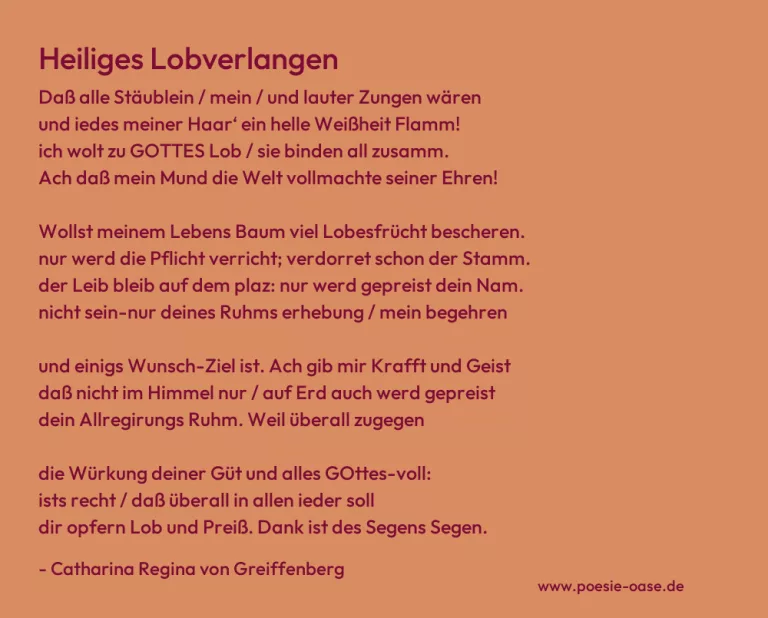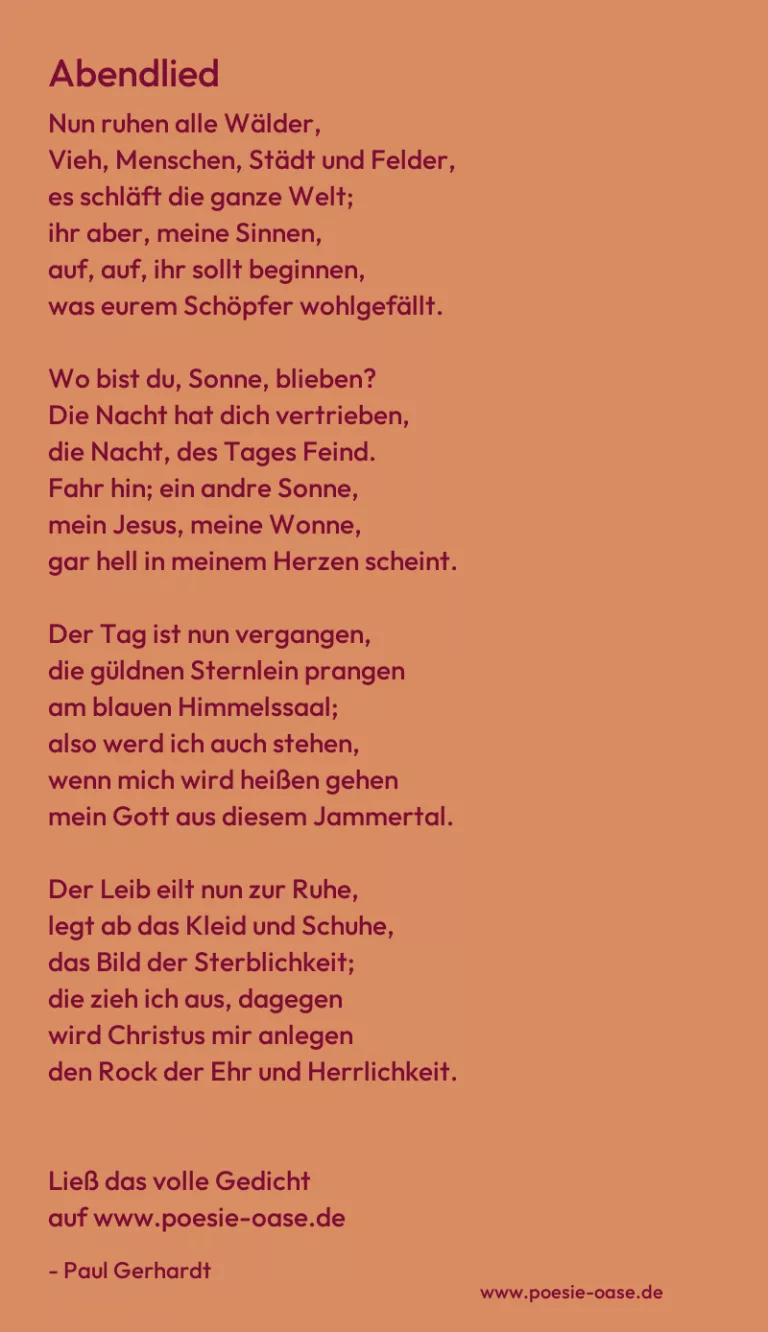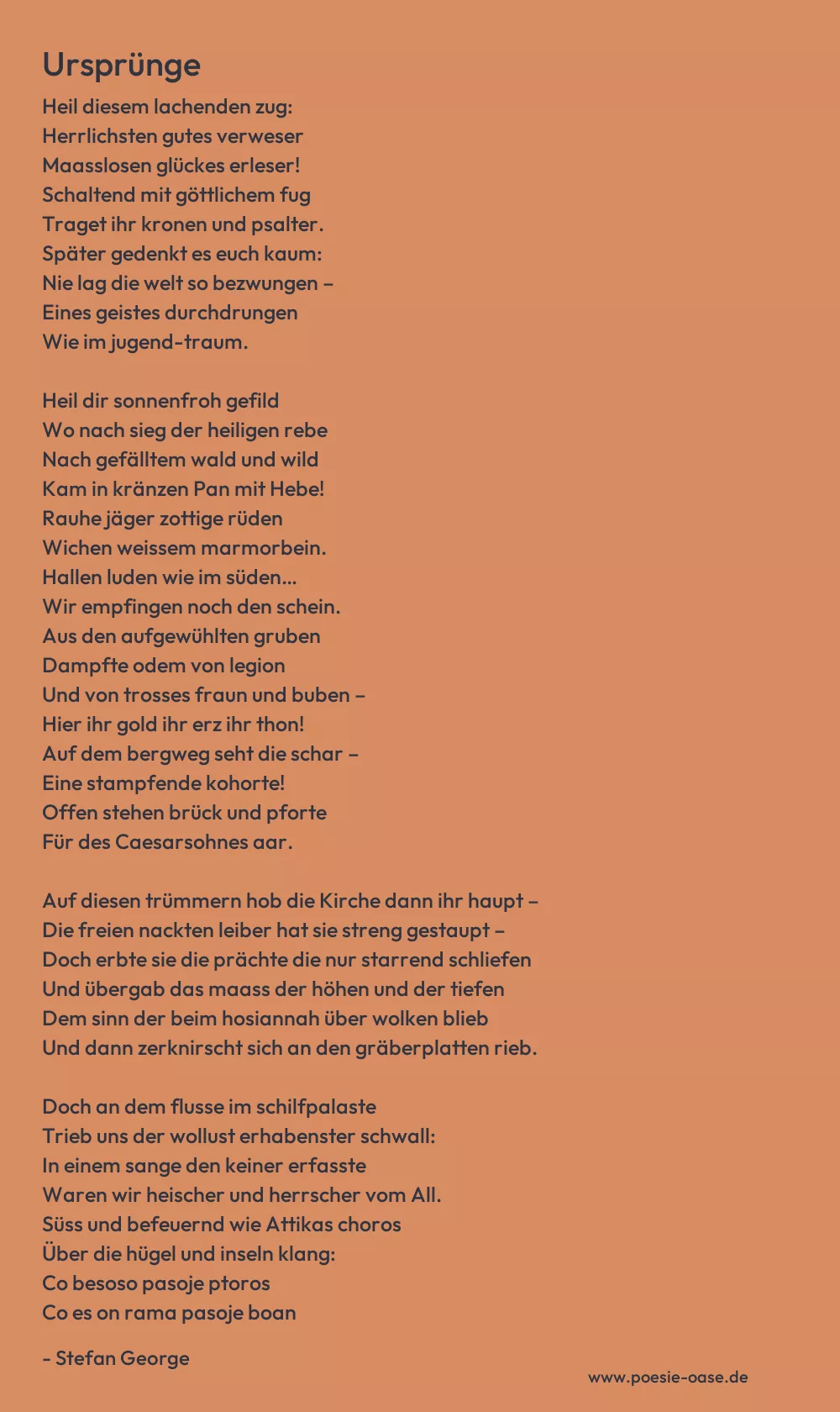Ursprünge
Heil diesem lachenden zug:
Herrlichsten gutes verweser
Maasslosen glückes erleser!
Schaltend mit göttlichem fug
Traget ihr kronen und psalter.
Später gedenkt es euch kaum:
Nie lag die welt so bezwungen –
Eines geistes durchdrungen
Wie im jugend-traum.
Heil dir sonnenfroh gefild
Wo nach sieg der heiligen rebe
Nach gefälltem wald und wild
Kam in kränzen Pan mit Hebe!
Rauhe jäger zottige rüden
Wichen weissem marmorbein.
Hallen luden wie im süden…
Wir empfingen noch den schein.
Aus den aufgewühlten gruben
Dampfte odem von legion
Und von trosses fraun und buben –
Hier ihr gold ihr erz ihr thon!
Auf dem bergweg seht die schar –
Eine stampfende kohorte!
Offen stehen brück und pforte
Für des Caesarsohnes aar.
Auf diesen trümmern hob die Kirche dann ihr haupt –
Die freien nackten leiber hat sie streng gestaupt –
Doch erbte sie die prächte die nur starrend schliefen
Und übergab das maass der höhen und der tiefen
Dem sinn der beim hosiannah über wolken blieb
Und dann zerknirscht sich an den gräberplatten rieb.
Doch an dem flusse im schilfpalaste
Trieb uns der wollust erhabenster schwall:
In einem sange den keiner erfasste
Waren wir heischer und herrscher vom All.
Süss und befeuernd wie Attikas choros
Über die hügel und inseln klang:
Co besoso pasoje ptoros
Co es on rama pasoje boan
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
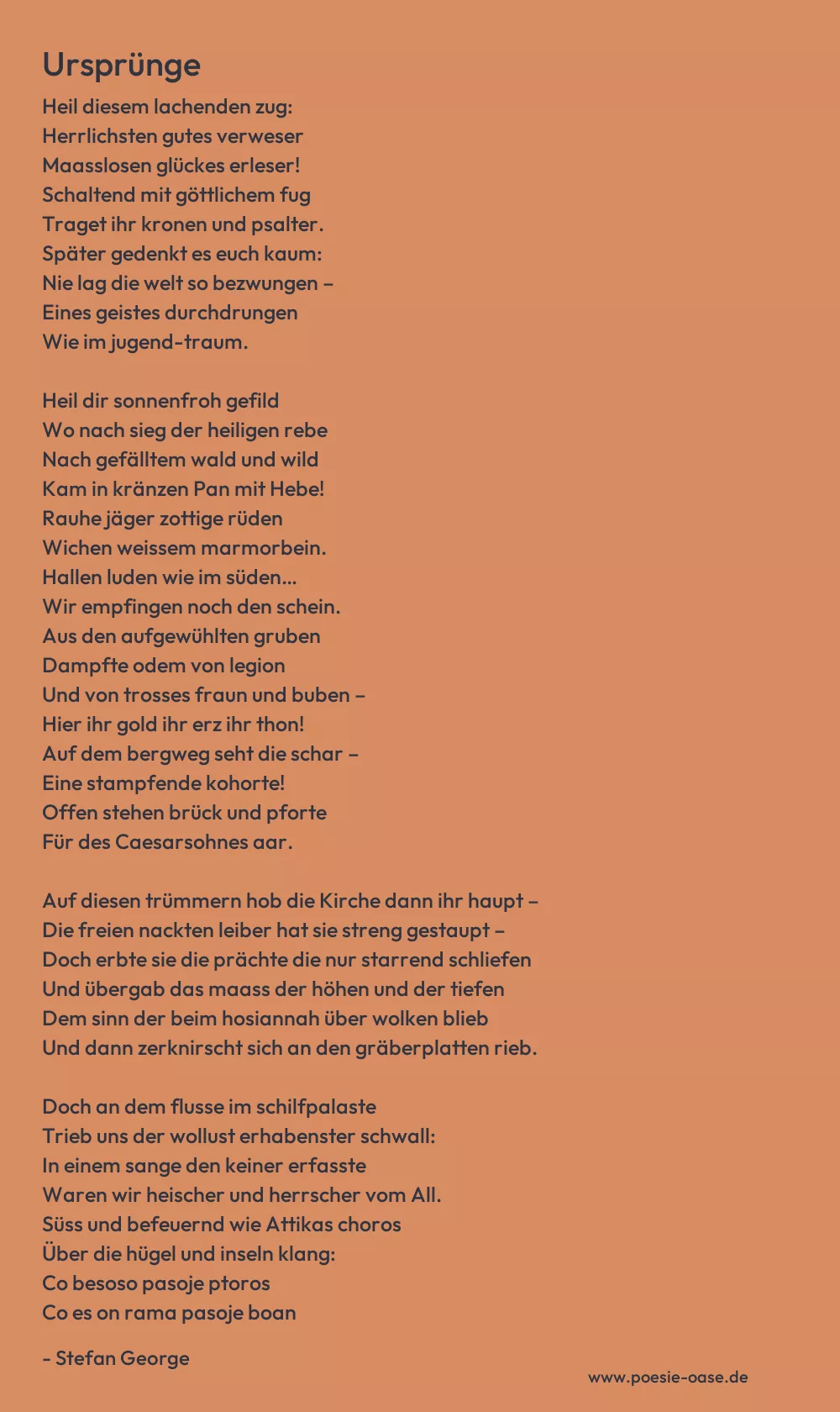
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ursprünge“ von Stefan George entfaltet eine feierliche Rückschau auf vergangene Hochkulturen und deren spirituelles und künstlerisches Erbe. Die ersten Verse preisen einen „lachenden Zug“, der das „herrlichste Gute“ verwaltet und über Maß und Glück entscheidet. Diese ersten Zeilen deuten auf eine ideale, fast göttliche Ordnung hin, die einst existierte, aber später kaum noch erinnert wird. Die Welt war damals ganz von einem einheitlichen Geist durchdrungen – einem Geist, der nur in einem „Jugendtraum“ erneut erlebbar scheint.
Die zweite Strophe ruft ein Arkadien herauf, ein goldenes Zeitalter, in dem Natur, Kunst und Lebensfreude in Einklang standen. Nach den Kämpfen – den „gefallenen Wäldern und Wild“ – folgte eine Epoche des Friedens, in der sich Pan und Hebe, die Götter der Natur und der Jugend, vereinten. Die rohe Jagd wich der griechisch-römischen Kultur, dargestellt durch weißen Marmor, prächtige Hallen und eine von Kunst geprägte Lebensweise. Die Bilder des römischen Erbes – Legionen, das Gold und Erz, das aus Gruben dampft, und die „stampfende Kohorte“ auf dem Bergweg – zeugen von einer vergangenen Macht, die geordnet und erhaben war.
In der dritten Strophe erfolgt der Übergang zur christlichen Epoche. Die Kirche erhebt sich auf den Trümmern der Antike, verdrängt die „freien nackten Leiber“ und überzieht sie mit moralischer Strenge. Doch gleichzeitig erbt sie die architektonische und geistige Pracht der Antike und versucht, diese mit ihrem eigenen Glaubenssystem zu verbinden. Die Höhen und Tiefen der Welt werden dem religiösen Empfinden unterstellt – zunächst in ekstatischem „Hosiannah“ über den Wolken, dann in zerknirschter Reue an den Grabplatten. Diese Zeilen zeigen Georges ambivalente Haltung zum Christentum: Es bewahrt Teile der alten Größe, doch in einer erstarrten, unterdrückenden Form.
Die letzte Strophe kehrt zu einer ekstatischen, ursprünglichen Erfahrung zurück – an einen mythischen Fluss, wo ein „Schwall der Wollust“ das lyrische Ich erfasst. Hier erreicht das Streben nach Schönheit und Macht seinen Höhepunkt in einem mystischen, unverständlichen Gesang. Diese letzten Verse in unbekannter Sprache klingen wie ein uraltes, archaisches Ritual – ein Lied, das keiner ganz erfassen kann, aber das dennoch das ganze Universum durchdringt. Damit endet das Gedicht in einer Rückkehr zu den Ursprüngen: zu einem Zustand reiner, ungebändigter, göttlicher Kraft, die sich jenseits der zivilisatorischen Zwänge entfaltet.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.