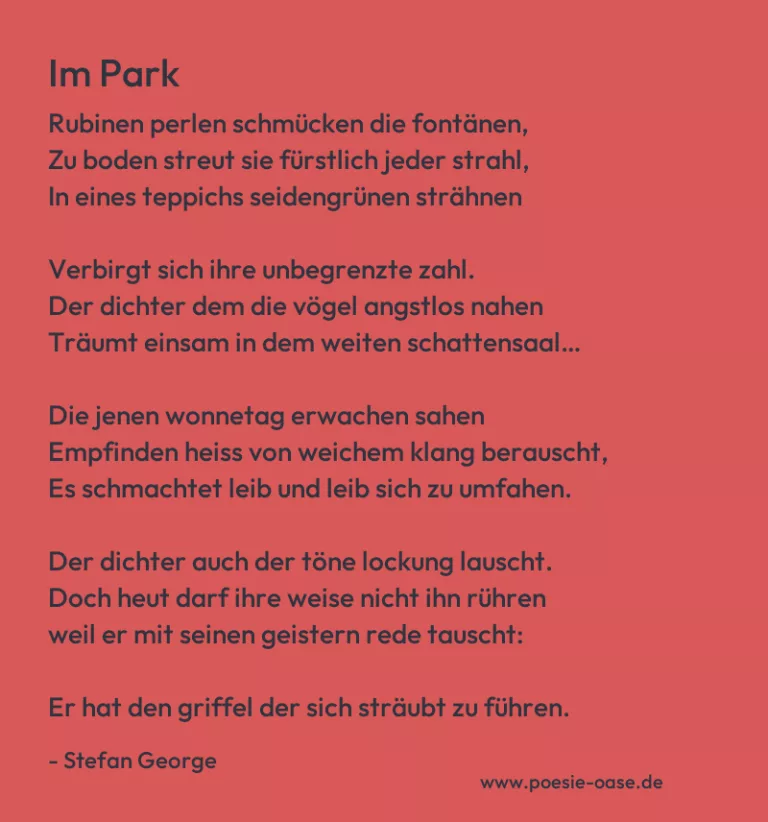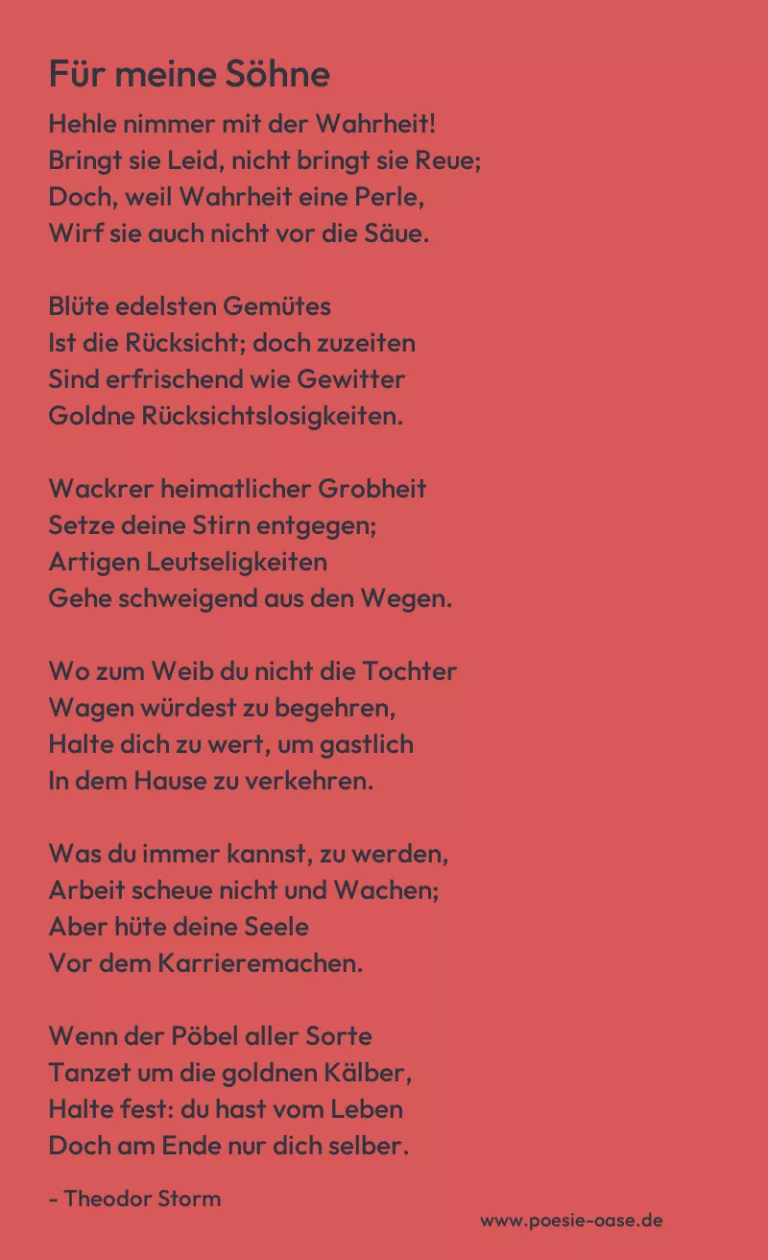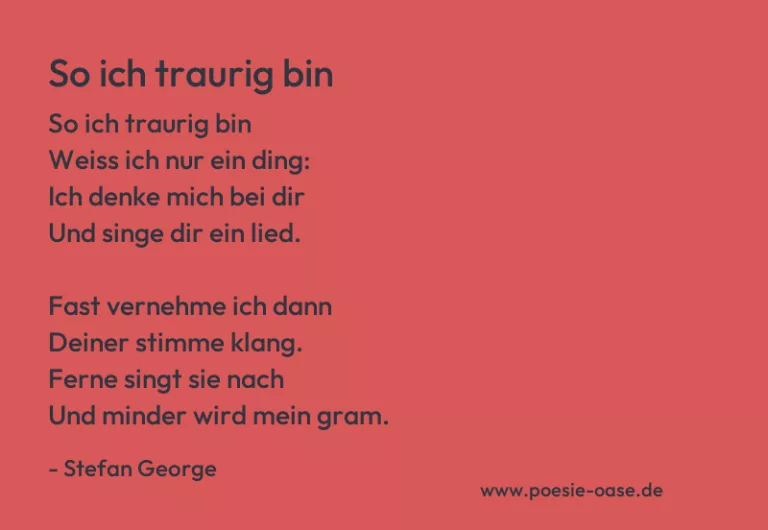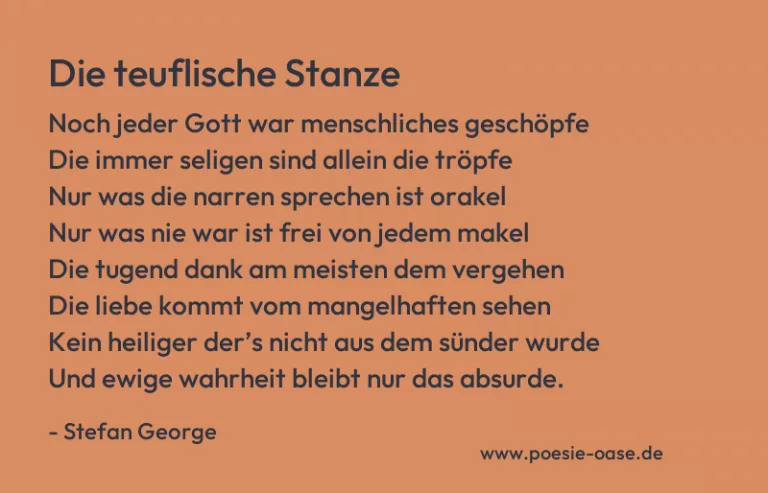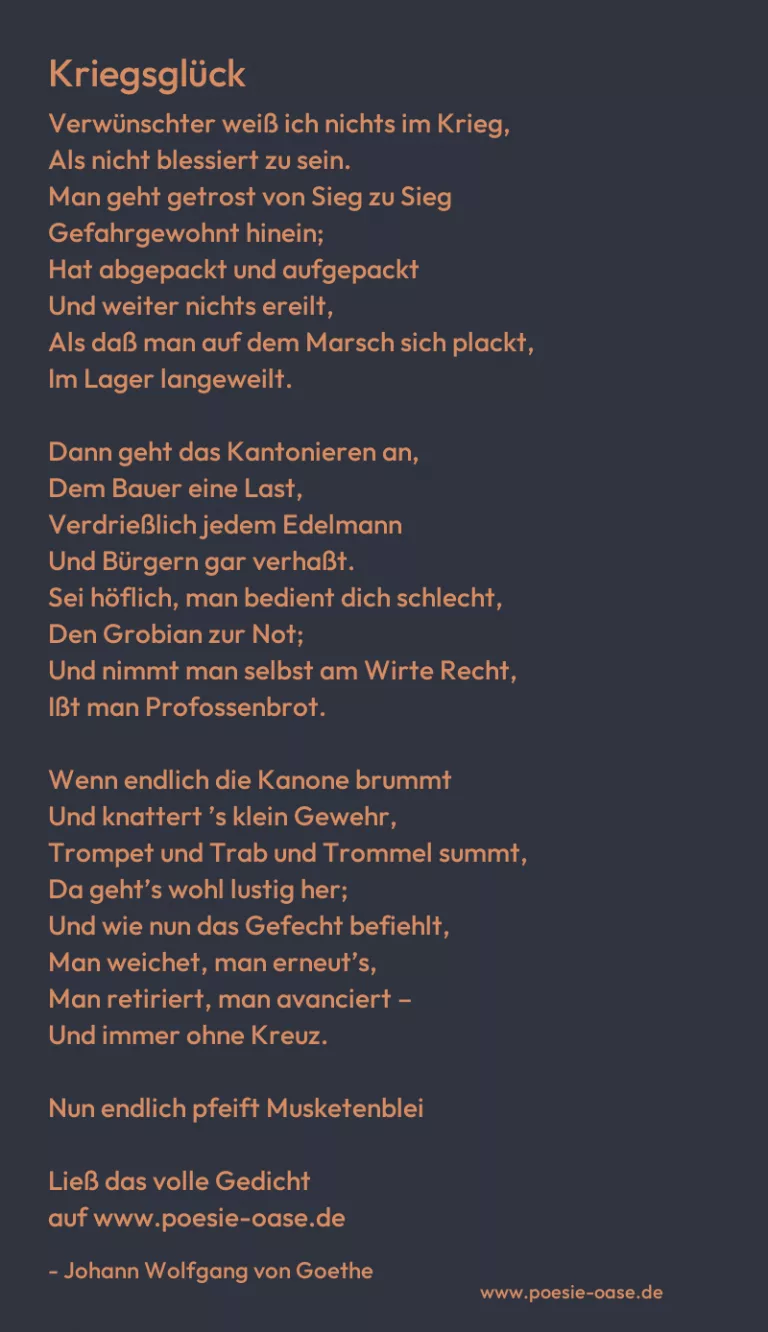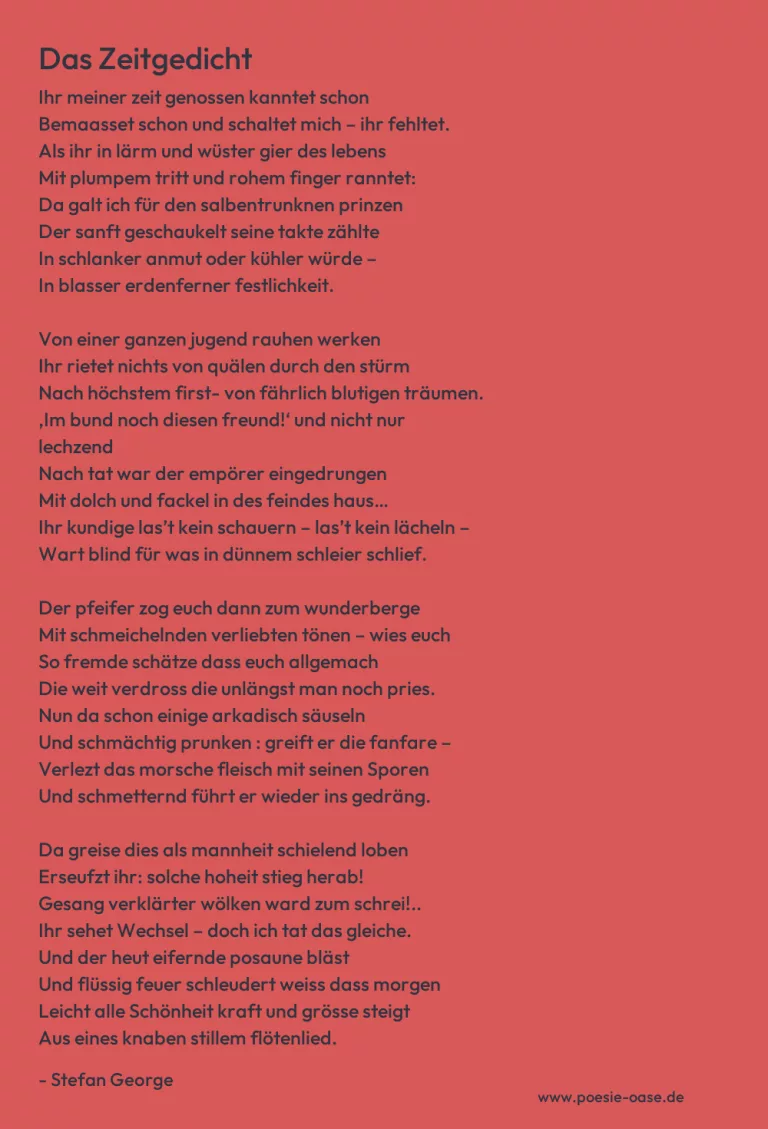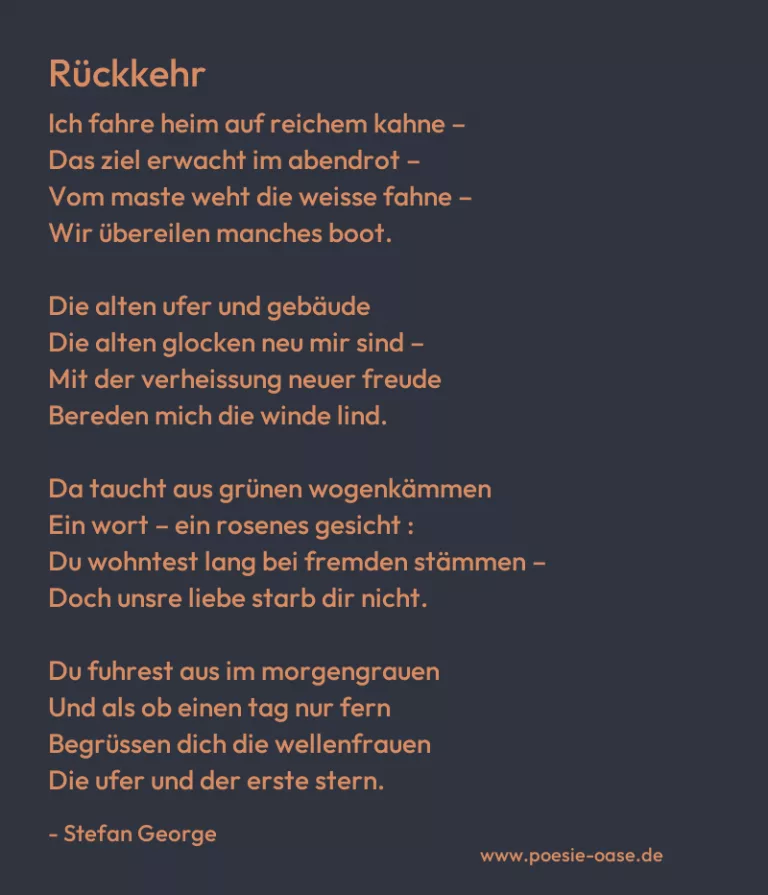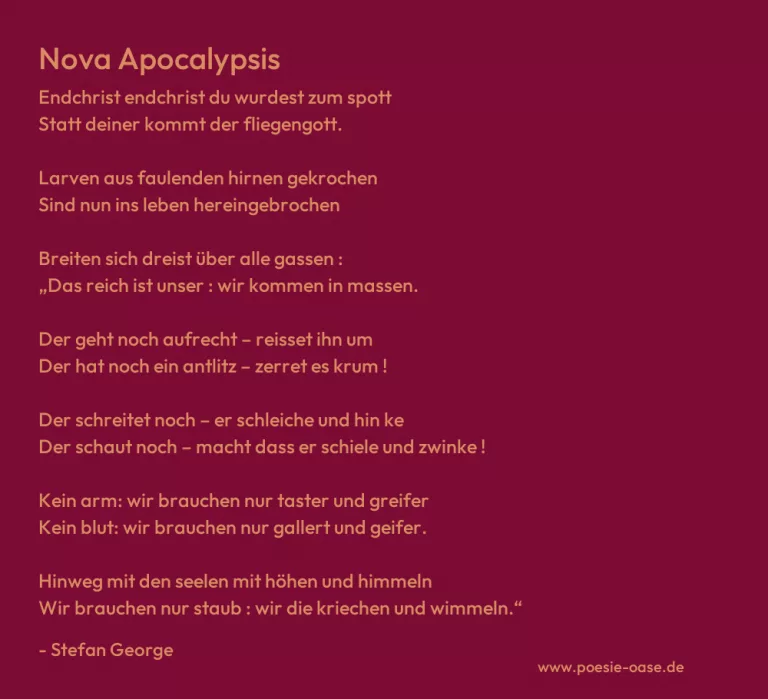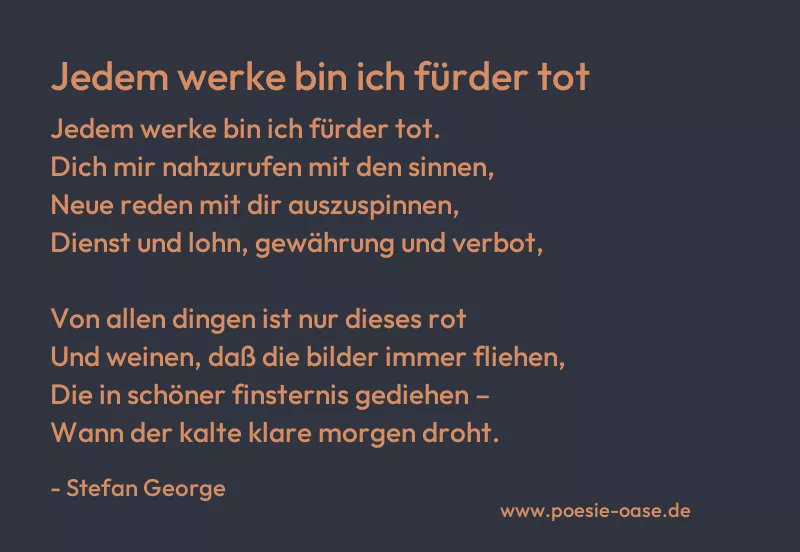Jedem werke bin ich fürder tot
Jedem werke bin ich fürder tot.
Dich mir nahzurufen mit den sinnen,
Neue reden mit dir auszuspinnen,
Dienst und lohn, gewährung und verbot,
Von allen dingen ist nur dieses rot
Und weinen, daß die bilder immer fliehen,
Die in schöner finsternis gediehen –
Wann der kalte klare morgen droht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
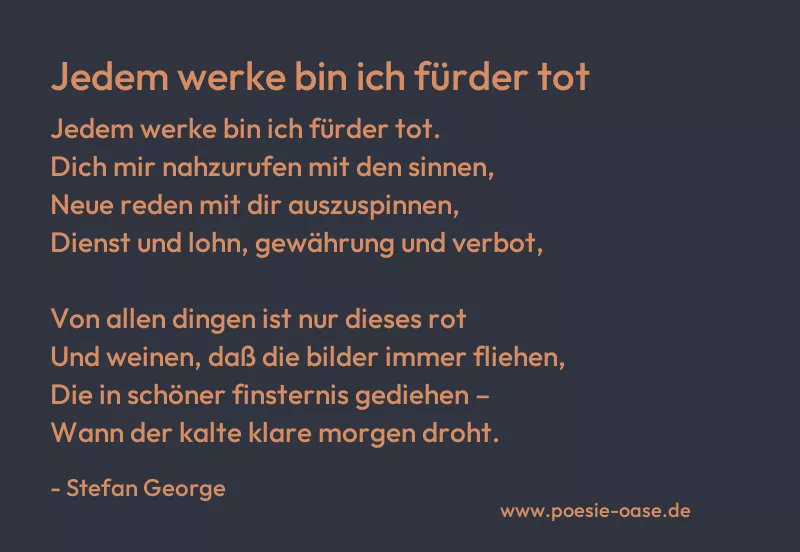
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Jedem Werke bin ich fürder tot“ von Stefan George reflektiert eine tiefe innere Entfremdung und den Abschied von schöpferischer Kraft. Bereits der erste Vers drückt eine radikale Distanz aus: Das lyrische Ich fühlt sich „tot“ gegenüber jeglichem Schaffen. Dies könnte auf eine kreative Erschöpfung, eine Resignation oder eine bewusste Abkehr von der Welt der Werke und der Kunst hindeuten. Der Wunsch, eine geliebte Person oder eine verlorene Inspiration erneut mit den Sinnen zu erfassen, neue Gespräche zu führen und sich im Wechselspiel von „Dienst und Lohn, Gewährung und Verbot“ zu bewegen, scheint nicht mehr möglich.
In der zweiten Strophe verengt sich die Wahrnehmung: Von „allen Dingen“ bleibt nur noch „dieses Rot“ – möglicherweise ein Symbol für eine intensive, aber schmerzvolle Erinnerung oder eine verbliebene Leidenschaft. Doch zugleich herrscht Wehmut, denn die „Bilder“ – Vorstellungen, Erinnerungen oder künstlerische Visionen – sind flüchtig. Sie entstehen in der „schönen Finsternis“, vielleicht in der Nacht, im Traum oder im unbewussten Bereich der Seele, doch sie verschwinden, sobald der „kalte klare Morgen droht“.
Das Gedicht beschreibt somit den Moment des Erwachens, in dem das Magische, Dunkel-Schöne verblasst und einer nüchternen Realität weicht. George schildert eine Welt, in der das schöpferische Feuer erlischt und die Träume des Unbewussten nicht in den Tag hinübergerettet werden können. Es bleibt nur die Erkenntnis des Verlusts – und die Melancholie über die Vergänglichkeit des Schönen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.