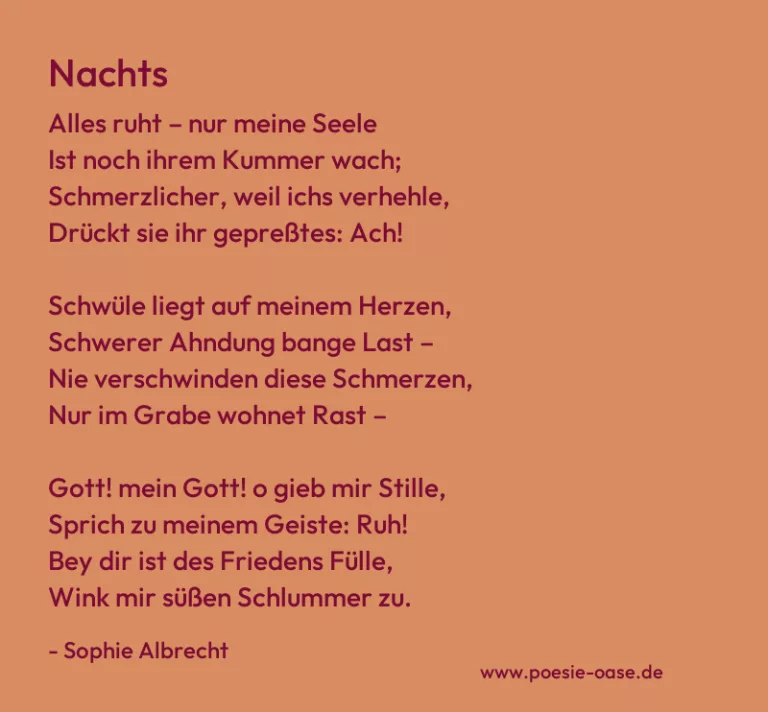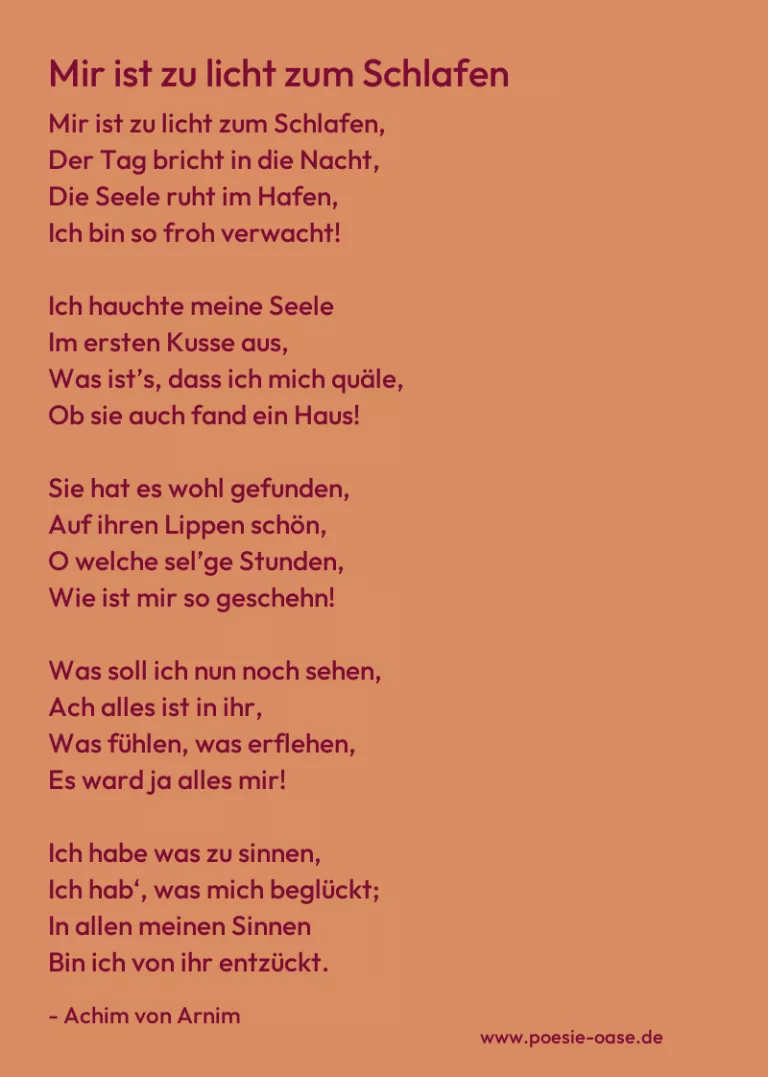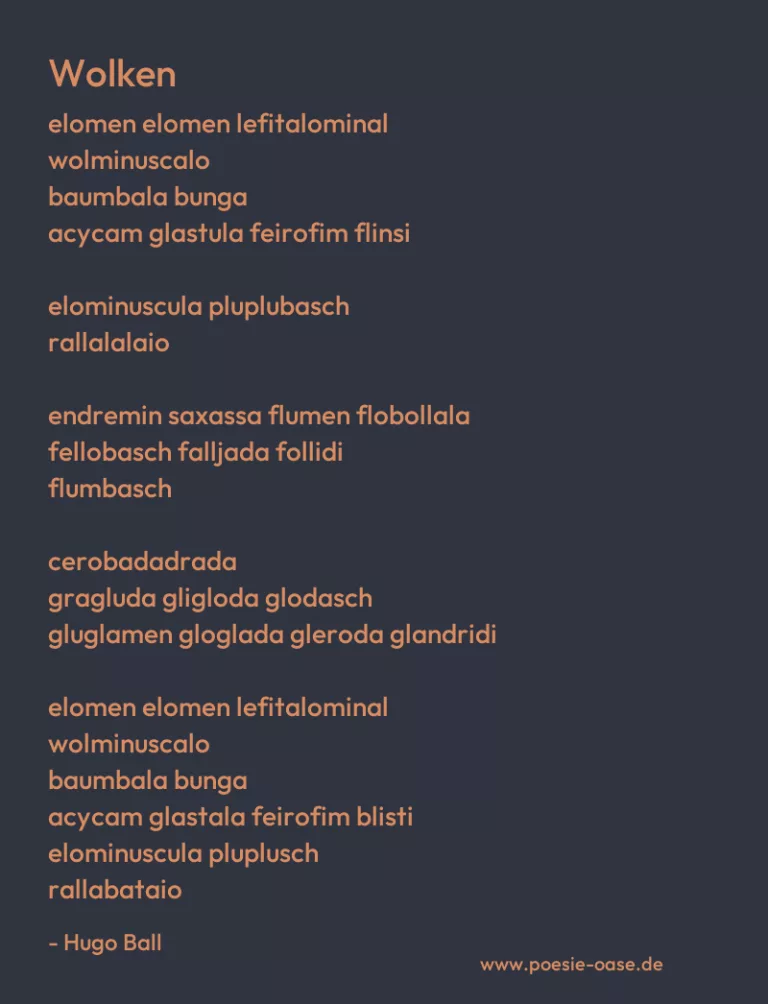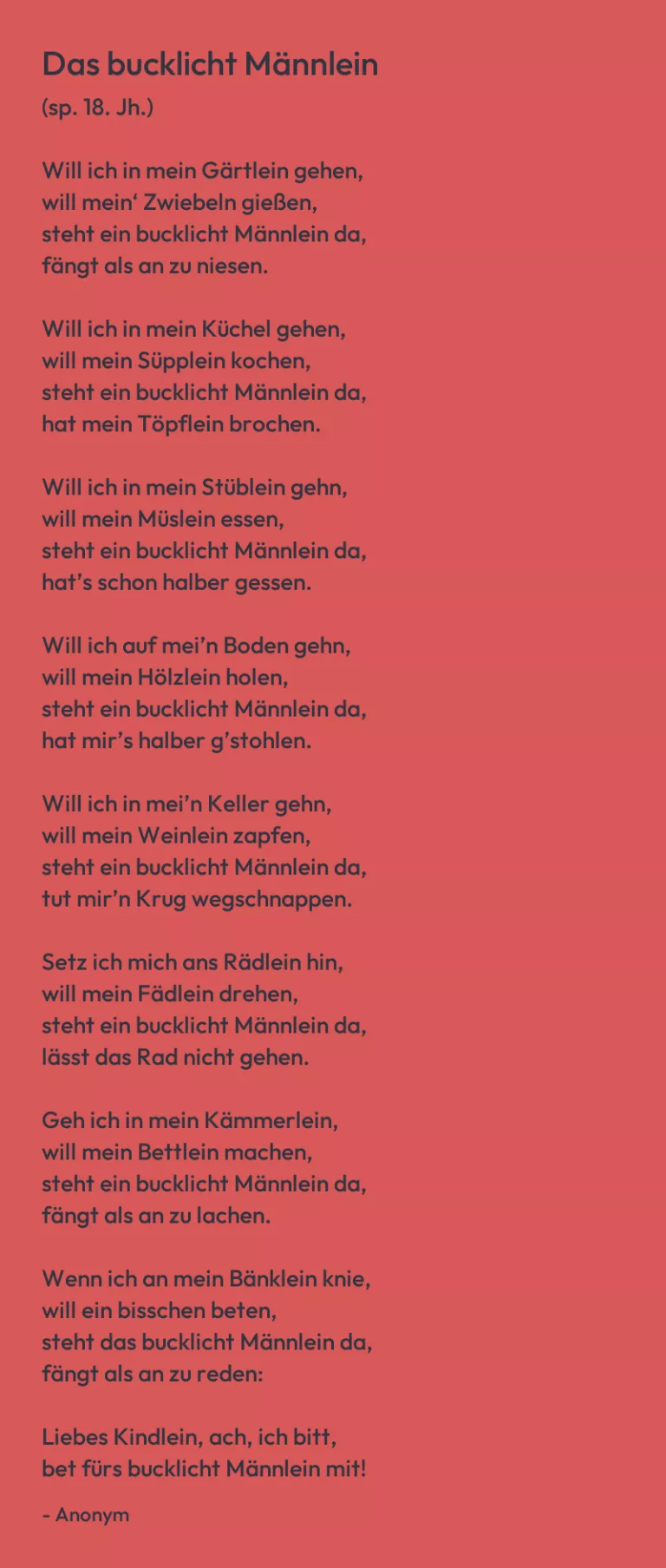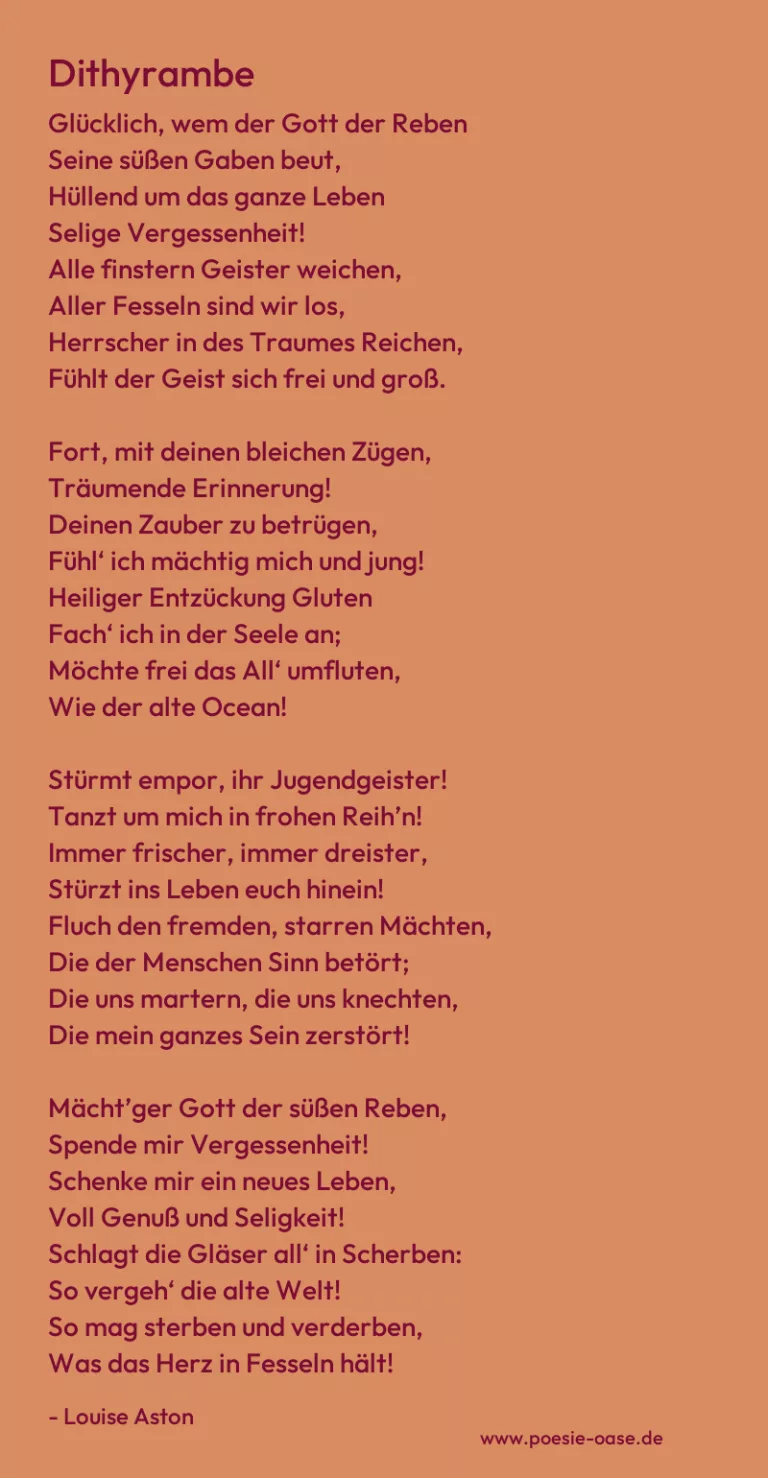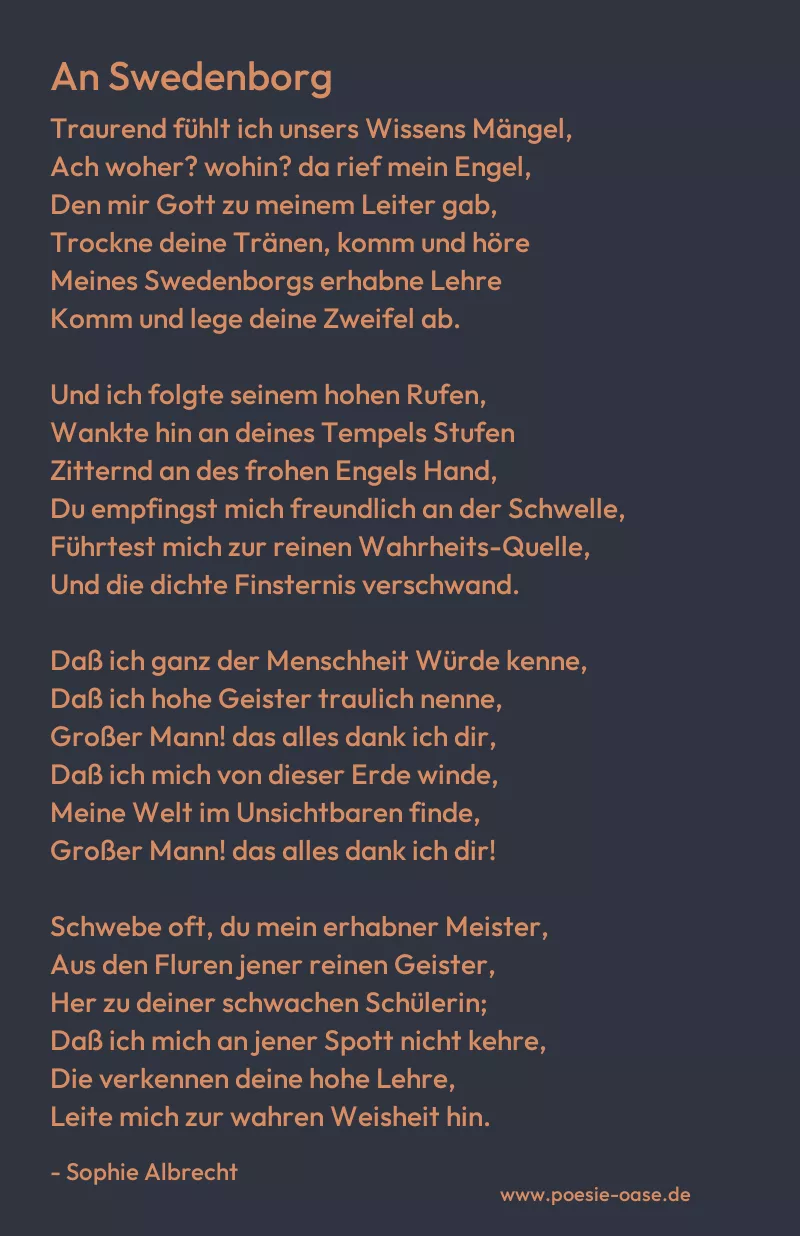An Swedenborg
Traurend fühlt ich unsers Wissens Mängel,
Ach woher? wohin? da rief mein Engel,
Den mir Gott zu meinem Leiter gab,
Trockne deine Tränen, komm und höre
Meines Swedenborgs erhabne Lehre
Komm und lege deine Zweifel ab.
Und ich folgte seinem hohen Rufen,
Wankte hin an deines Tempels Stufen
Zitternd an des frohen Engels Hand,
Du empfingst mich freundlich an der Schwelle,
Führtest mich zur reinen Wahrheits-Quelle,
Und die dichte Finsternis verschwand.
Daß ich ganz der Menschheit Würde kenne,
Daß ich hohe Geister traulich nenne,
Großer Mann! das alles dank ich dir,
Daß ich mich von dieser Erde winde,
Meine Welt im Unsichtbaren finde,
Großer Mann! das alles dank ich dir!
Schwebe oft, du mein erhabner Meister,
Aus den Fluren jener reinen Geister,
Her zu deiner schwachen Schülerin;
Daß ich mich an jener Spott nicht kehre,
Die verkennen deine hohe Lehre,
Leite mich zur wahren Weisheit hin.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
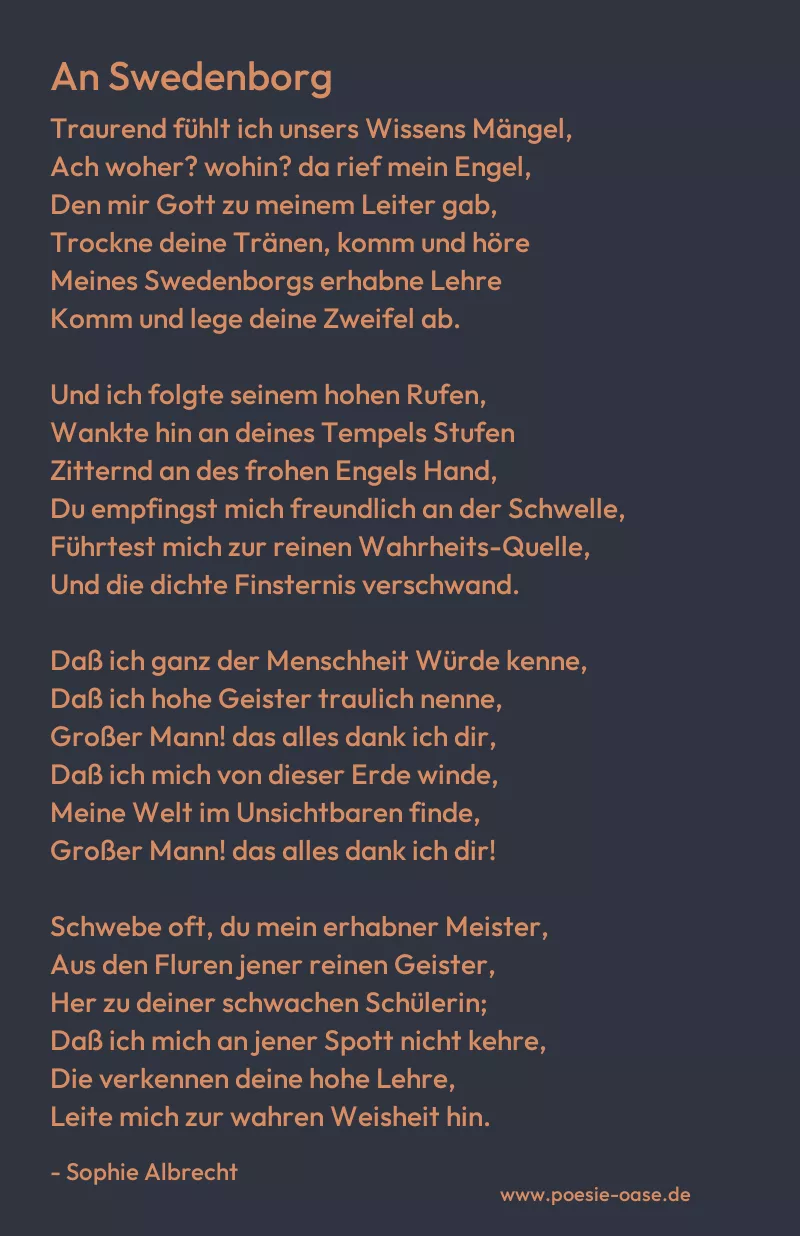
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An Swedenborg“ von Sophie Albrecht ist eine poetische Huldigung an den schwedischen Mystiker und Theosophen Emanuel Swedenborg, dessen Lehren dem lyrischen Ich offenbar tiefen Trost, geistige Orientierung und metaphysische Erkenntnis geschenkt haben. In einer Mischung aus persönlicher Danksagung und spirituellem Bekenntnis beschreibt die Sprecherin ihren Weg von der Trauer und Zweifel zur Erkenntnis und inneren Klarheit – ein Weg, der durch die Lektüre und Wirkung Swedenborgs ermöglicht wurde.
Bereits in der ersten Strophe wird die zentrale Sinnfrage thematisiert: „Ach woher? wohin?“ Diese Grundfragen menschlicher Existenz führen zur Verzweiflung – bis der Engel erscheint, der das Ich zur Lehre Swedenborgs ruft. Der Engel fungiert als Mittler zwischen der suchenden Seele und der göttlichen Weisheit, die in Swedenborgs Schriften verkörpert ist. Der Ruf, „Trockne deine Tränen“, markiert eine Wende vom Leid zur Hoffnung.
Die zweite Strophe schildert den Übergang von der Welt der Ungewissheit zur erhellenden Wahrheit. Das Bild vom Tempel steht dabei symbolisch für den Zugang zur höheren Erkenntnis. Die Unsicherheit und das „Zittern“ des Ichs verdeutlichen die emotionale Bedeutung dieses Schritts. Doch an der „Schwelle“ wird es freundlich empfangen und zur „reinen Wahrheits-Quelle“ geführt – eine bildhafte Umschreibung für die Swedenborg’sche Lehre, durch die „die dichte Finsternis verschwand“.
In der dritten Strophe wird deutlich, wie grundlegend dieser Erkenntnisweg für das Selbstverständnis des lyrischen Ichs ist. Es erkennt durch Swedenborg „ganz der Menschheit Würde“ und fühlt sich in eine geistige Gemeinschaft mit „hohen Geistern“ aufgenommen. Die materielle Welt wird relativiert, das eigentliche Zuhause liegt im „Unsichtbaren“. Die Dankbarkeit gegenüber Swedenborg wird fast verehrend formuliert – er erscheint als erhabener Lehrer, der das Leben auf eine höhere Stufe hebt.
Die abschließende Bitte an den „erhabnen Meister“, auch nach seinem Tod als geistiger Führer beizustehen, macht die tiefe Verbundenheit zwischen Sprecherin und Lehrer deutlich. Trotz des „Spotts“, den seine Lehren möglicherweise hervorrufen, bittet sie um seine Führung „zur wahren Weisheit“. Damit endet das Gedicht in einer Mischung aus Hingabe, spiritueller Ernsthaftigkeit und fast religiöser Verehrung.
„An Swedenborg“ ist damit nicht nur eine poetische Danksagung, sondern auch ein Ausdruck tief empfundenen spirituellen Suchens, das sich in mystisch-religiösem Denken aufgehoben fühlt. Sophie Albrecht verbindet persönliche Erfahrung mit metaphysischer Vision und schafft ein eindrucksvolles Zeugnis der Wirkung Swedenborgs auf ihre eigene Weltsicht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.