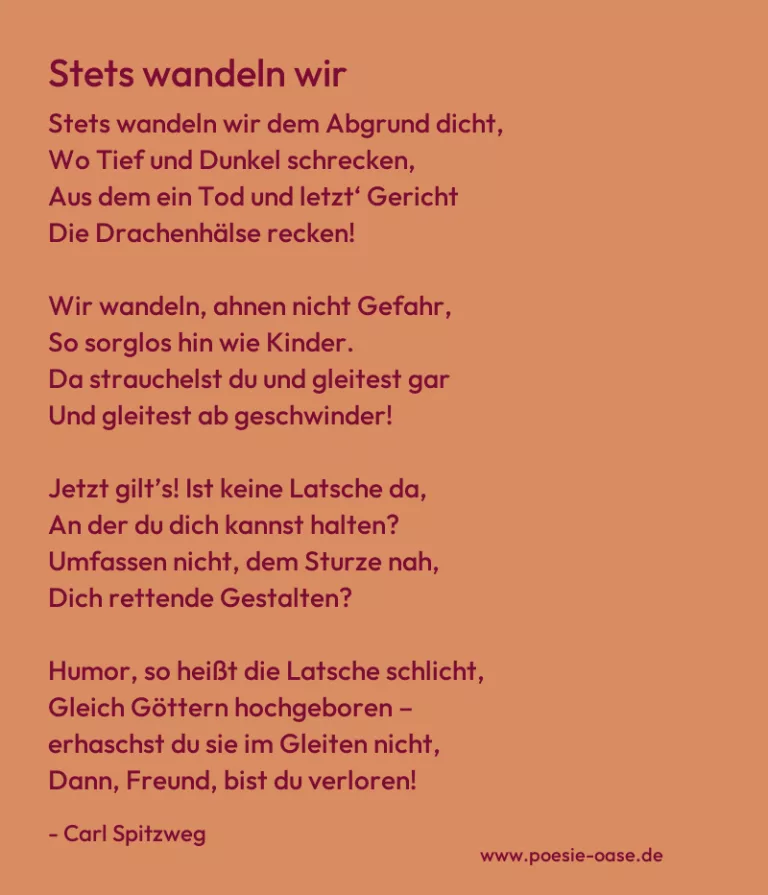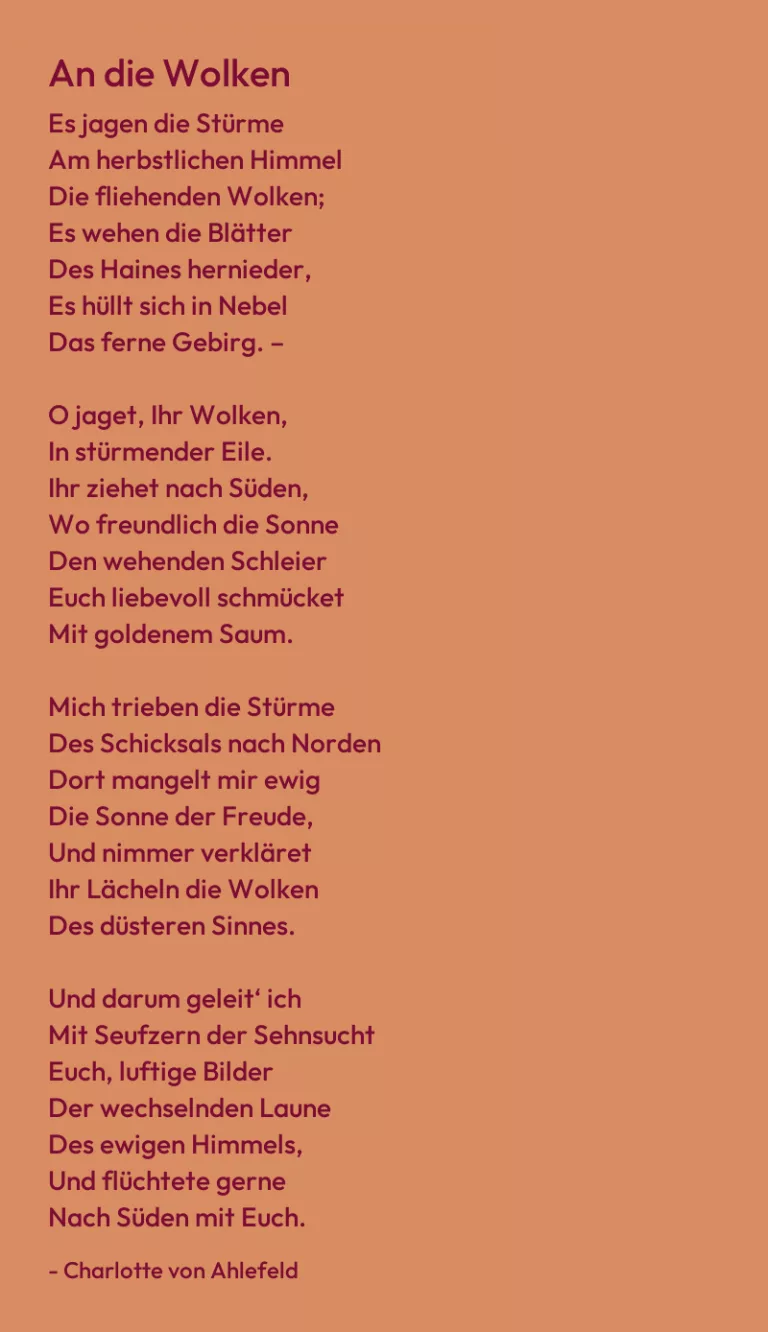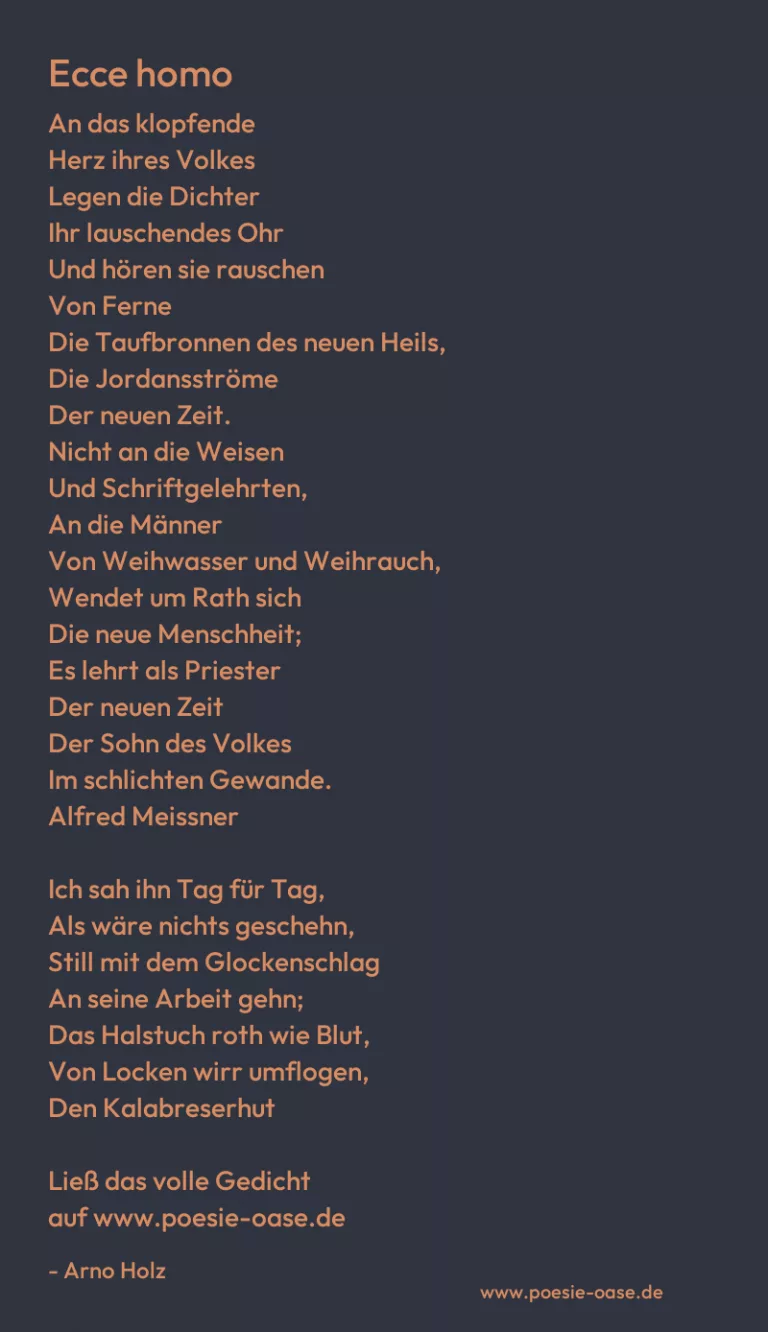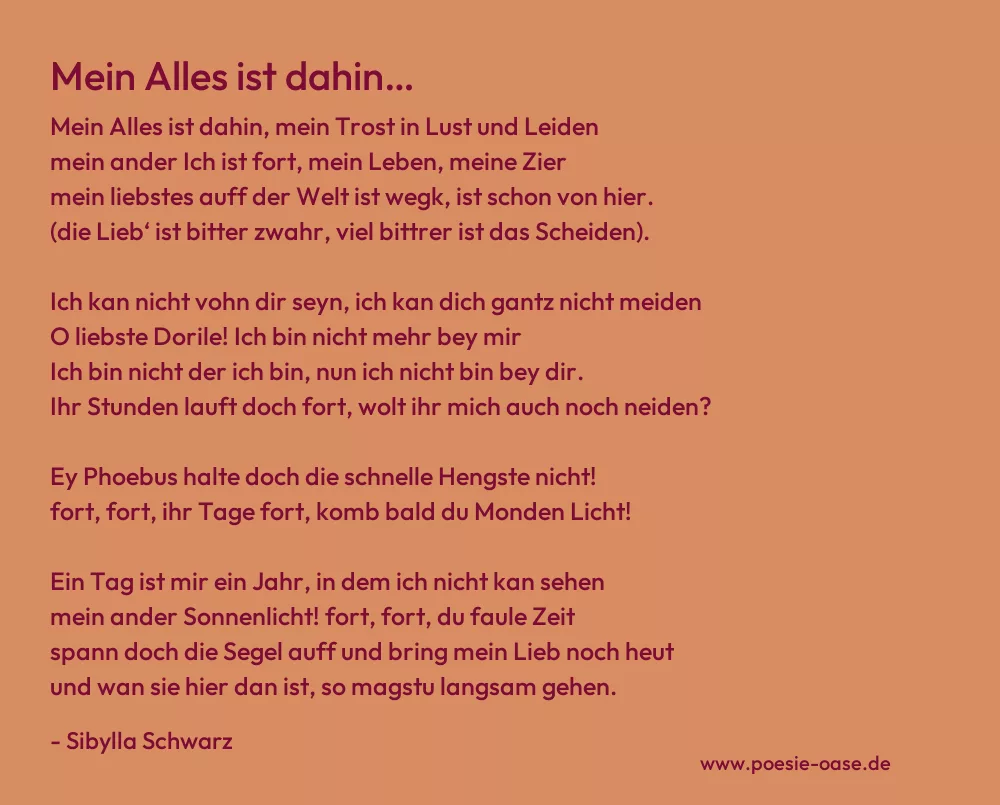Mein Alles ist dahin…
Mein Alles ist dahin, mein Trost in Lust und Leiden
mein ander Ich ist fort, mein Leben, meine Zier
mein liebstes auff der Welt ist wegk, ist schon von hier.
(die Lieb‘ ist bitter zwahr, viel bittrer ist das Scheiden).
Ich kan nicht vohn dir seyn, ich kan dich gantz nicht meiden
O liebste Dorile! Ich bin nicht mehr bey mir
Ich bin nicht der ich bin, nun ich nicht bin bey dir.
Ihr Stunden lauft doch fort, wolt ihr mich auch noch neiden?
Ey Phoebus halte doch die schnelle Hengste nicht!
fort, fort, ihr Tage fort, komb bald du Monden Licht!
Ein Tag ist mir ein Jahr, in dem ich nicht kan sehen
mein ander Sonnenlicht! fort, fort, du faule Zeit
spann doch die Segel auff und bring mein Lieb noch heut
und wan sie hier dan ist, so magstu langsam gehen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
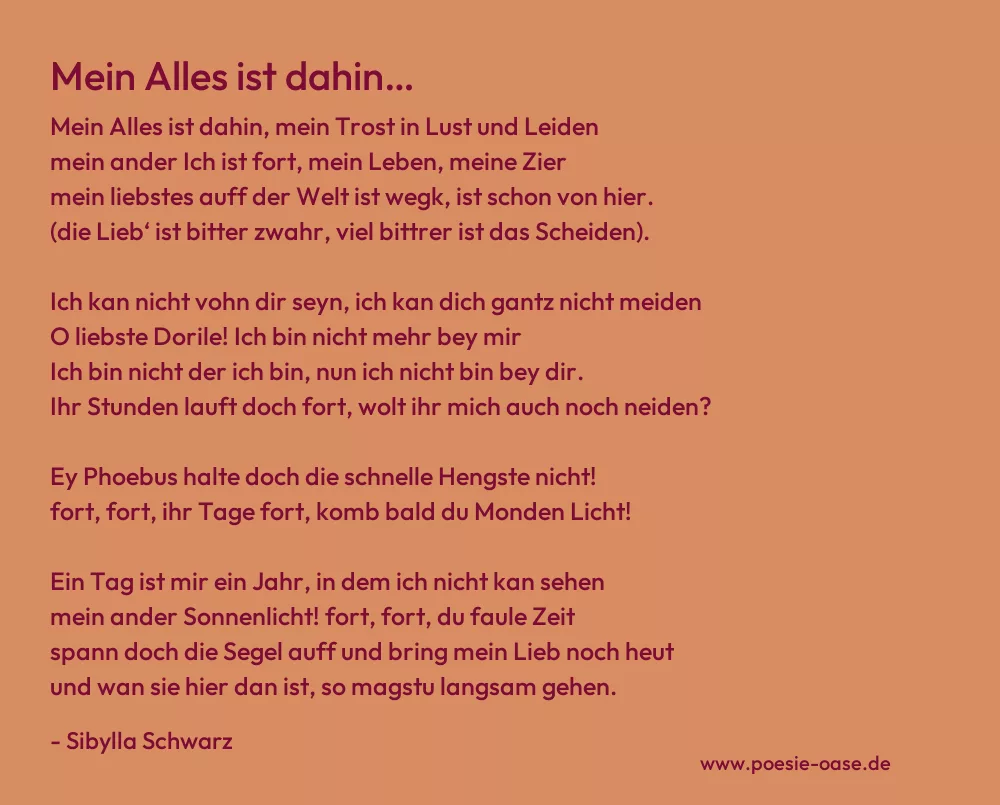
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Mein Alles ist dahin…“ von Sibylla Schwarz ist eine klagende Reflexion über Verlust, Sehnsucht und die unerträgliche Entfernung von der geliebten Person. Zu Beginn drückt die Dichterin ihre tiefe Trauer aus, indem sie feststellt, dass ihr „Alles“ – der Trost, die Freude und das Leben – verloren sind. Der Verlust wird als mehr als nur der Abwesenheit einer geliebten Person dargestellt; er ist das Verschwinden eines Teils des Selbst, das mit der Liebe und der Nähe zu dieser Person verbunden war. Das „ander Ich“ wird metaphorisch als die Hälfte ihres Selbst beschrieben, die durch den Verlust abwesend ist. Die Liebe ist „bitter“, aber das Scheiden wird als noch schmerzlicher empfunden.
In der zweiten Strophe betont die Sprecherin ihre innere Zerrissenheit und das Gefühl der Orientierungslosigkeit. Sie kann nicht bei der Geliebten sein und gleichzeitig auch nicht von ihr loslassen. Ihre Identität ist aus den Fugen geraten: „Ich bin nicht der ich bin“, da sie sich nur als vollständig erlebt, wenn sie bei ihrer „liebsten Dorile“ ist. Es wird eine tiefe Sehnsucht nach Wiedervereinigung ausgedrückt, die mit einem inneren Schmerz und einem Gefühl der Entfremdung verbunden ist. Der Übergang der Zeit wird hier als Qual dargestellt, die die Dichterin nicht erträgt.
Die dritte Strophe enthält eine eindringliche Bitte an „Phoebus“, den Sonnengott, die Zeit anzuhalten oder zu verlangsamen, um den Schmerz der Trennung zu lindern. „Phoebus halte doch die schnelle Hengste nicht“ ist ein dramatischer Appell, die Zeit anzuhalten und den Lauf der Tage zu verzögern, damit die geliebte Person schneller zurückkehrt. Der Wunsch, die Zeit zu überlisten, zeigt die Verzweiflung und die Unfähigkeit der Sprecherin, mit der Trennung umzugehen. Der Verweis auf den Mond („Komm bald du Monden Licht“) verstärkt das Gefühl der Dunkelheit und des Wartens.
Am Ende des Gedichts zeigt sich die tiefe Verzweiflung und der unerbittliche Drang nach Wiedervereinigung. Ein einzelner Tag ohne die geliebte Person erscheint wie ein ganzes Jahr, was die Schmerzlichkeit der Trennung unterstreicht. Der Wunsch nach einer schnellen Rückkehr der Geliebten und der Bitte, dass die Zeit „langsam gehen“ möge, wenn sie erst wieder vereint sind, spiegelt den unaufhörlichen Wunsch nach Erfüllung und Liebe wider. Es ist ein Gedicht von tiefer emotionaler Spannung, in dem die Zeit als Feind und die Trennung als unerträglicher Zustand wahrgenommen wird.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.