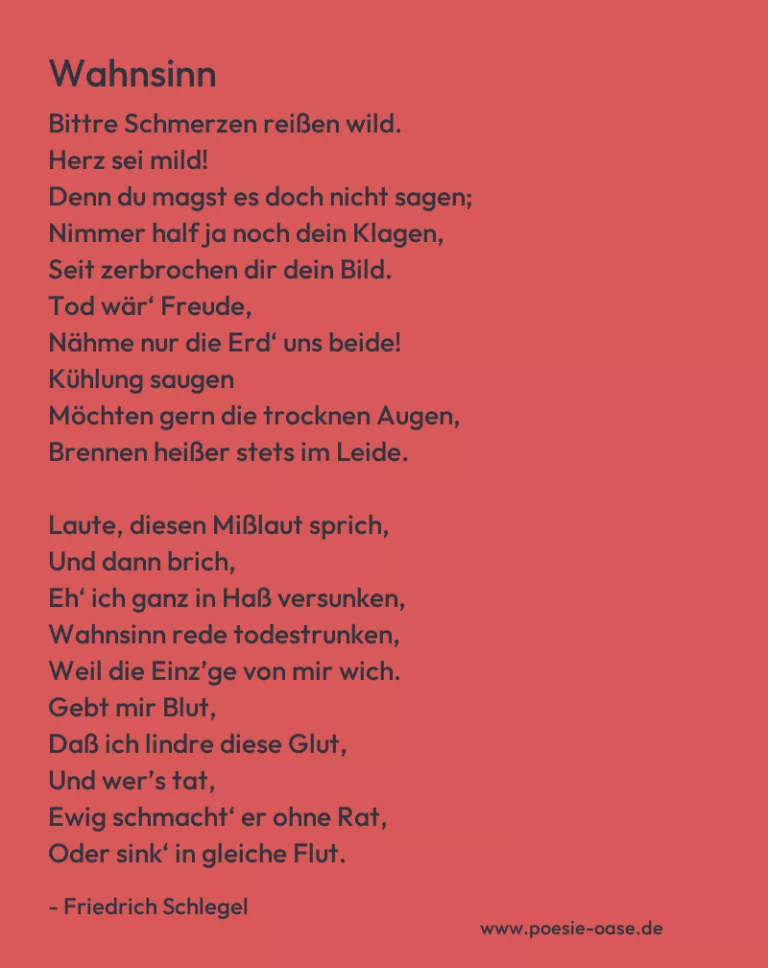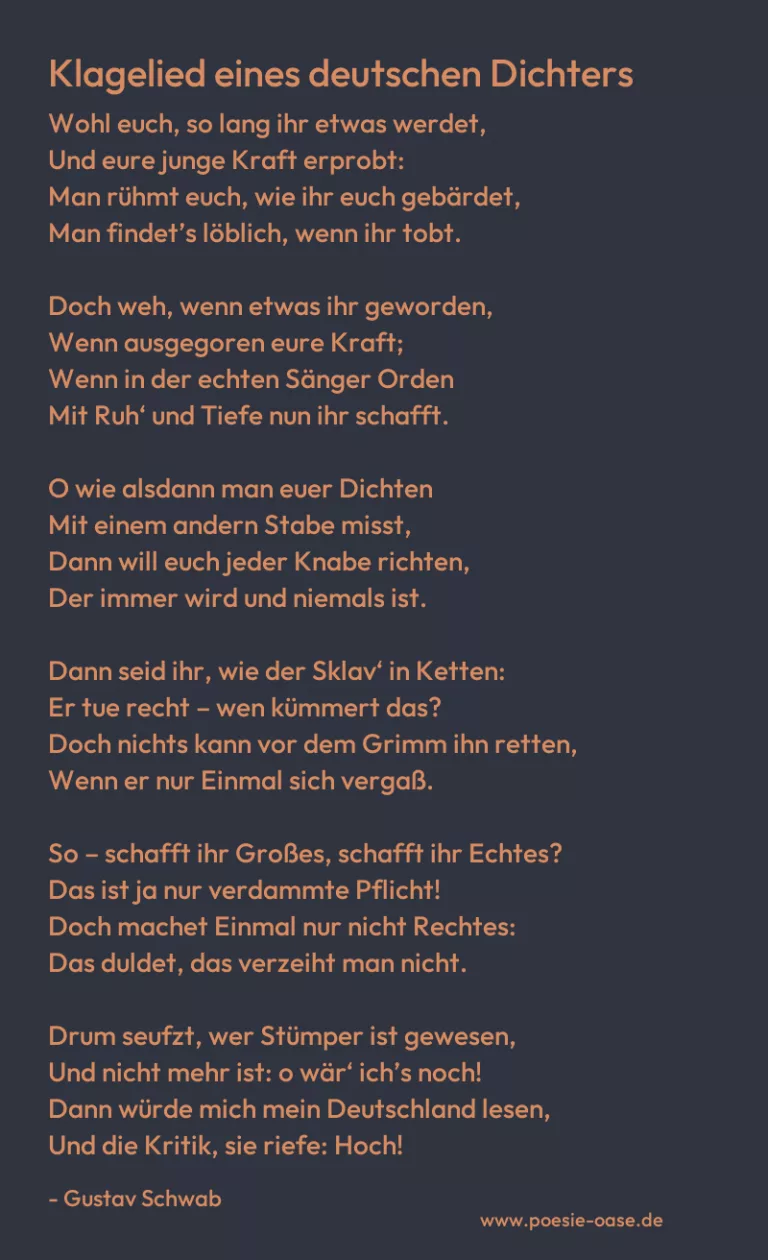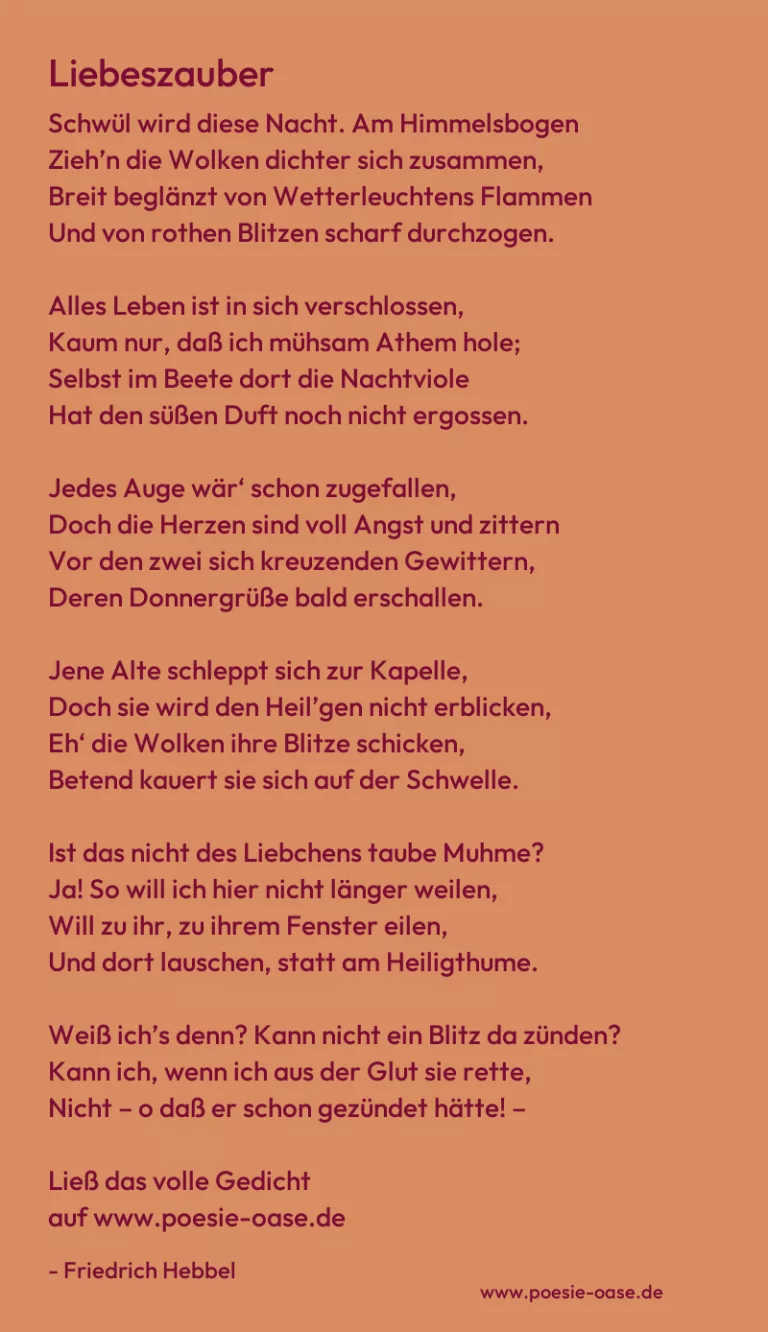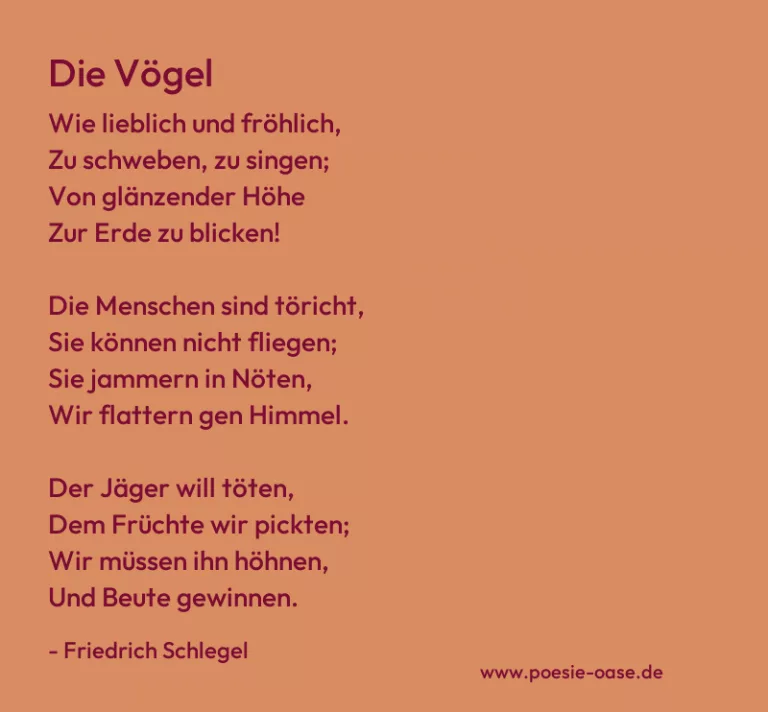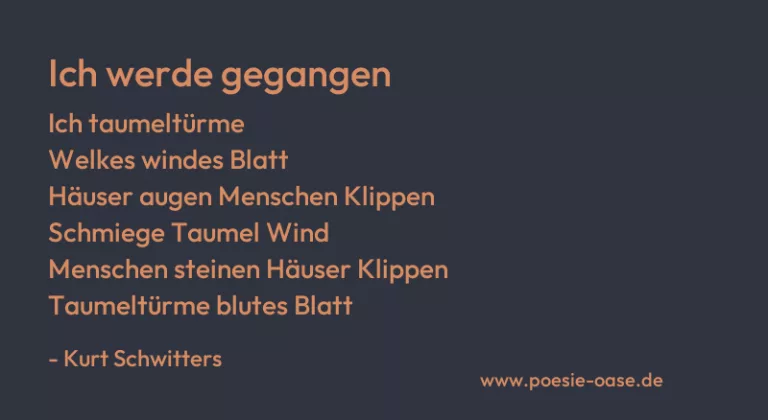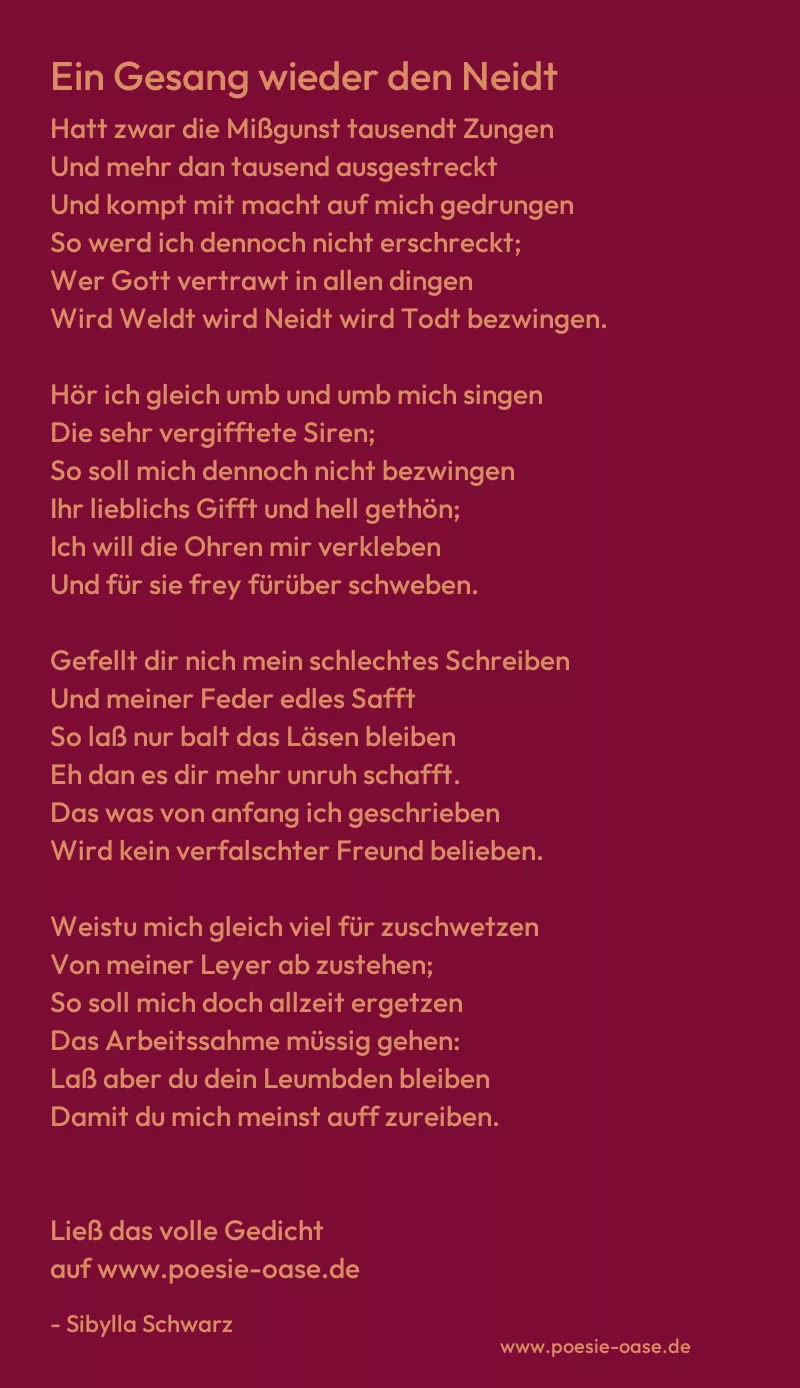Hatt zwar die Mißgunst tausendt Zungen
Und mehr dan tausend ausgestreckt
Und kompt mit macht auf mich gedrungen
So werd ich dennoch nicht erschreckt;
Wer Gott vertrawt in allen dingen
Wird Weldt wird Neidt wird Todt bezwingen.
Hör ich gleich umb und umb mich singen
Die sehr vergifftete Siren;
So soll mich dennoch nicht bezwingen
Ihr lieblichs Gifft und hell gethön;
Ich will die Ohren mir verkleben
Und für sie frey fürüber schweben.
Gefellt dir nich mein schlechtes Schreiben
Und meiner Feder edles Safft
So laß nur balt das Läsen bleiben
Eh dan es dir mehr unruh schafft.
Das was von anfang ich geschrieben
Wird kein verfalschter Freund belieben.
Weistu mich gleich viel für zuschwetzen
Von meiner Leyer ab zustehen;
So soll mich doch allzeit ergetzen
Das Arbeitssahme müssig gehen:
Laß aber du dein Leumbden bleiben
Damit du mich meinst auff zureiben.
Ich weiß es ist dir angebohren
Den Musen selbst abholt zu sein
Doch hat mein Phoebus nie verlohren
Durch deine List den hellen Schein:
Die Tugend wird dennoch bestehen
Wen du und alles wirst vergehen.
Vermeynstu daß nicht recht getroffen
Daß auch dem weiblichen Geschlecht
Der Pindus allzeit frey steht offen
So bleibt es dennoch gleichwohl recht
Daß die so nur mit Demuth kommen
Von Phoebus werden angenommen.
Ich darf nun auch nicht weitergehen
Und bringen starcke Zeugen ein;
Du kanst es gnug an disem sehen
Daß selbst die Musen Mägde sein:
Was lebet soll ja Tugendt lieben
Und niemand ist davon vertrieben
Gantz Holland weiß dir für zusagen
Von seiner Bluhmen Tag und Nacht;
Herrn Catzen magstu weiter fragen
Durch den sie mir bekannt gemacht:
Cleobulina wird wol bleiben
Von der viel kluge Federn schreiben.
Was Sappho für ein Weib gewesen
Von vielen die ich dir nicht nenn
Kanstu bey andern weiter lesen
Von den ich acht und fünffzig kenn
Die nimmer werden untergehen
Und bey den liechten Sternen stehen.
Sollt ich die Nadel hoch erheben
Und über meine Poesey
So muß ein Kluger mir nachgeben
Daß alles endlich reisst entzwey;
Wer kan so künstlich Garn auch drehen
Das es nicht sollt in Stücken gehen?
Bringt alles her auß allen Enden
Was je von Menschen ist bedacht
Was mit so klugen Meister Händen
Ist jemahls weit und breit gemacht
Und laß es tausend Jahre stehen
So wird es von sich selbst vergehen.
Wo ist Dianen Kirch geblieben?
Des Jupters Bild ist schon davon;
Sind nicht vorlengst schon auffgerieben
die dicken Mauren Babilon?
Was damahls teuer gnug gegolten
Wird jetzt für Asch und Staub gescholten.
Doch daß was Naso hat geschrieben
Was Aristoteles gesagt
Ist heut bey uns noch überblieben
Und wird auch nicht ins Grab gejagt
Sie leben stets und sind gestorben
Und haben ewigs Lob erworben.
Was uns die Schar der Klugen lehret
Wird heut noch der Feder Macht
Auff Fama Pfeiffen angehöret
Und uns zur Nachricht fürgebracht
Ihr Lob wird weit und breit erschallen
Bis alles wird zu Boden fallen.
Laß nur O Neid! dein Leumbden bleiben
Ich weiß es ohn dich mehr als wol
Wen ich nicht mehr Poetisch schreiben
Undt dieses hinterlassen soll.
Ich wil mich in die Zeit wol schicken
Du solt mich doch nicht unterdrücken.
Ich wil hinfüro GOTT vertrawen
Von dem soll sein mein Tichten all
So kan mich auch für dir nicht grawen
Drum sag ich billig noch einmahl:
Wer GOTT vertrawt in allen Dingen
Wird Weldt wird Neidt wird Todt bezwingen.