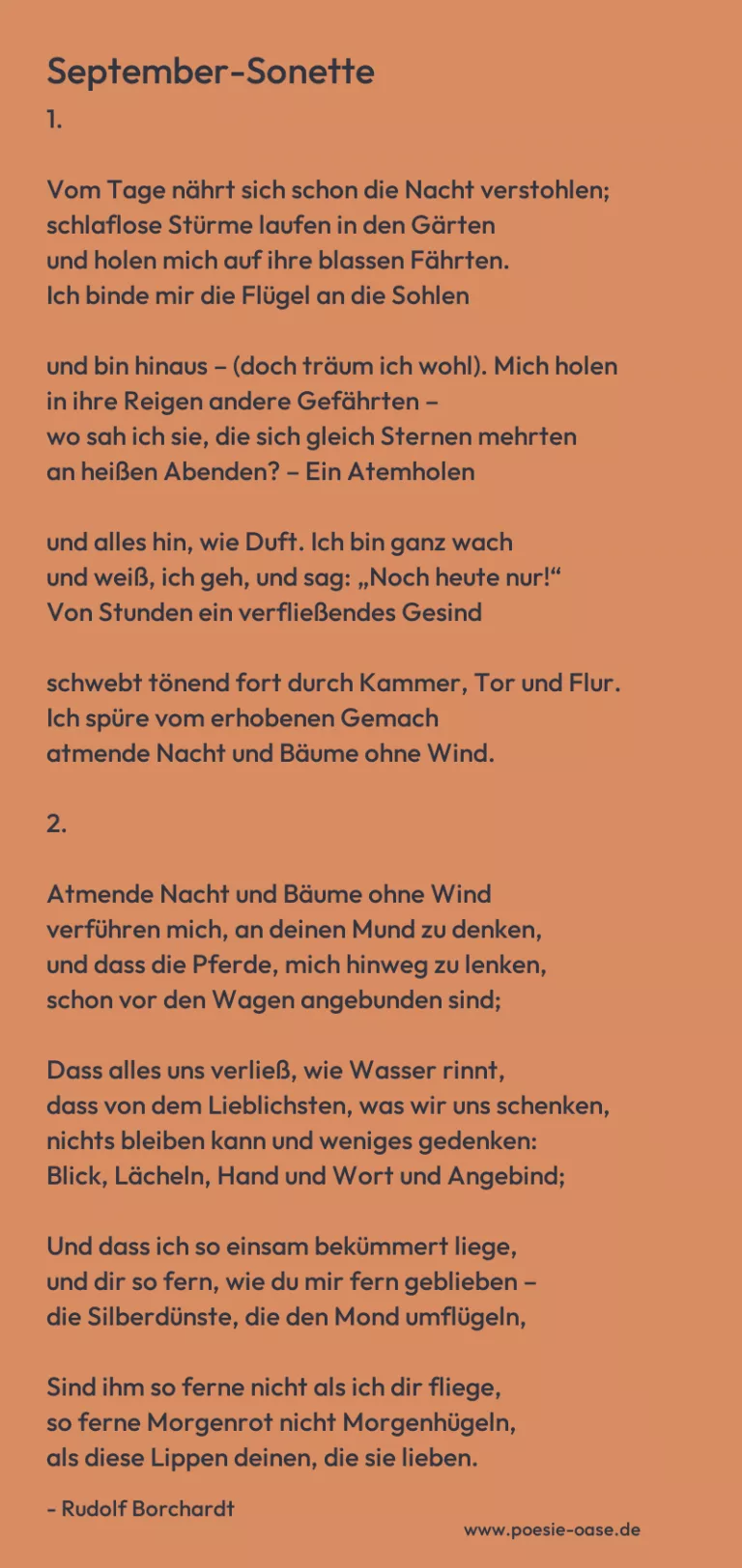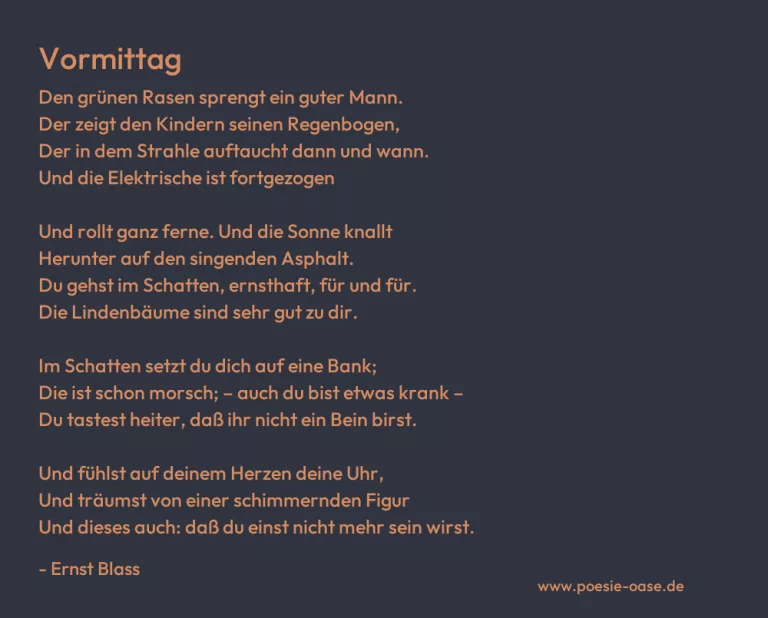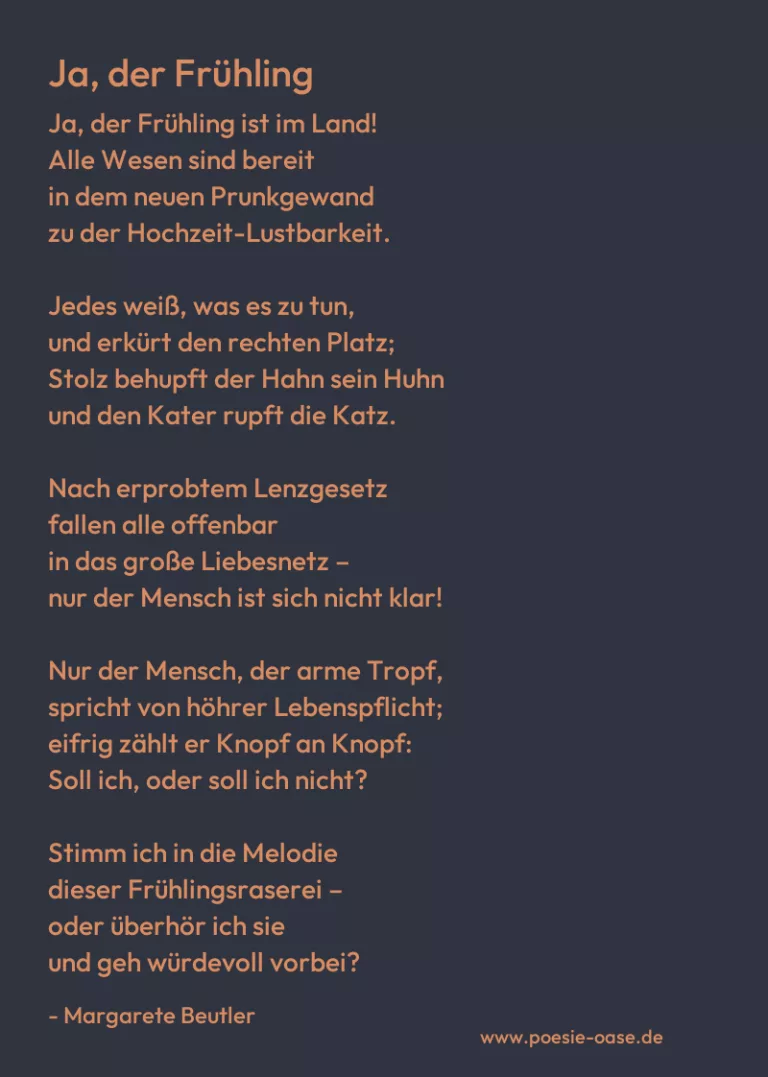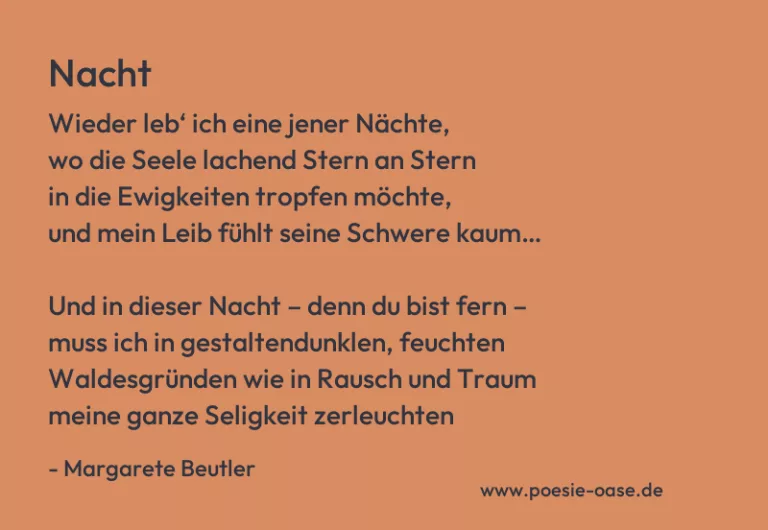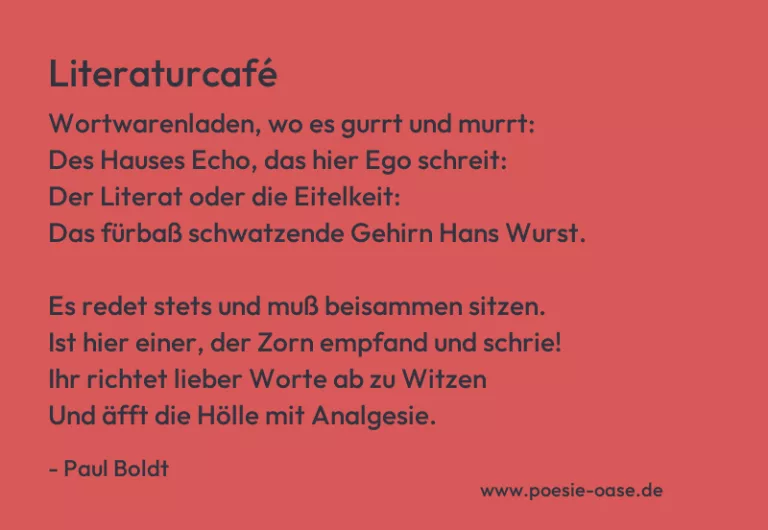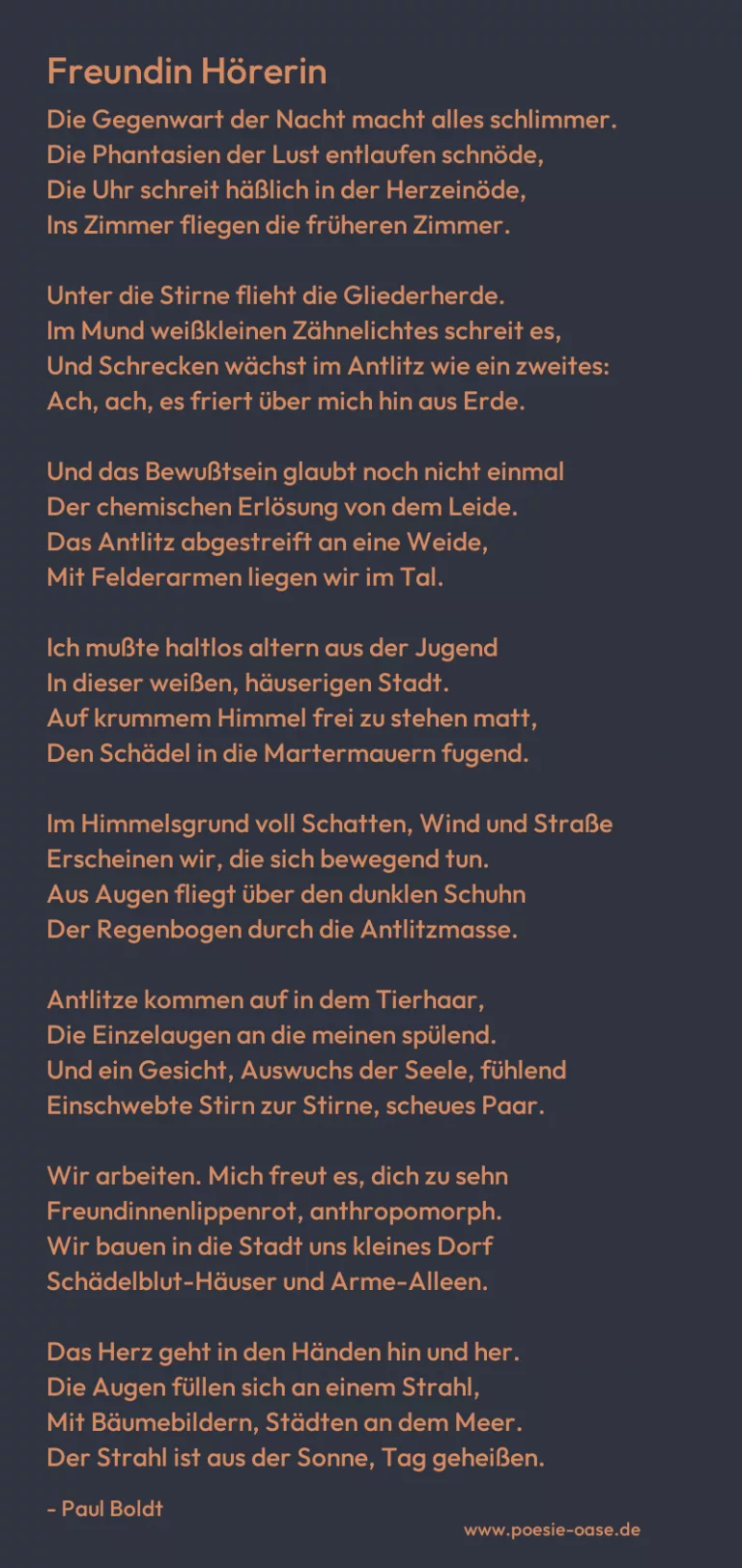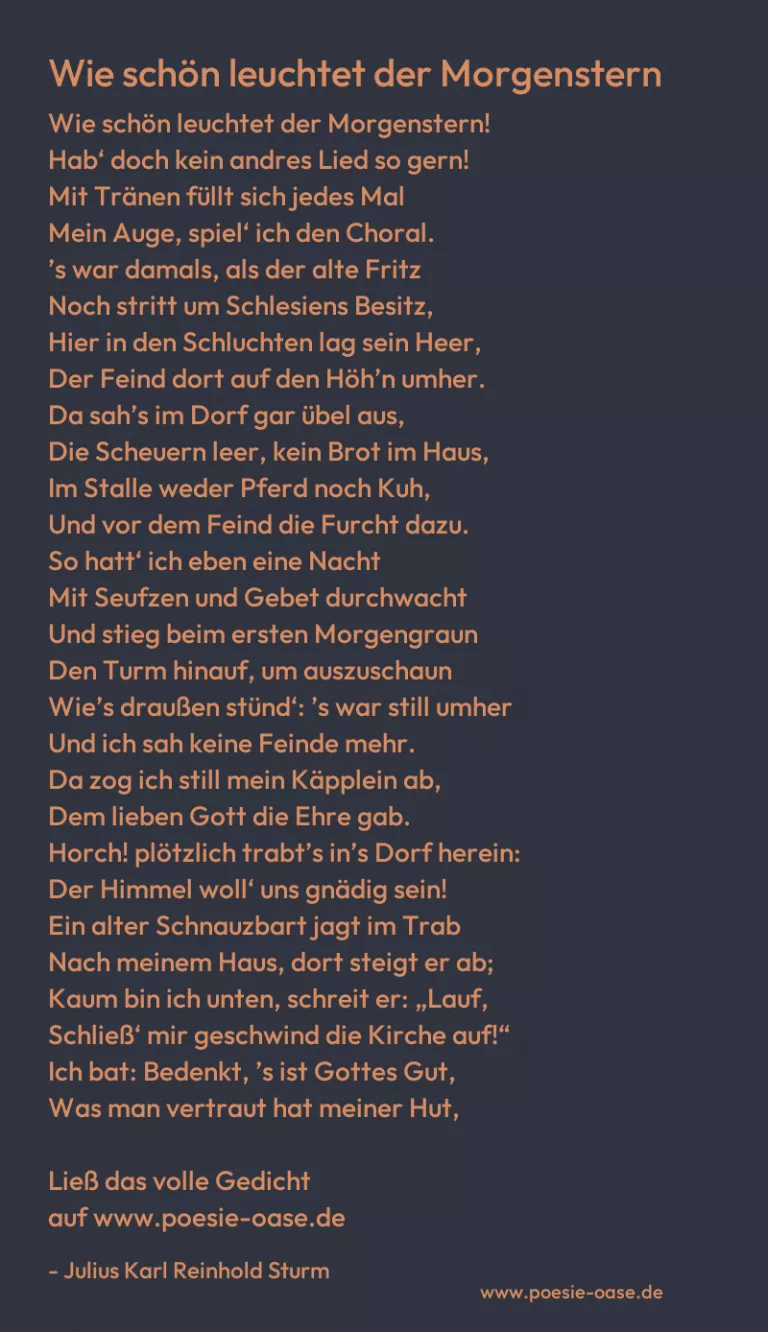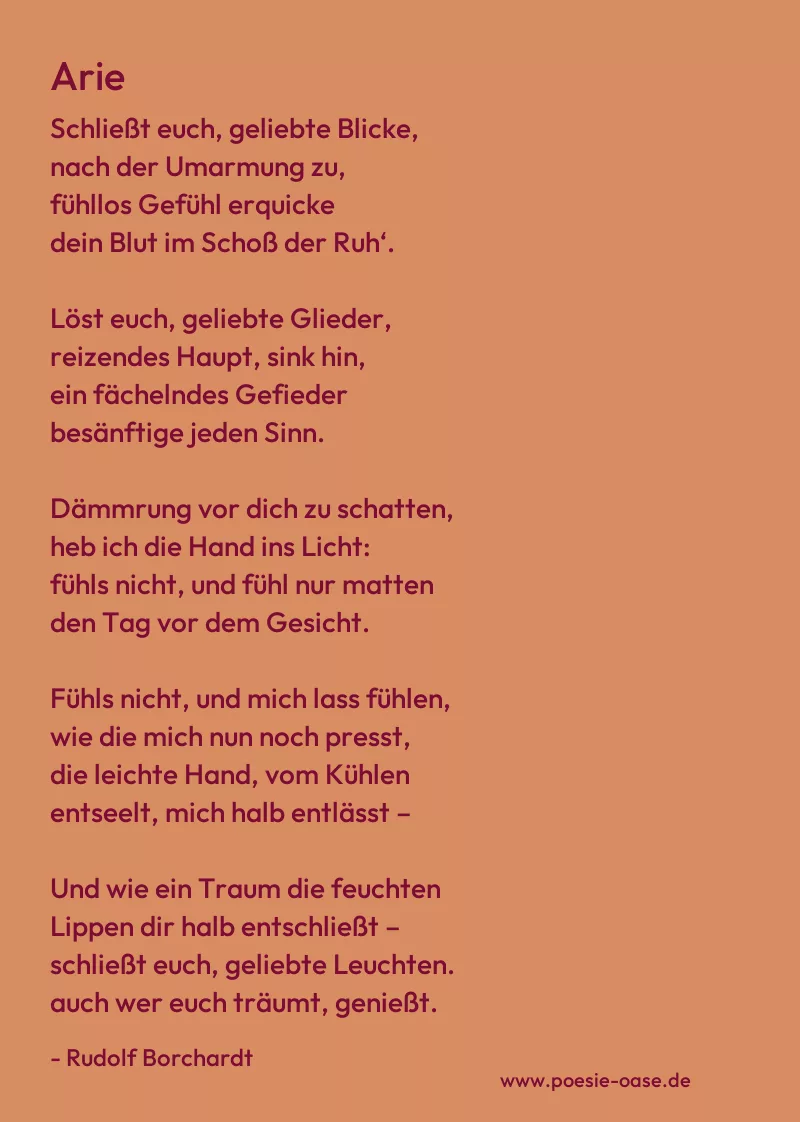Arie
Schließt euch, geliebte Blicke,
nach der Umarmung zu,
fühllos Gefühl erquicke
dein Blut im Schoß der Ruh‘.
Löst euch, geliebte Glieder,
reizendes Haupt, sink hin,
ein fächelndes Gefieder
besänftige jeden Sinn.
Dämmrung vor dich zu schatten,
heb ich die Hand ins Licht:
fühls nicht, und fühl nur matten
den Tag vor dem Gesicht.
Fühls nicht, und mich lass fühlen,
wie die mich nun noch presst,
die leichte Hand, vom Kühlen
entseelt, mich halb entlässt –
Und wie ein Traum die feuchten
Lippen dir halb entschließt –
schließt euch, geliebte Leuchten.
auch wer euch träumt, genießt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
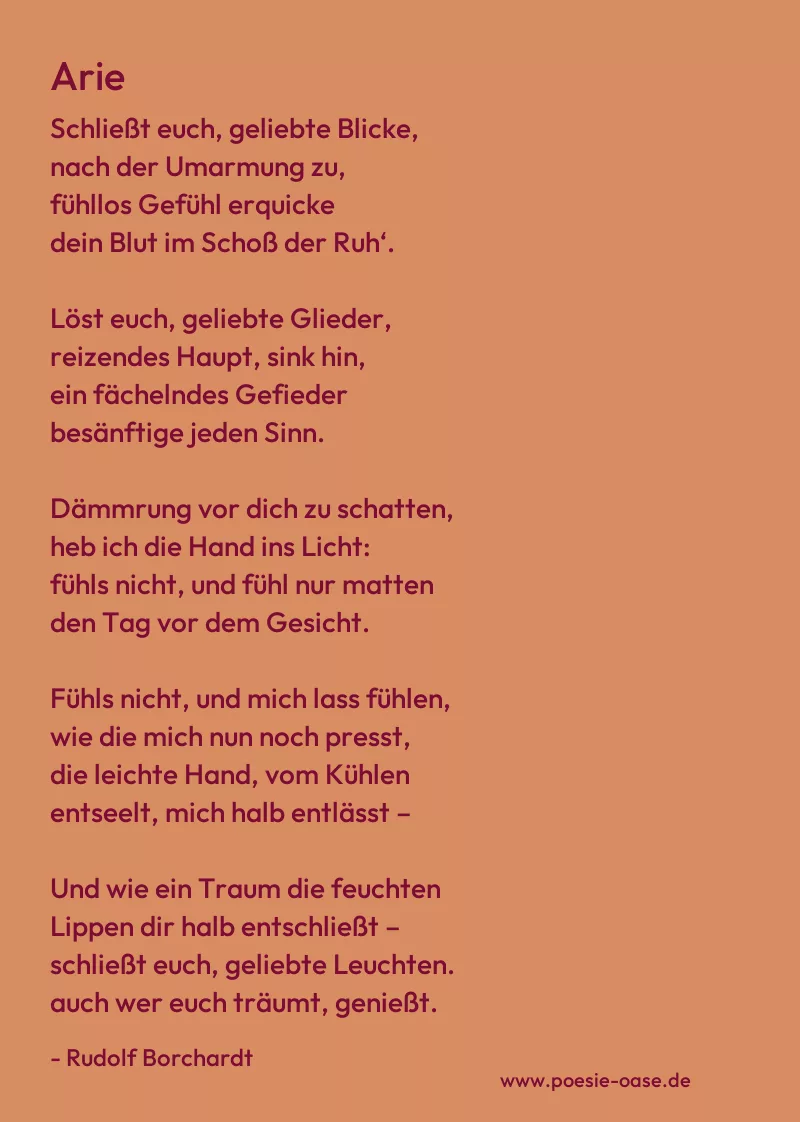
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Arie“ von Rudolf Borchardt beschreibt eine Art von emotionaler und körperlicher Distanzierung, die im Spannungsfeld zwischen Leidenschaft und Entfremdung stattfindet. Es ist eine nahezu gesangliche Meditation über den Moment des Loslassens und des Übergangs von intensiven Gefühlen zu einer kühleren, distanzierten Wahrnehmung. Die erste Strophe eröffnet mit einer Bitte an die „geliebten Blicke“, sich nach der „Umarmung“ zu schließen, was den Akt der Trennung und des Rückzugs einführt. Das „fühllos Gefühl“ soll den Körper erfrischen und in „der Ruh‘“ den inneren Frieden wiederherstellen – eine paradoxe Mischung aus Nähe und Distanz, die das Gedicht durchzieht.
In der zweiten Strophe erfolgt eine weitere Trennung, diesmal in Form des Körpers. Die „geliebten Glieder“ lösen sich, das „reizende Haupt“ sinkt hin, und ein „fächelndes Gefieder“ soll die Sinne besänftigen. Der Körper wird hier fast wie ein sensibles, federleichtes Wesen behandelt, das sich von der intensiven Emotion zurückzieht und Ruhe findet. Das Bild des „Gefieders“ verstärkt den Eindruck von Zartheit und Sanftheit, während die Aufforderung, die Sinne zu beruhigen, eine Art von innerer Einkehr und Ablösung beschreibt.
In der dritten Strophe wird die „Dämmrung“ als eine Art Übergangszustand genutzt, in dem das lyrische Ich eine symbolische Geste vollzieht: Es hebt die Hand ins Licht, um „nicht zu fühlen“, sondern nur eine matte Wahrnehmung des „Tages vor dem Gesicht“ zu haben. Die Lichtgeste scheint eine Art Ritual zu sein, um sich von den intensiven Gefühlen zu befreien und in einen Zustand der Abwesenheit zu treten. Der Wunsch, nicht zu fühlen, aber dennoch zu existieren, spiegelt den inneren Konflikt zwischen der Sehnsucht nach emotionaler Distanz und dem Bedürfnis nach intensiver Erfahrung wider.
Die letzten beiden Strophen vertiefen dieses Spiel mit Entfremdung und Gefühl. Die „leichte Hand“ drückt das lyrische Ich halb aus seiner eigenen Welt, entlässt es aus dem emotionalen Moment. Es gibt eine Anspielung auf einen Traumzustand, in dem die „feuchten Lippen“ sich fast wie ein geheimnisvolles, unvollständiges Versprechen schließen. Auch hier bleibt eine Mischung aus Nähe und Distanz bestehen: Der Wunsch, sich zu entziehen, steht im Gegensatz zur Erinnerung an die innere Erregung und den Genuss des Moments. Das Gedicht endet mit der Vorstellung, dass auch im Traum, in der Entfremdung, das „Leuchten“ der Liebe oder des Begehrens noch in einem Zustand der Genießbarkeit verweilen kann.
Borchardt gelingt es, in „Arie“ das Thema der Entfremdung von intensiven Gefühlen zu behandeln, indem er zwischen Nähe und Distanz schwankt und die körperliche sowie emotionale Trennung auf poetische Weise darstellt. Das Gedicht handelt von der Spannung zwischen dem Verlangen nach Nähe und der Sehnsucht nach einem gefühlten Rückzug, wobei es die Dämmerung zwischen diesen beiden Zuständen als den wahren Ort der emotionalen Erfahrung beschreibt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.