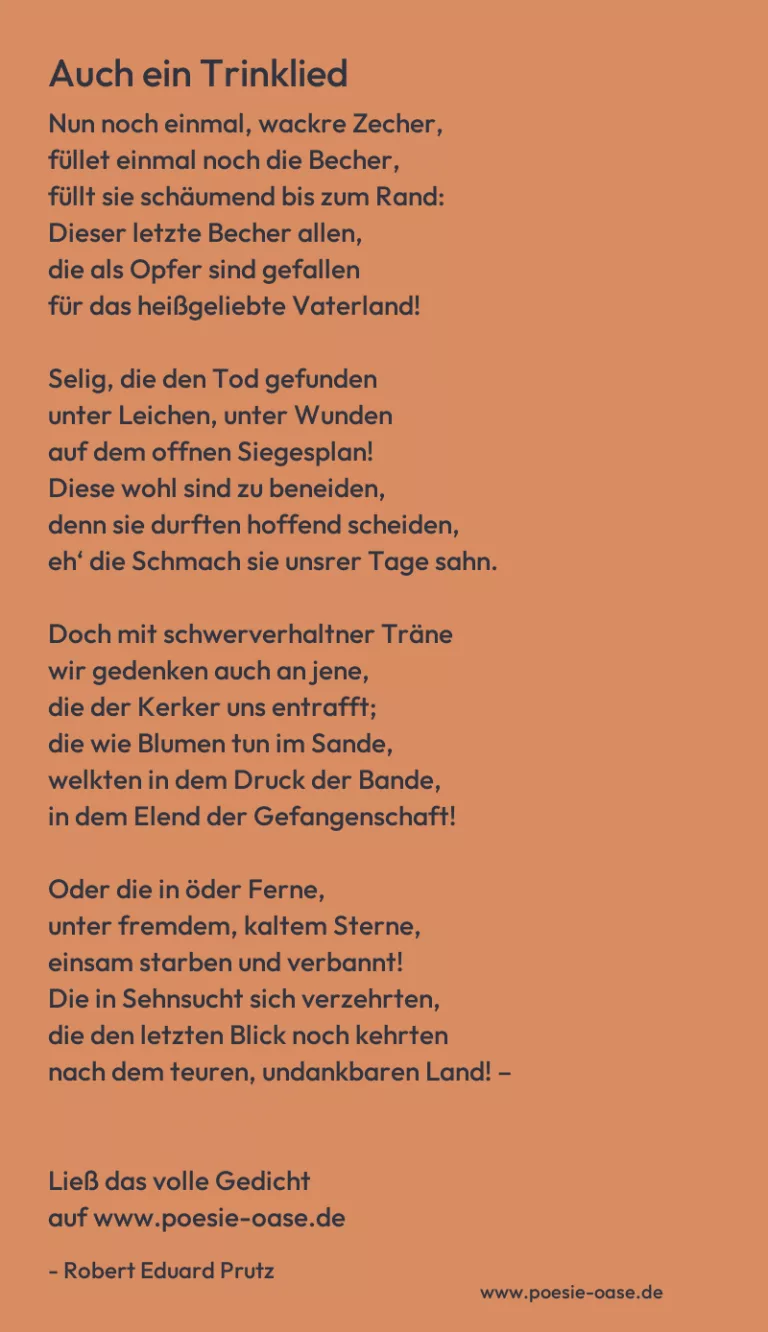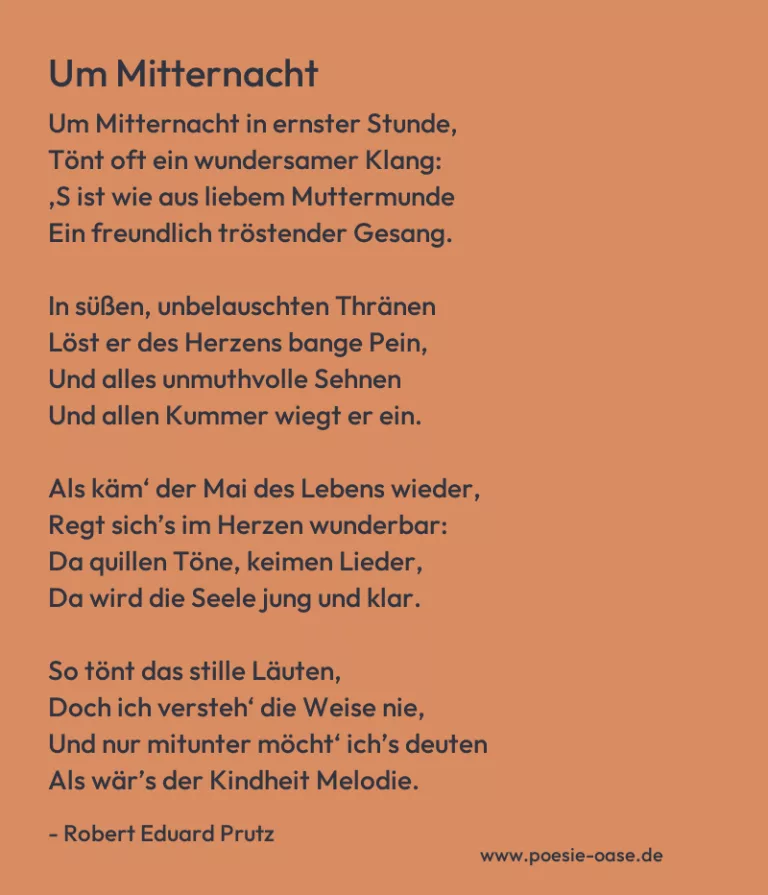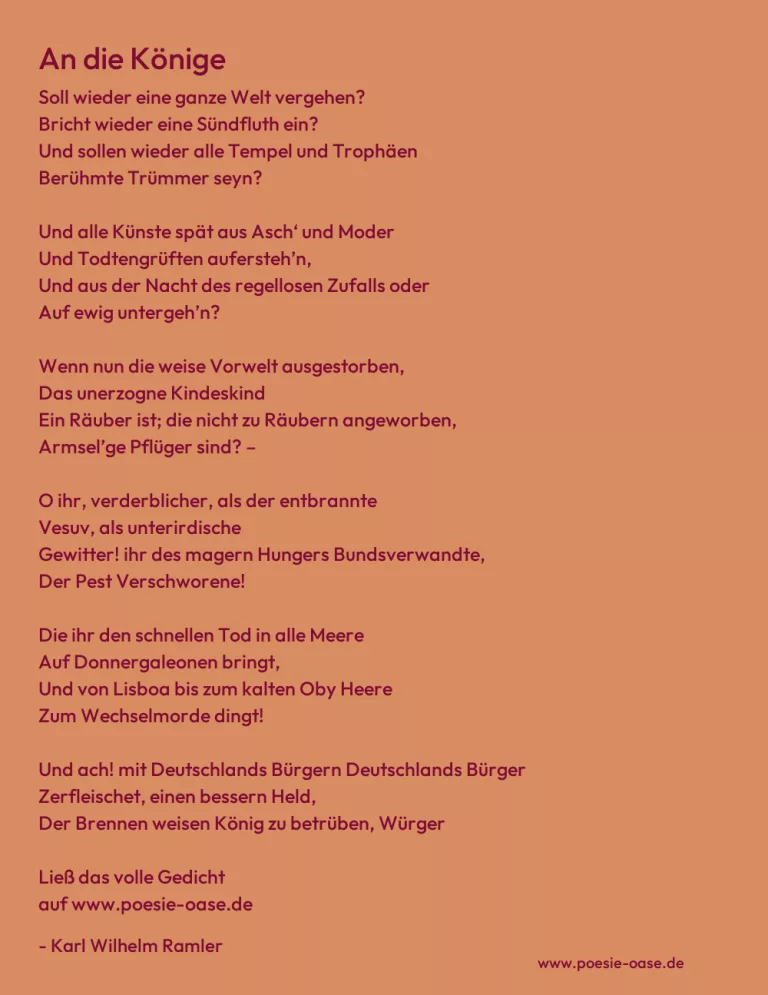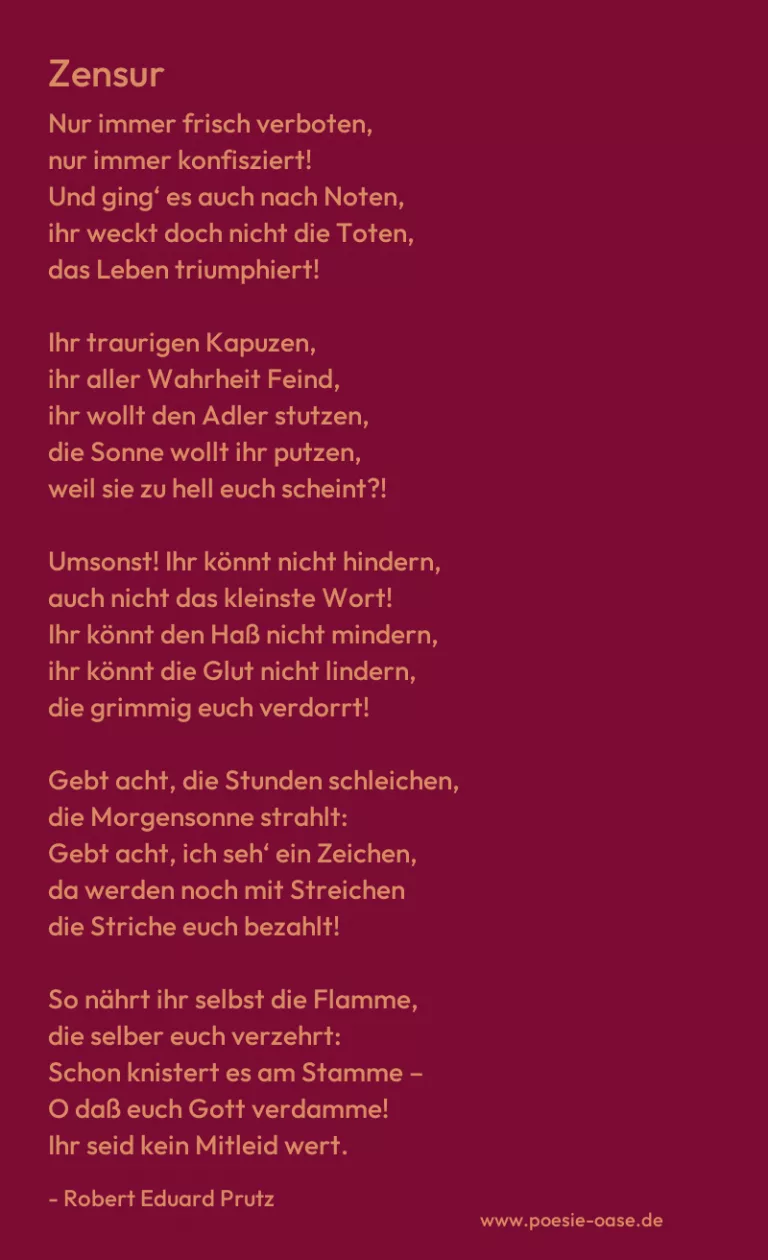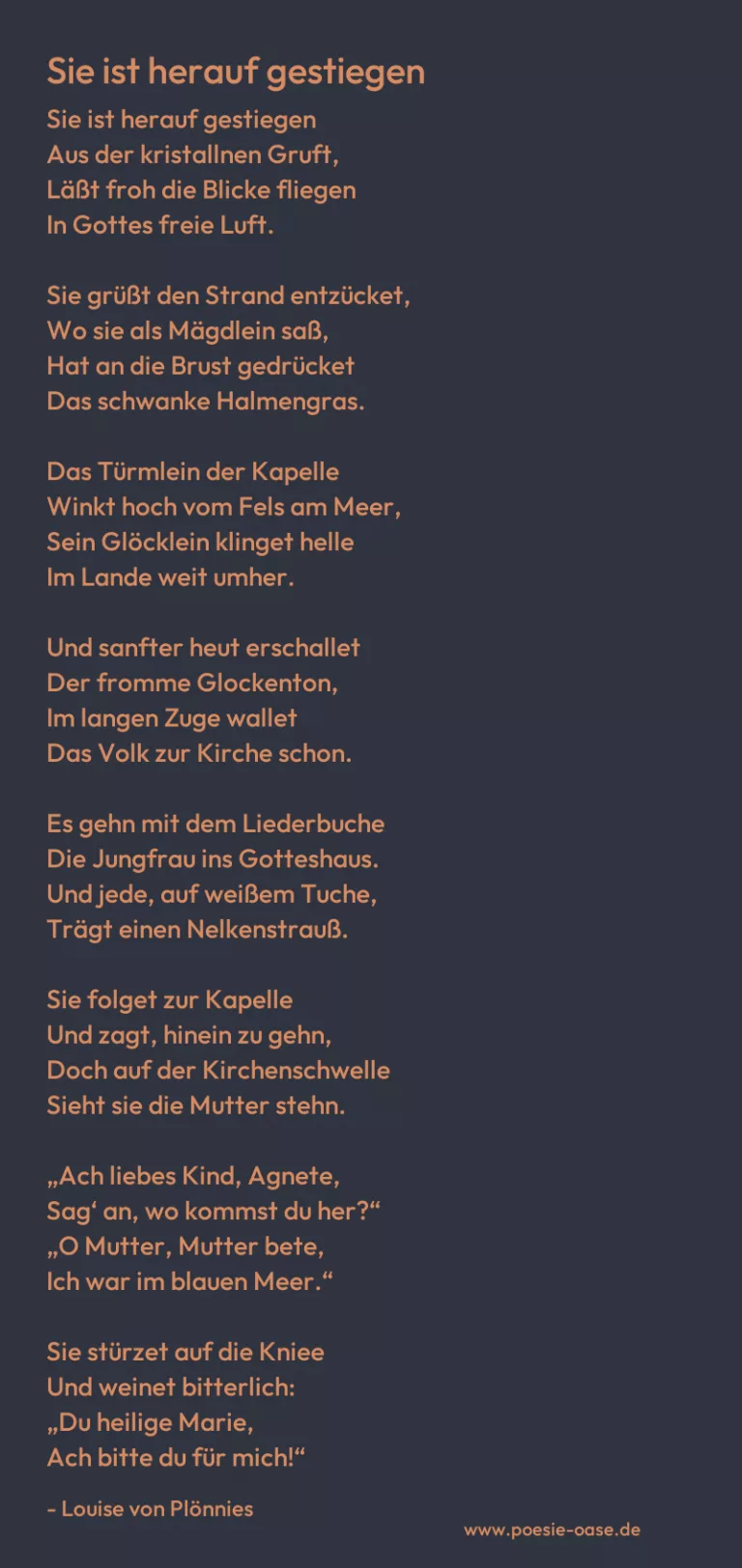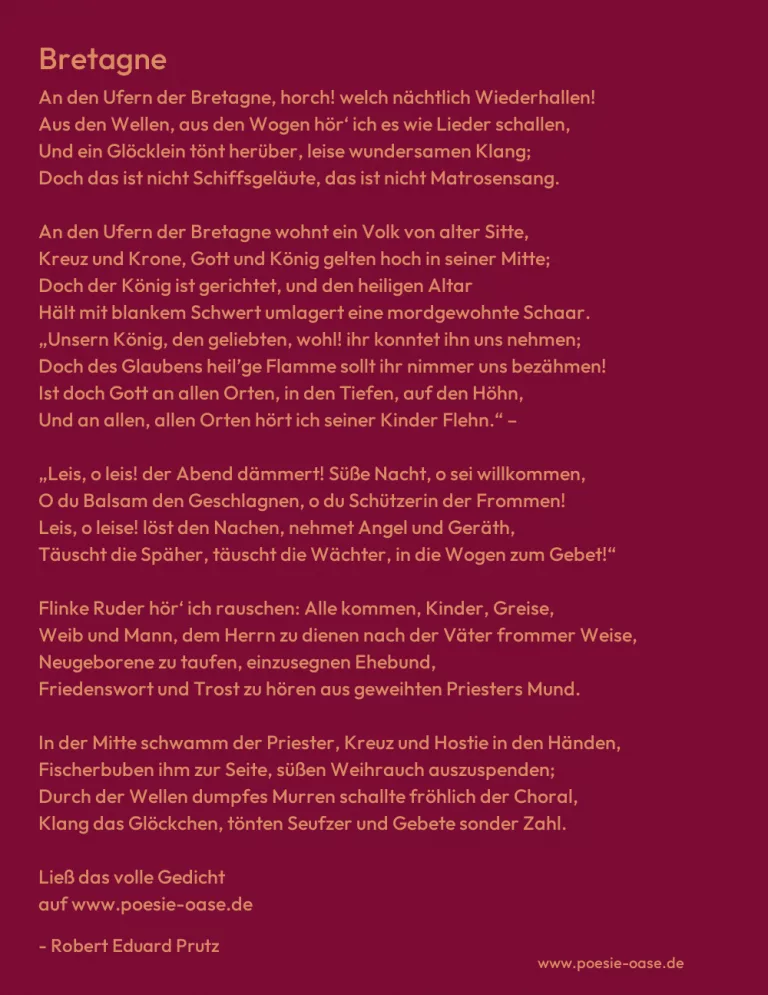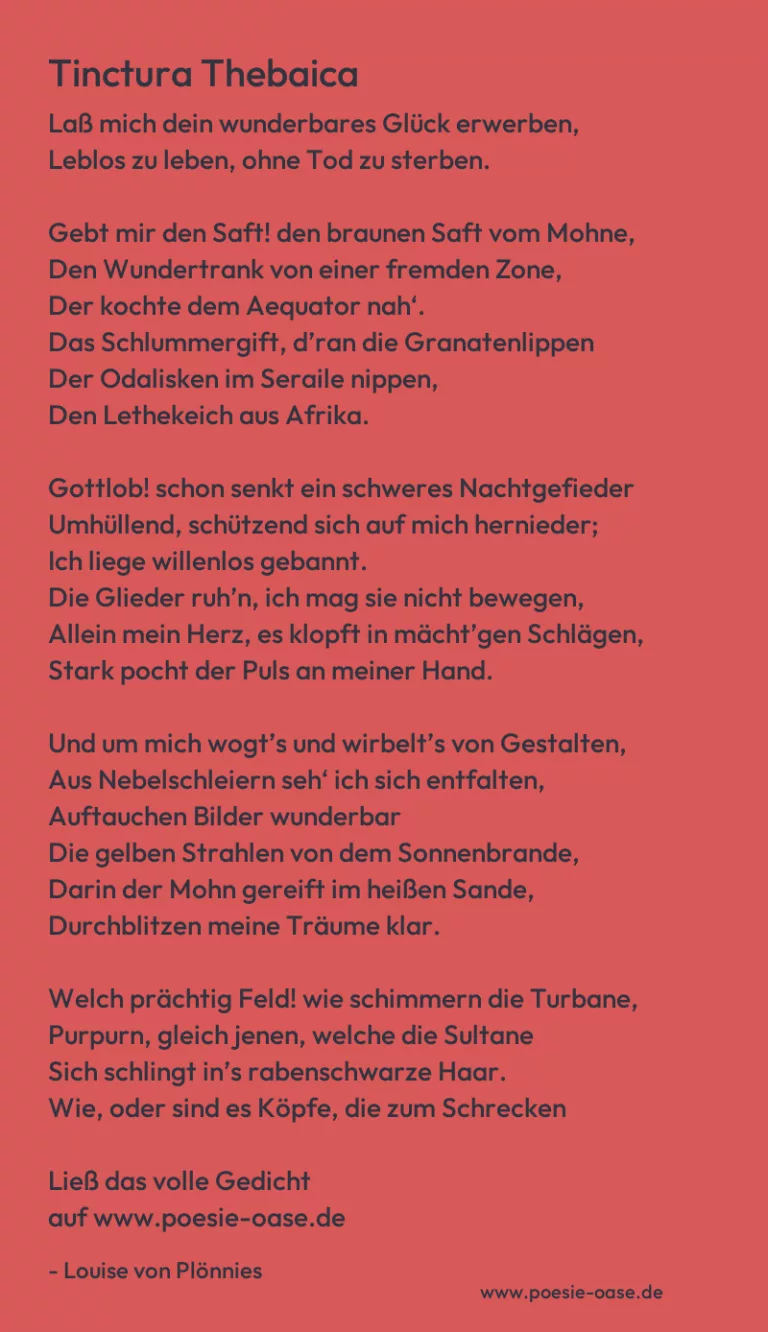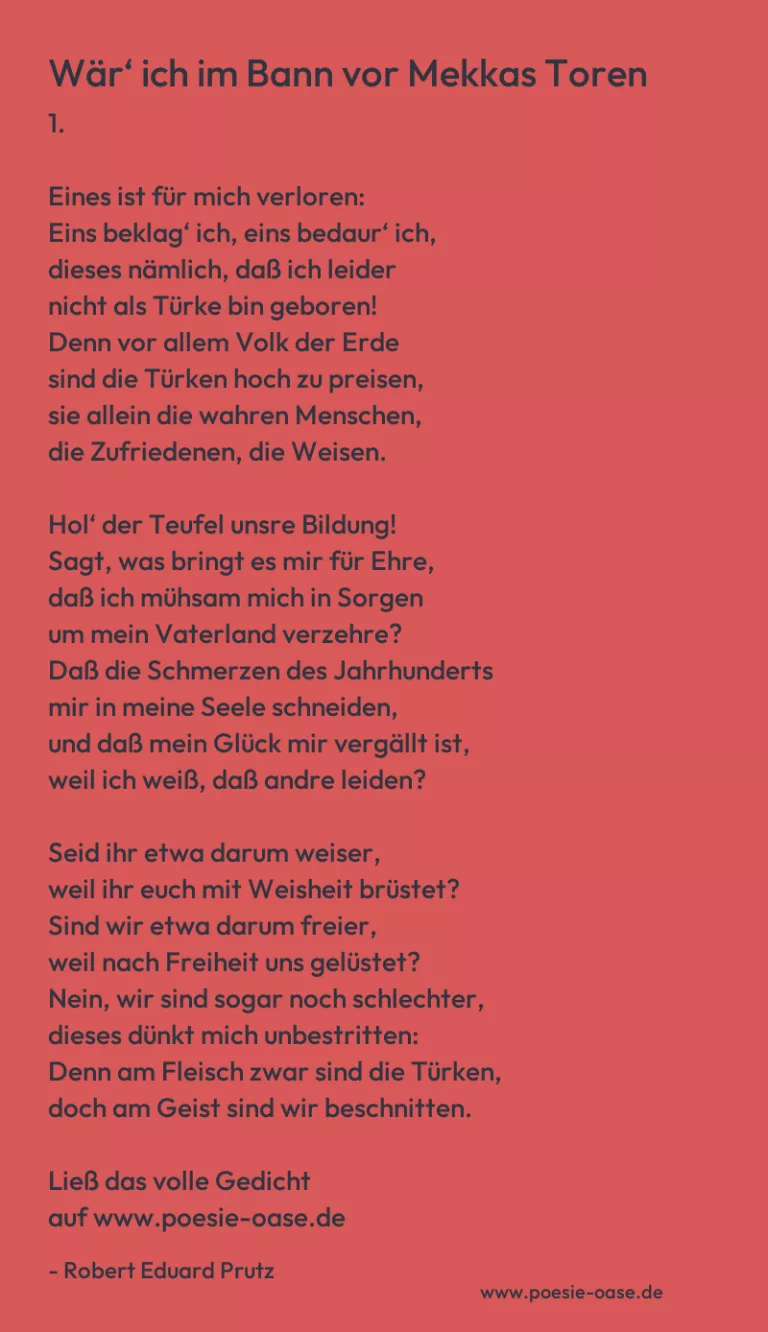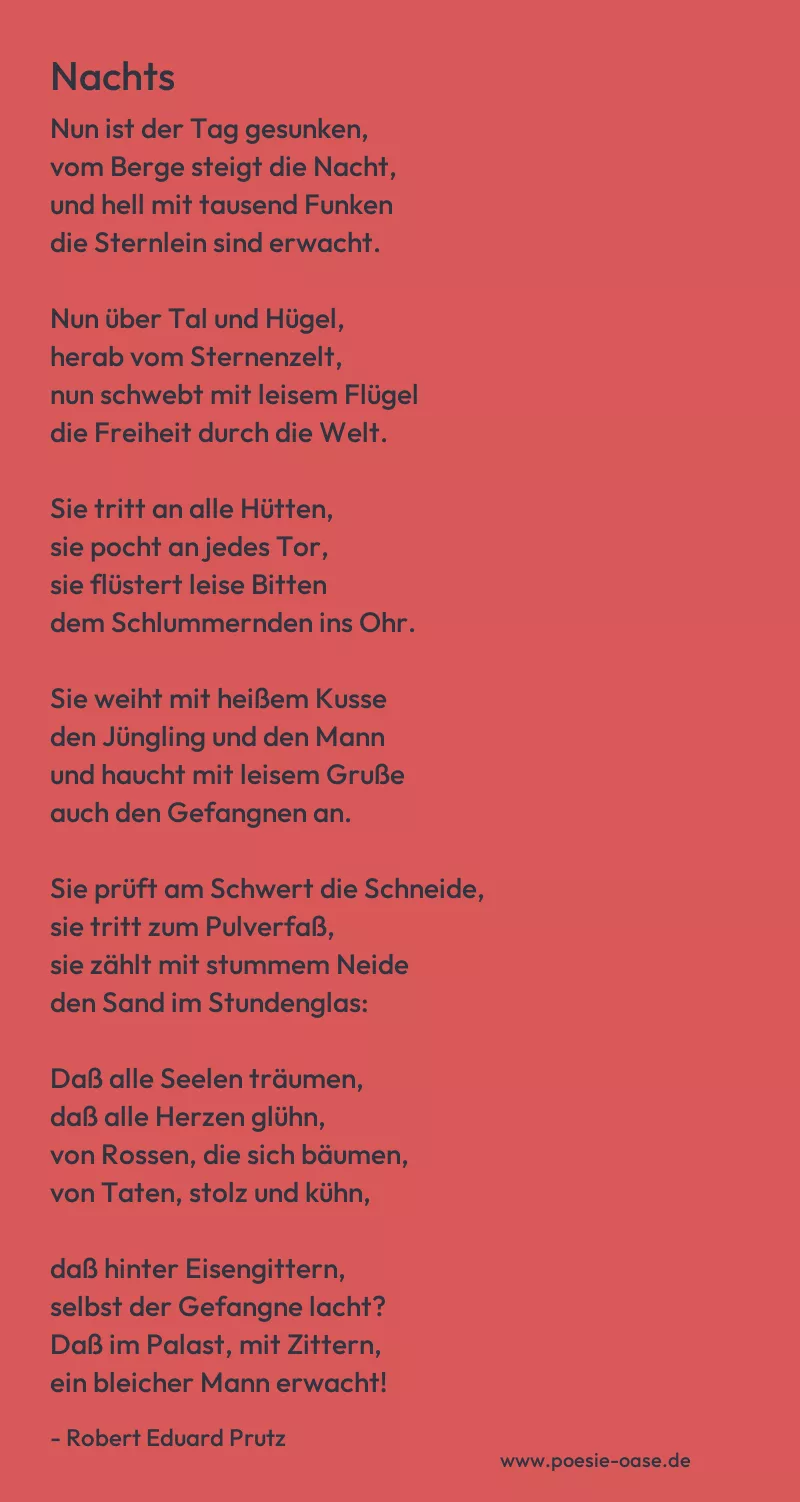Nachts
Nun ist der Tag gesunken,
vom Berge steigt die Nacht,
und hell mit tausend Funken
die Sternlein sind erwacht.
Nun über Tal und Hügel,
herab vom Sternenzelt,
nun schwebt mit leisem Flügel
die Freiheit durch die Welt.
Sie tritt an alle Hütten,
sie pocht an jedes Tor,
sie flüstert leise Bitten
dem Schlummernden ins Ohr.
Sie weiht mit heißem Kusse
den Jüngling und den Mann
und haucht mit leisem Gruße
auch den Gefangnen an.
Sie prüft am Schwert die Schneide,
sie tritt zum Pulverfaß,
sie zählt mit stummem Neide
den Sand im Stundenglas:
Daß alle Seelen träumen,
daß alle Herzen glühn,
von Rossen, die sich bäumen,
von Taten, stolz und kühn,
daß hinter Eisengittern,
selbst der Gefangne lacht?
Daß im Palast, mit Zittern,
ein bleicher Mann erwacht!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
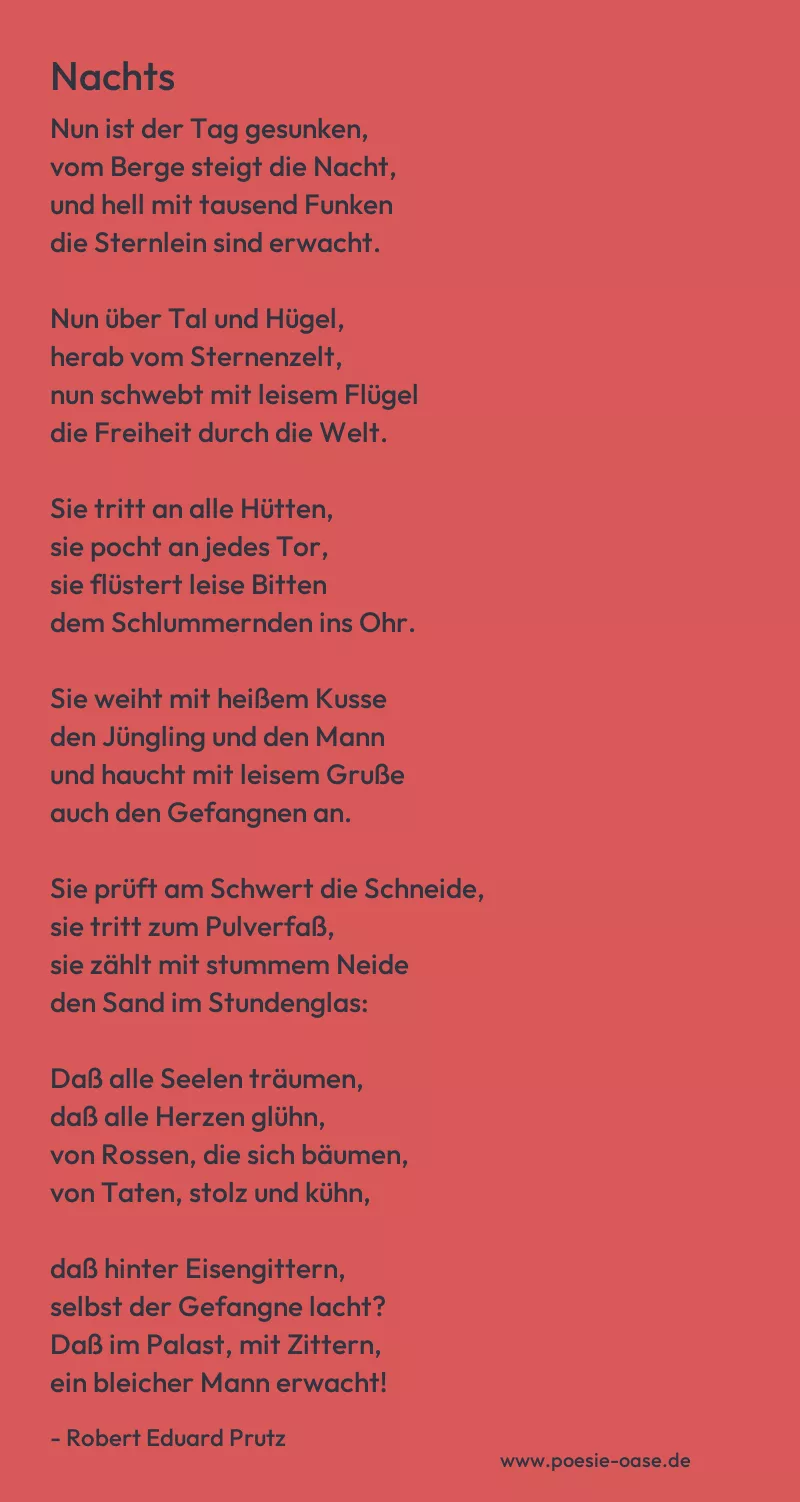
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Nachts“ von Robert Eduard Prutz beschreibt die nächtliche Ankunft der Freiheit, die wie ein geheimnisvoller, allumfassender Geist die Welt durchdringt. Zu Beginn steht der Übergang von Tag zu Nacht im Vordergrund: Der Tag ist gesunken, und „die Nacht“ steigt vom Berge herab. Die „Sternlein“, die mit tausend Funken erwachen, symbolisieren die Nacht als eine Zeit der Magie und des Aufbruchs, in der etwas Neues und Geheimnisvolles geschieht. Die Sterne, als Bild für die Freiheit, funkeln in der Dunkelheit und kündigen eine Veränderung an.
In der zweiten Strophe wird die Freiheit als ein Wesen dargestellt, das „mit leisem Flügel“ über die Welt schwebt. Sie durchdringt Tal und Hügel, und ihre Anwesenheit ist allgegenwärtig. Diese Freiheit tritt an alle „Hütten“, klopft an jedes „Tor“ und flüstert „leise Bitten“ den Schlafenden zu. Das Bild der Freiheit als eine sanfte, fast zärtliche Präsenz verstärkt den Eindruck, dass sie sowohl etwas Befreiendes als auch etwas Beruhigendes in sich trägt. Sie ist nicht gewaltsam, sondern leise und behutsam in ihrer Wirkung, die an die tiefsten Wünsche der Menschen appelliert.
Die Freiheit wirkt nicht nur auf die einfachen Menschen, sondern auch auf die Mächtigen. Sie „weiht mit heißem Kusse den Jüngling und den Mann“ und „haucht mit leisem Gruße auch den Gefangnen an“. Hier wird die universelle Bedeutung von Freiheit betont, die alle Menschen betrifft, unabhängig von ihrem Stand oder ihrer Lebenssituation. Sie streift auch die Gefangenen, was auf eine tiefere Bedeutung hinweist: Freiheit ist nicht nur ein physisches, sondern auch ein geistiges Konzept, das alle, die in irgendeiner Weise gefangen sind, erreicht.
In der vierten Strophe wird die Freiheit weiter entfaltet, indem sie „am Schwert die Schneide prüft“ und „zum Pulverfaß“ tritt. Diese Bilder stellen die Gefahr und die Verantwortung dar, die mit der Freiheit einhergehen. Die Freiheit ist nicht nur eine sanfte, beruhigende Kraft, sondern auch eine, die gewaltig und unvorhersehbar sein kann, wie das Schwert oder das Pulverfaß, die jederzeit explodieren können. Die Freiheit wird hier als eine doppeldeutige Kraft beschrieben: Einerseits inspirierend und erhebend, andererseits gefährlich und voller Spannungen.
Die letzte Strophe beschreibt, was die Freiheit in den Menschen bewirken kann: Sie lässt „alle Seelen träumen“ und „alle Herzen glühn“ von stolzen, kühnen Taten und der Vorstellung von Freiheit und Unabhängigkeit. Doch auch in der Einsamkeit und im Leid ist sie gegenwärtig: Der Gefangene lacht hinter den Eisengittern, und selbst der „bleiche Mann“ im Palast erwacht mit Zittern, was die Ohnmacht der Macht und die universelle Sehnsucht nach Freiheit betont. Das Gedicht endet mit dem Bild eines unvollständigen Triumphs, der zeigt, dass die Freiheit zwar an alle appelliert, aber nicht immer vollständig erreicht wird, besonders bei denen, die am stärksten gefangen sind. Es bleibt ein Traum, der in allen Herzen lebt, aber nicht immer realisiert werden kann.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.