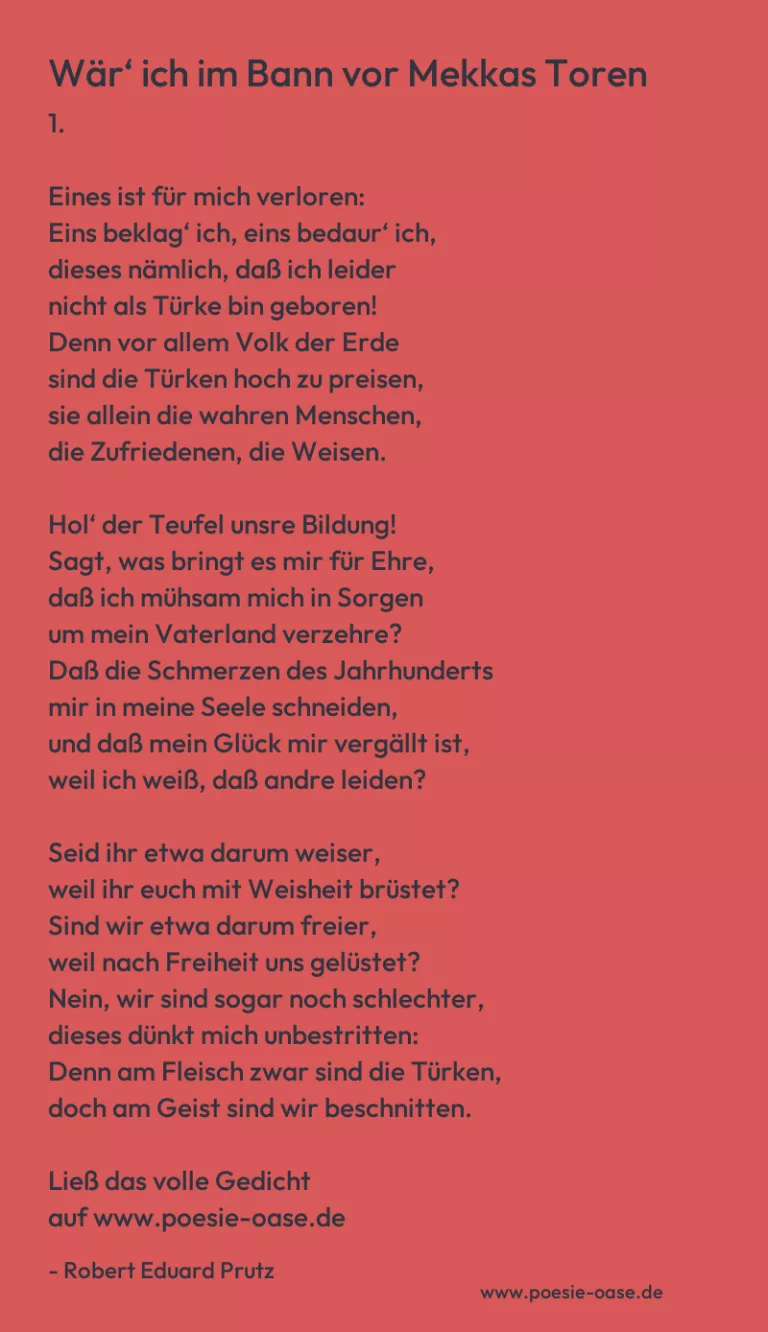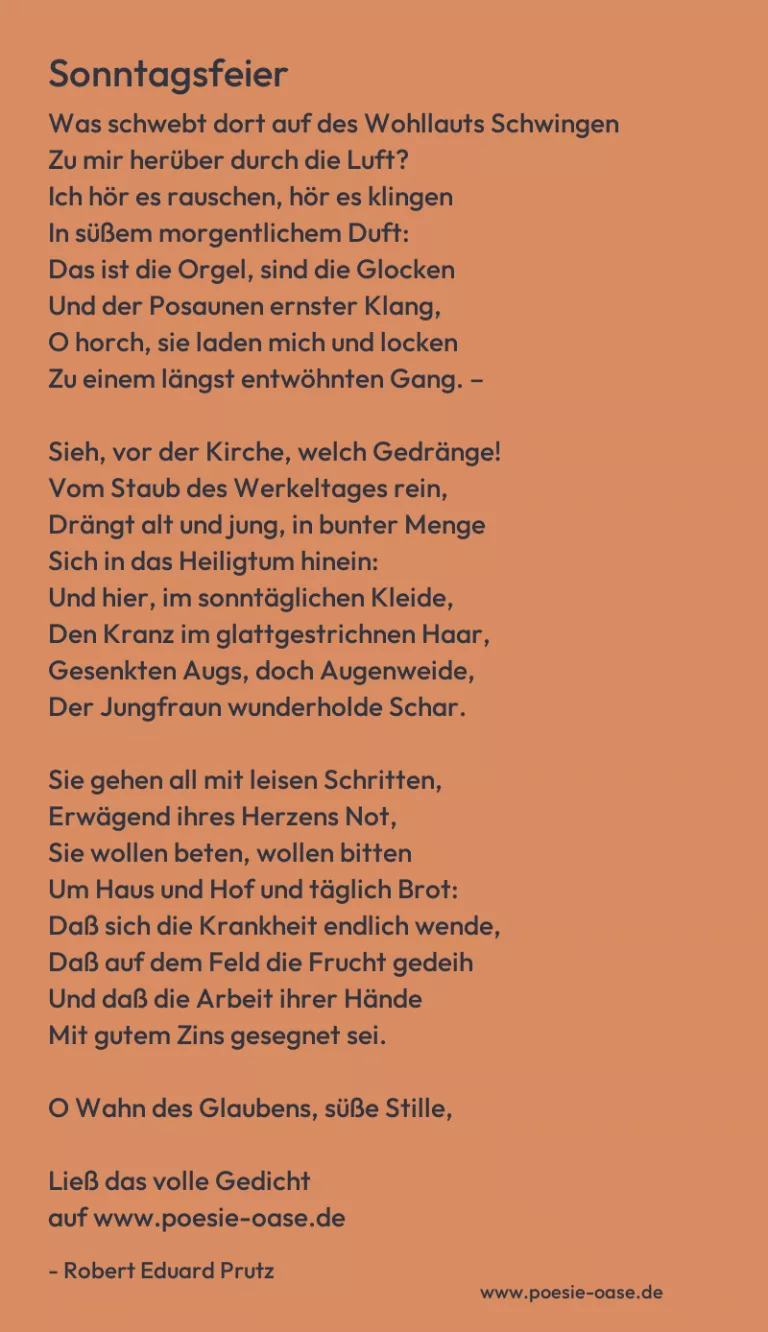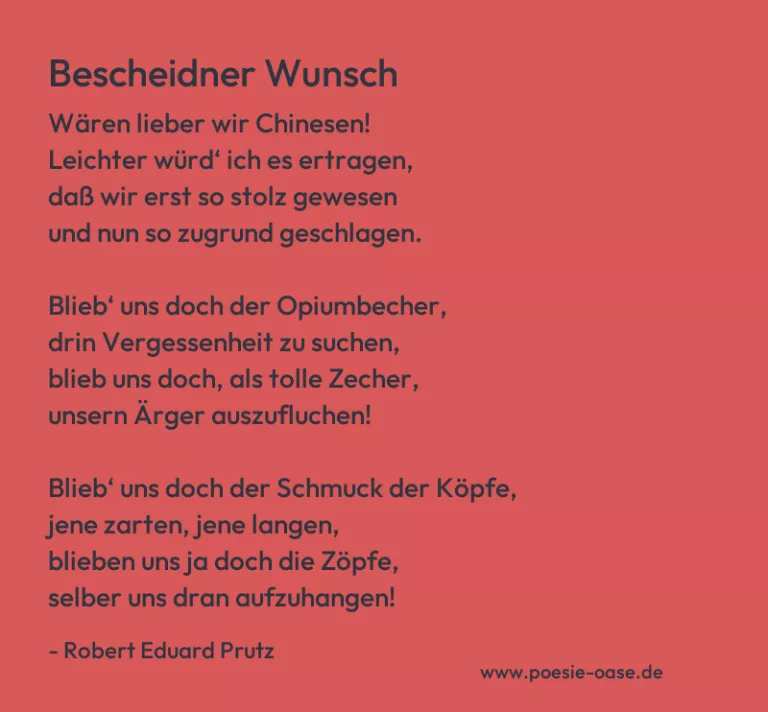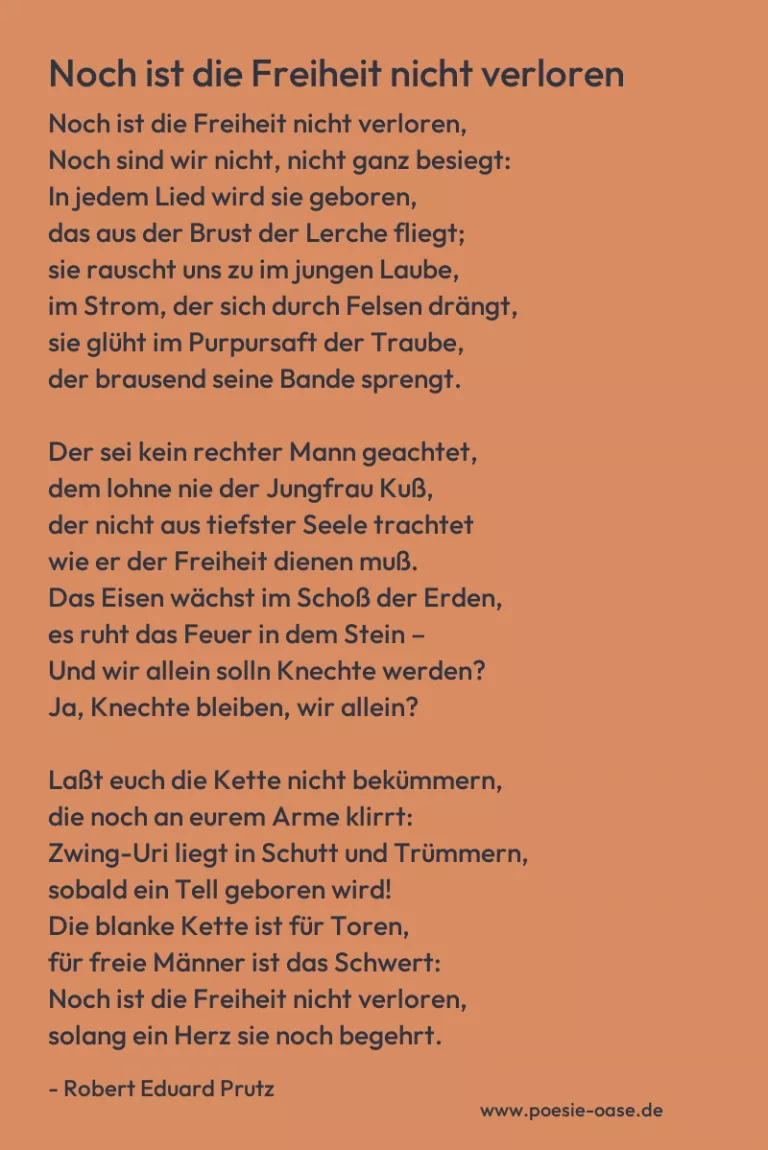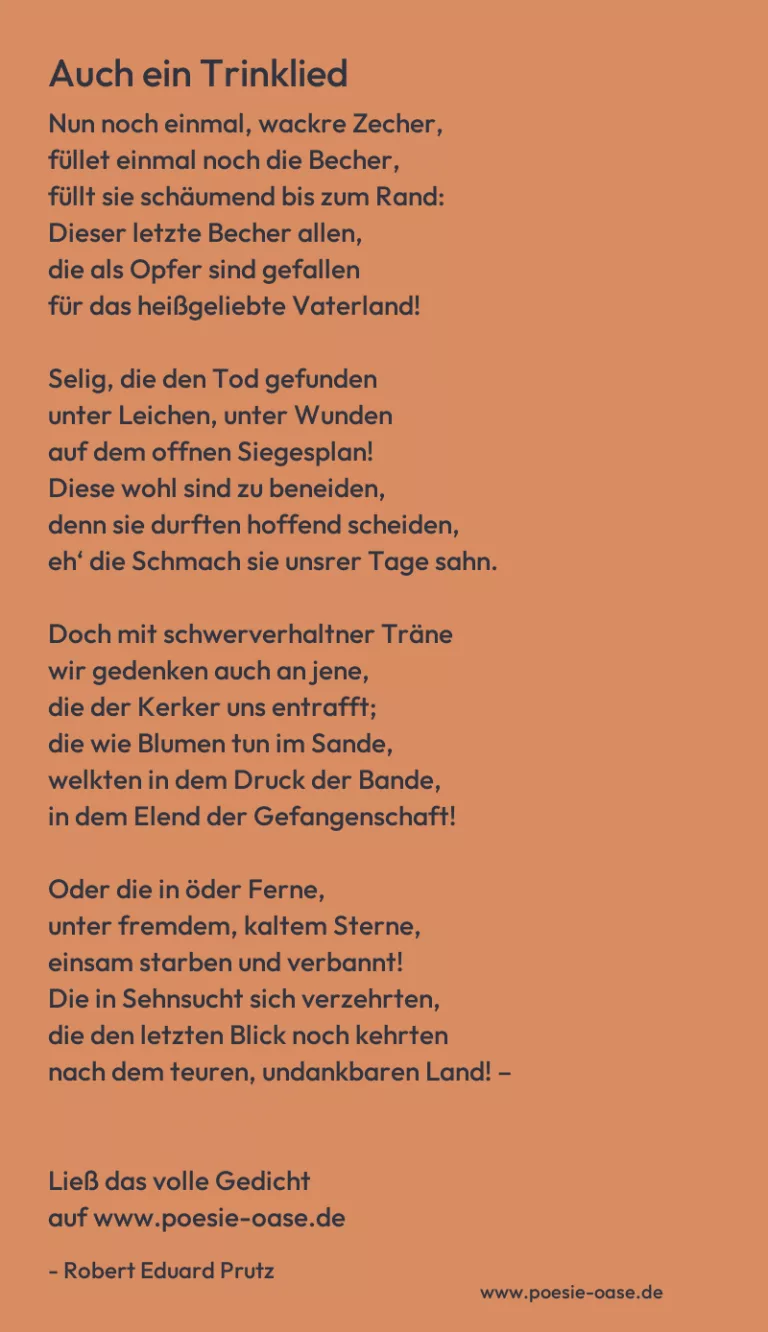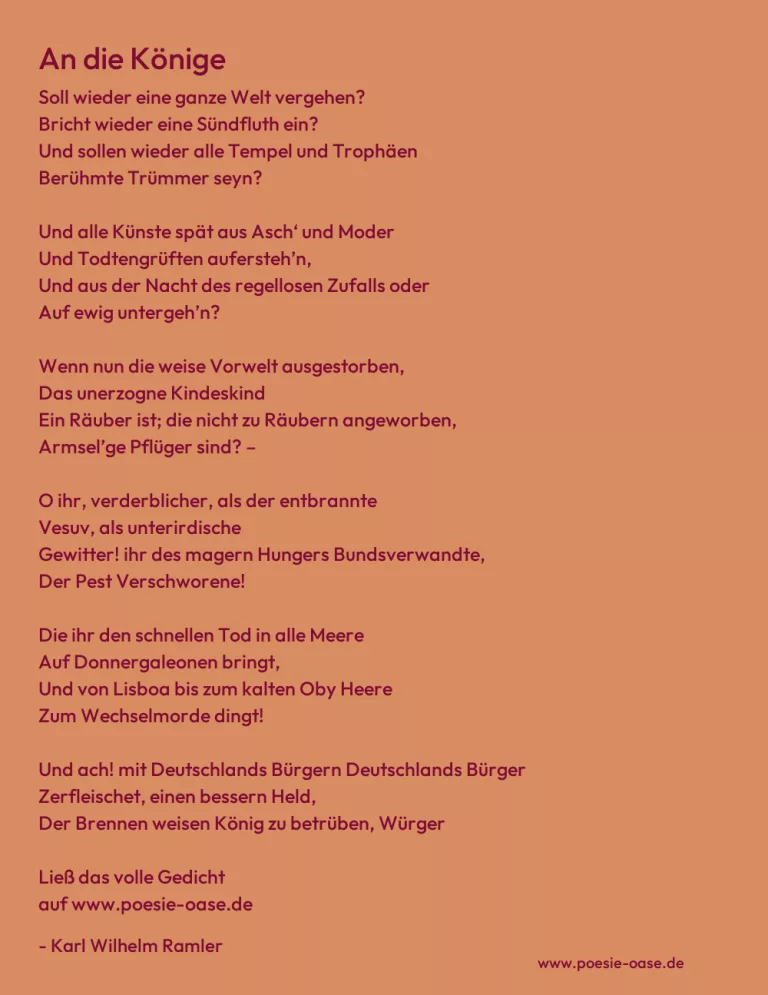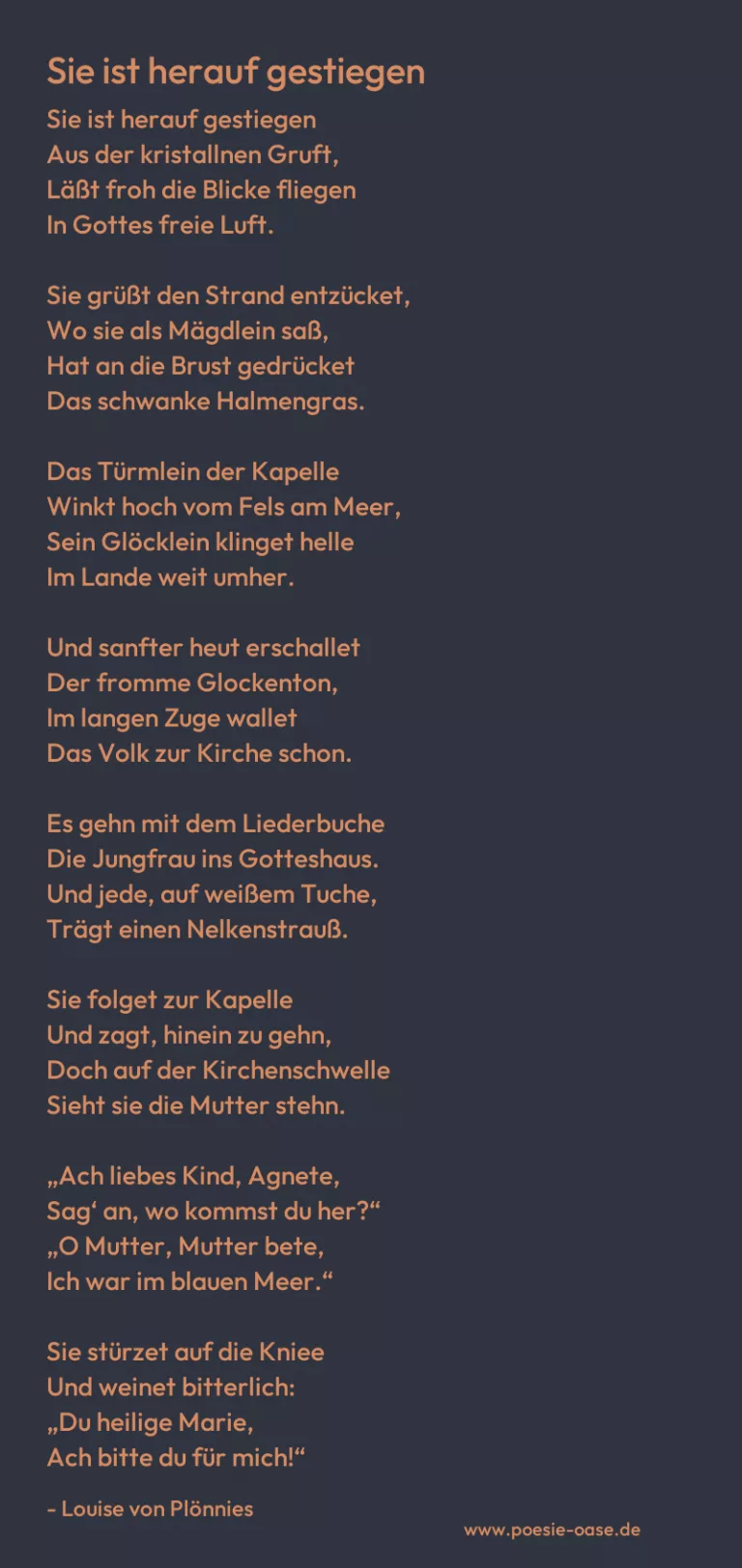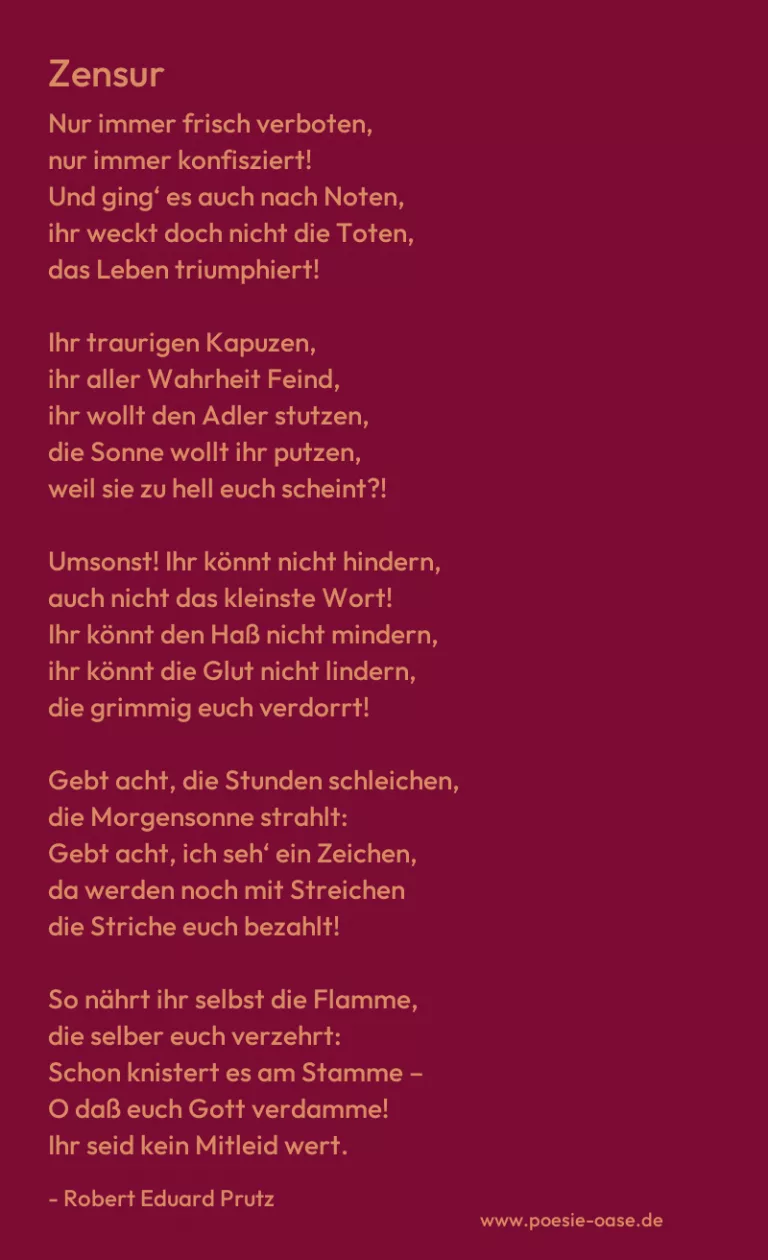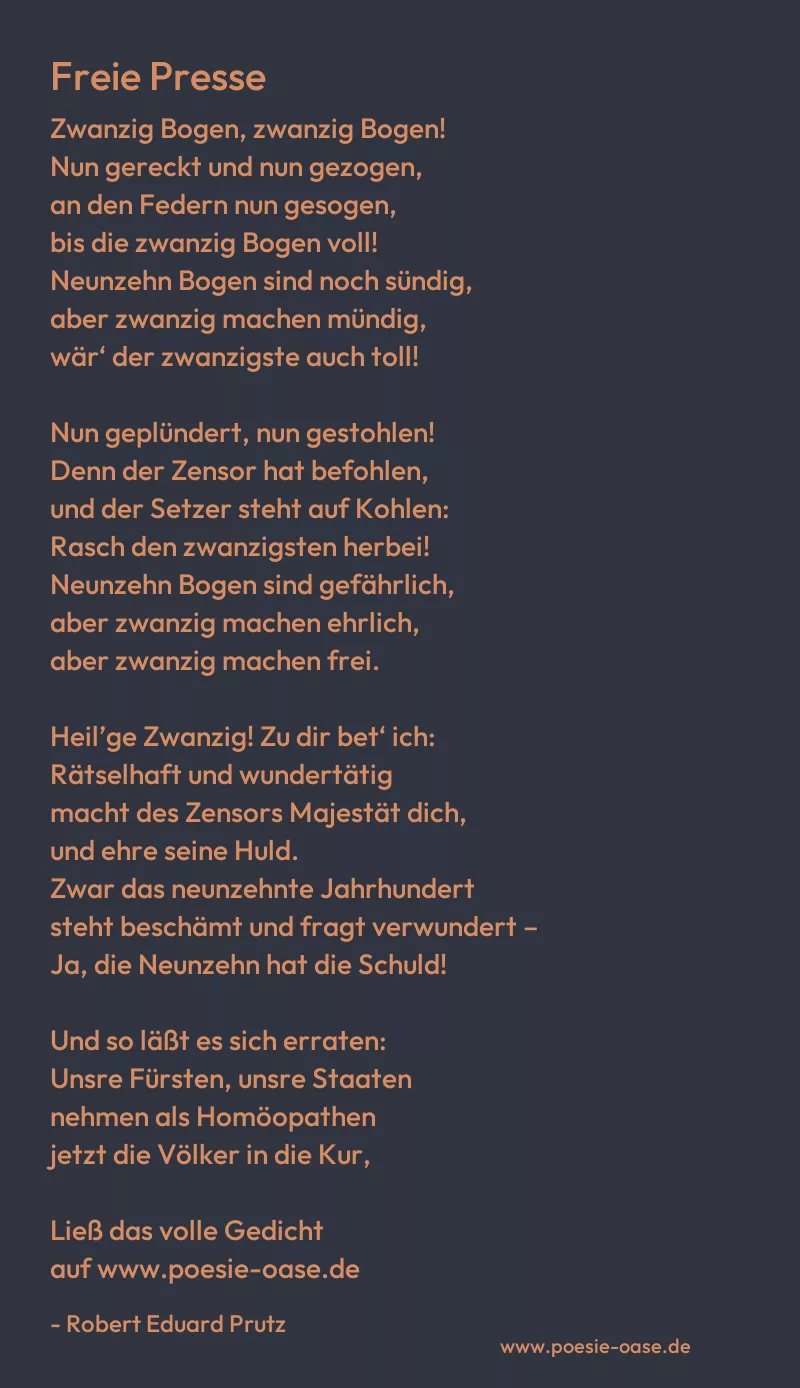Freie Presse
Zwanzig Bogen, zwanzig Bogen!
Nun gereckt und nun gezogen,
an den Federn nun gesogen,
bis die zwanzig Bogen voll!
Neunzehn Bogen sind noch sündig,
aber zwanzig machen mündig,
wär‘ der zwanzigste auch toll!
Nun geplündert, nun gestohlen!
Denn der Zensor hat befohlen,
und der Setzer steht auf Kohlen:
Rasch den zwanzigsten herbei!
Neunzehn Bogen sind gefährlich,
aber zwanzig machen ehrlich,
aber zwanzig machen frei.
Heil’ge Zwanzig! Zu dir bet‘ ich:
Rätselhaft und wundertätig
macht des Zensors Majestät dich,
und ehre seine Huld.
Zwar das neunzehnte Jahrhundert
steht beschämt und fragt verwundert –
Ja, die Neunzehn hat die Schuld!
Und so läßt es sich erraten:
Unsre Fürsten, unsre Staaten
nehmen als Homöopathen
jetzt die Völker in die Kur,
laßt die Leser sich erbosen!
Wenig Fleisch und lange Soßen,
das ersetzt uns die Zensur.
Schreibt denn nun in Gottes Namen,
schreibt, ihr Herren und ihr Damen,
schreibt, ihr Blinden und ihr Lahmen,
schreibt nach Maß und nach Gewicht!
Zwanzig Bogen zwar sind euer:
aber zwanzig sind zu teuer,
zwanzig Bogen kauft man nicht.
Ja zumal in unseren Tagen,
wo die dampfbeschwingten Wagen
sausend durch die Länder jagen
und es doch an Zeit gebricht:
Zwanzig Bogen – welche Menge!
Zwanzig Bogen – welche Länge!
Zwanzig Bogen liest man nicht!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
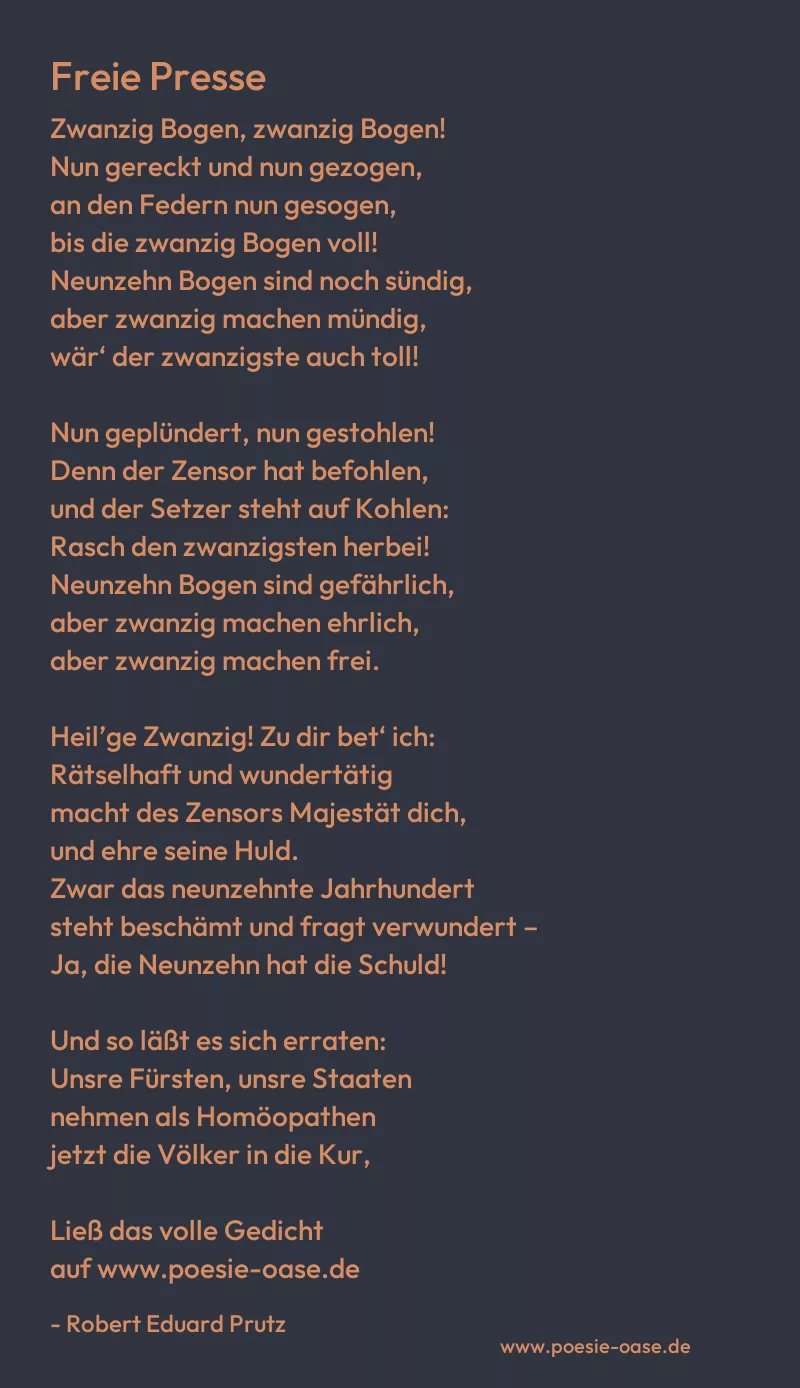
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Freie Presse“ von Robert Eduard Prutz ist eine satirische Auseinandersetzung mit der Zensurpolitik seiner Zeit – speziell mit einer Bestimmung, die Druckerzeugnisse unter zwanzig Bogen (also Druckseiten) der Vorzensur unterwarf, während umfangreichere Werke formal als „Buch“ galten und von dieser Regelung ausgenommen waren. Prutz greift dieses absurde Schlupfloch der Pressefreiheit auf und macht daraus eine bissige Kritik an bürokratischer Willkür, politischer Bevormundung und dem Zustand der Meinungsfreiheit im Vormärz.
Schon in der ersten Strophe zeigt sich der spöttische Ton: Die „zwanzig Bogen“ werden zum magischen Maßstab erhoben, der den Unterschied zwischen Unterdrückung und Freiheit ausmachen soll. Dass ein Text, allein durch seine Länge, von der Zensur befreit sein kann, erscheint dem lyrischen Ich als paradoxer Zustand, der die „zwanzig“ fast zur göttlich verehrten Zahl erhebt – eine ironische Überhöhung, die die Absurdität des Systems bloßlegt.
In weiteren Strophen karikiert Prutz das hektische Treiben der Drucker („der Setzer steht auf Kohlen“) ebenso wie die launische Macht der Zensur. Die zwanzig Bogen werden zum rettenden Ziel, das nicht aus inhaltlichem, sondern aus formalen Gründen angestrebt wird. Dass Neunzehn „sündig“ und „gefährlich“, Zwanzig aber „ehrlich“ und „frei“ seien, ist ein bewusst gesetzter Widerspruch, mit dem der Autor die Willkür politischer Kontrolle entlarvt.
Besonders scharf ist die Kritik an den Herrschenden, die als „Homöopathen“ dargestellt werden: Sie verabreichen dem Volk kleine Dosen scheinbarer Freiheit – „wenig Fleisch und lange Soßen“ – ohne wirklich etwas zu ändern. Die Presse wird zwar formal erlaubt, inhaltlich jedoch ausgehöhlt. Das führt zu einem Zustand, in dem zwar „in Gottes Namen“ geschrieben werden darf, die praktische Wirkung aber durch Umfang, Preis oder Leserinteresse begrenzt wird.
Die letzten Strophen bringen eine weitere Pointe: Selbst wenn man die zwanzig Bogen erreicht, liest sie niemand. In einer beschleunigten Welt, in der „dampfbeschwingte Wagen“ durch das Land jagen, fehlt die Zeit für so umfangreiche Texte. So wird das Mittel zur Umgehung der Zensur – der lange Text – letztlich ebenfalls wirkungslos. Prutz schließt damit den satirischen Kreis: Die Presse ist offiziell frei, doch in Wahrheit zensiert, überladen oder ignoriert.
„Freie Presse“ ist ein geistreiches, scharf formuliertes Gedicht, das die Repression der Meinungsfreiheit mit ironischem Witz und scharfem politischen Bewusstsein seziert. Prutz zeigt dabei nicht nur die äußere Zensur auf, sondern auch die subtilen Mechanismen der Entwertung von Wahrheit und öffentlicher Debatte – ein Thema, das bis heute nichts an Relevanz verloren hat.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.