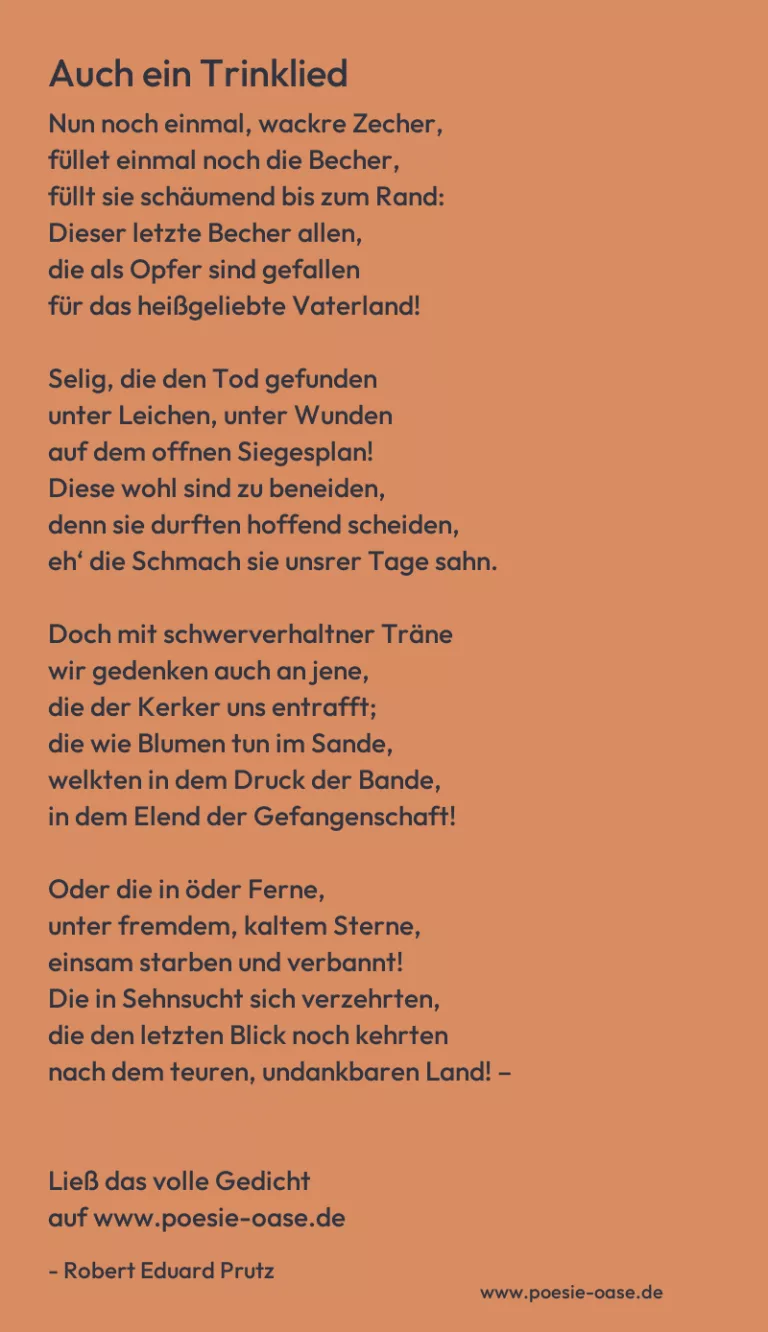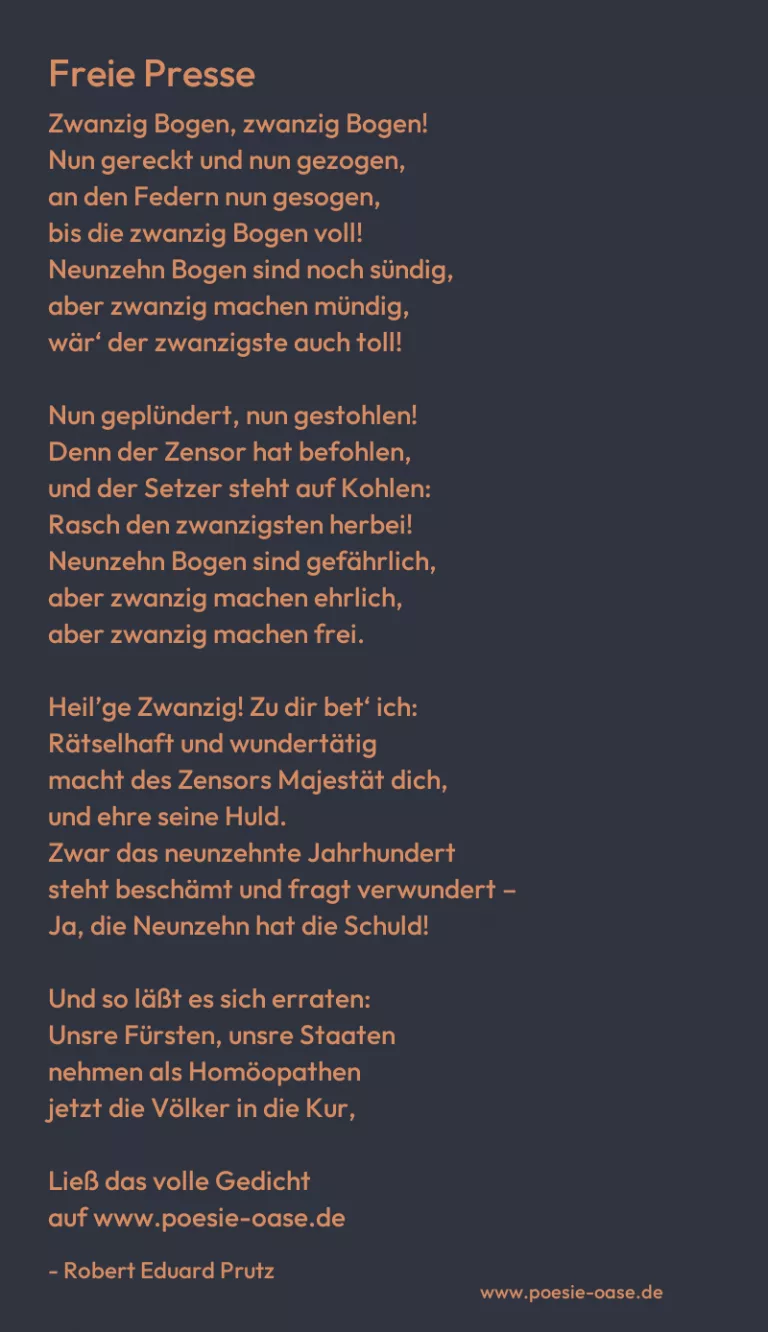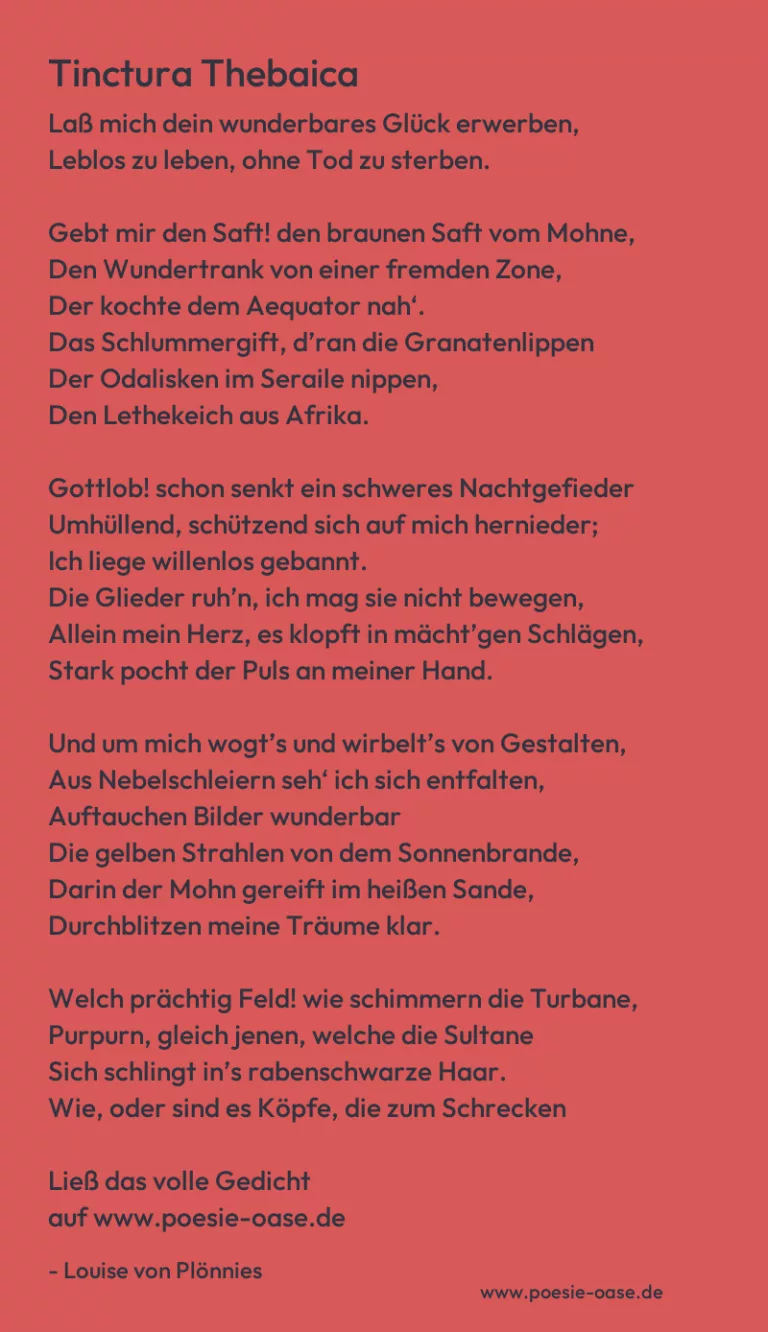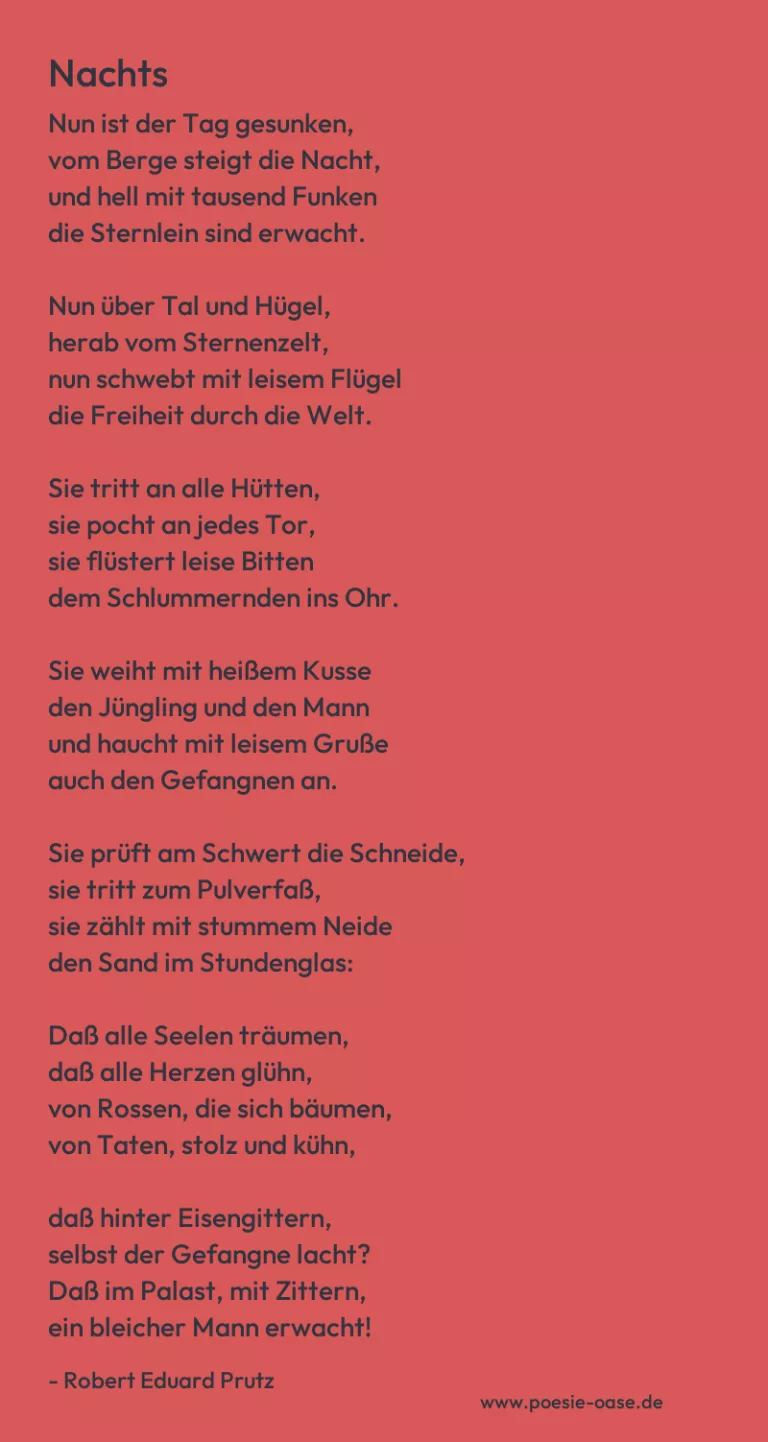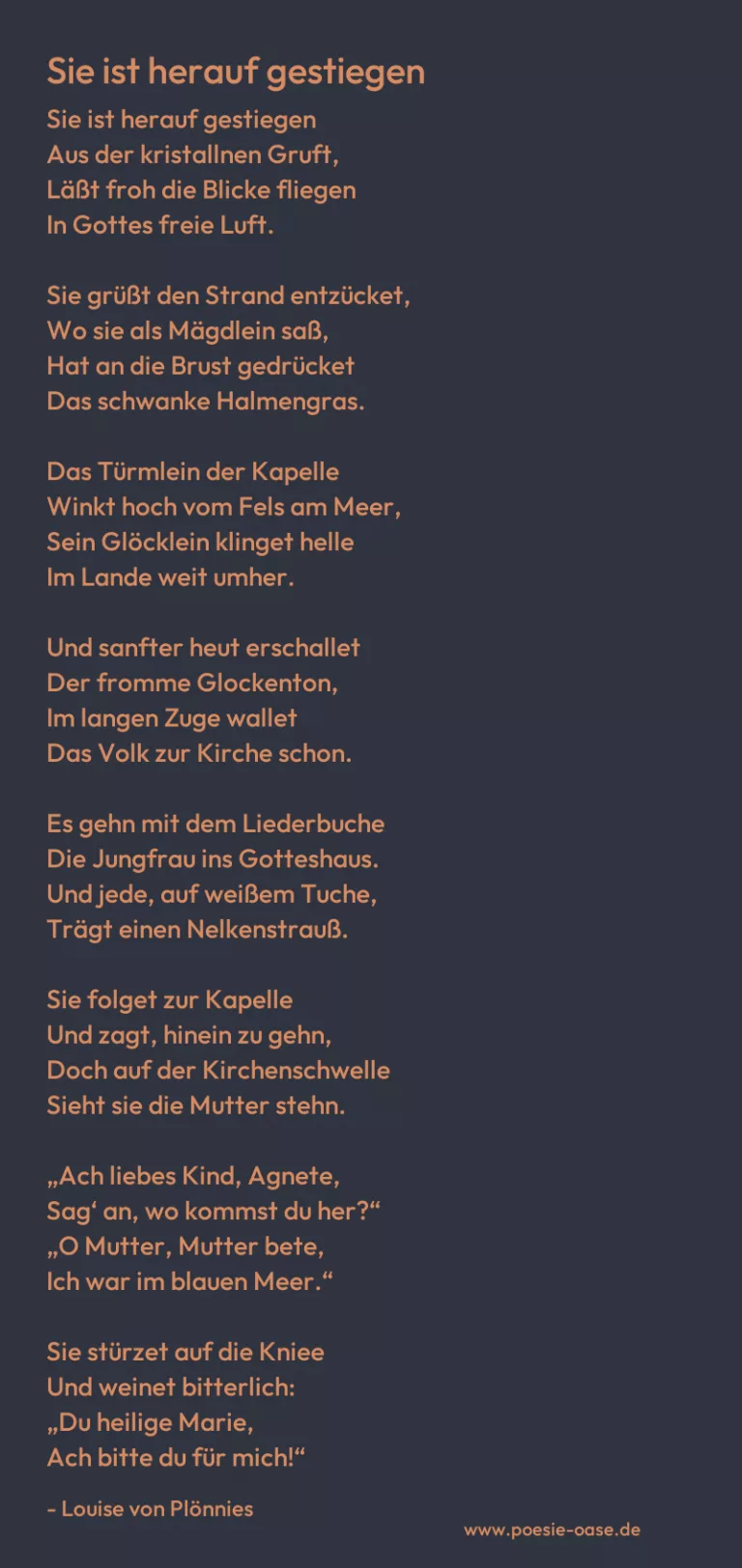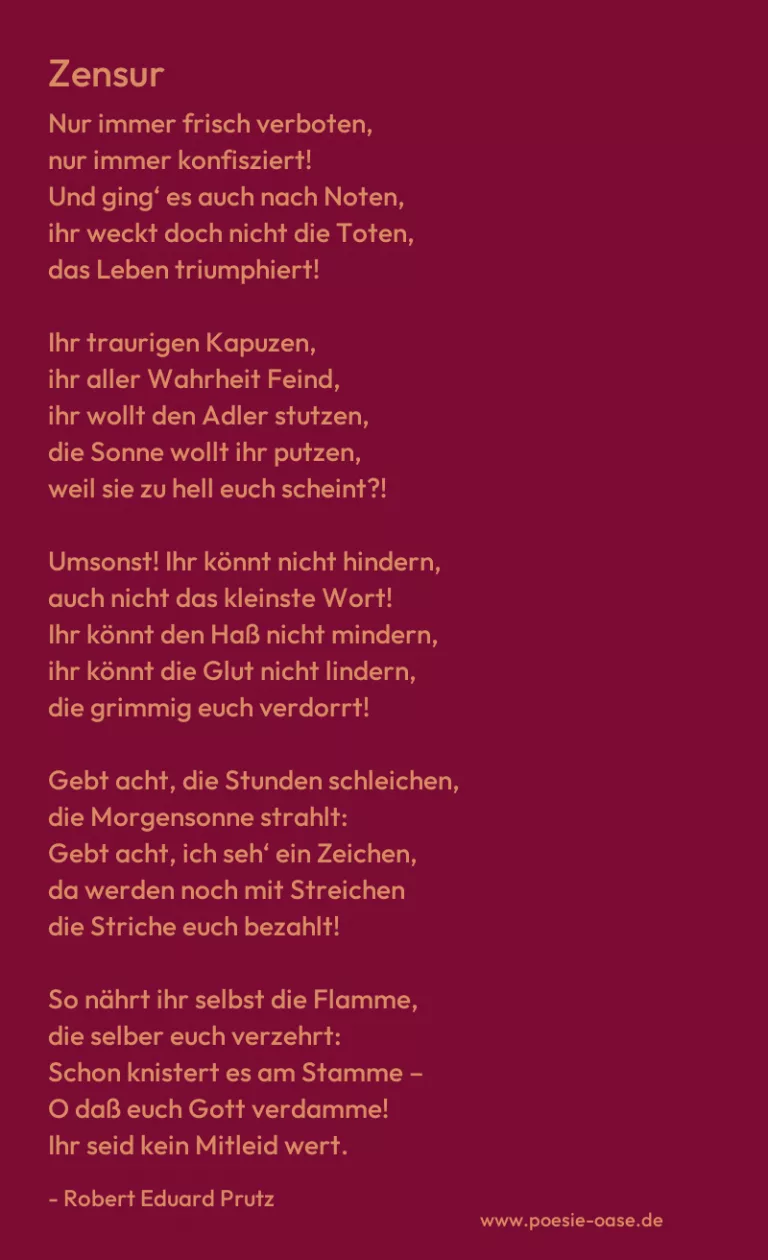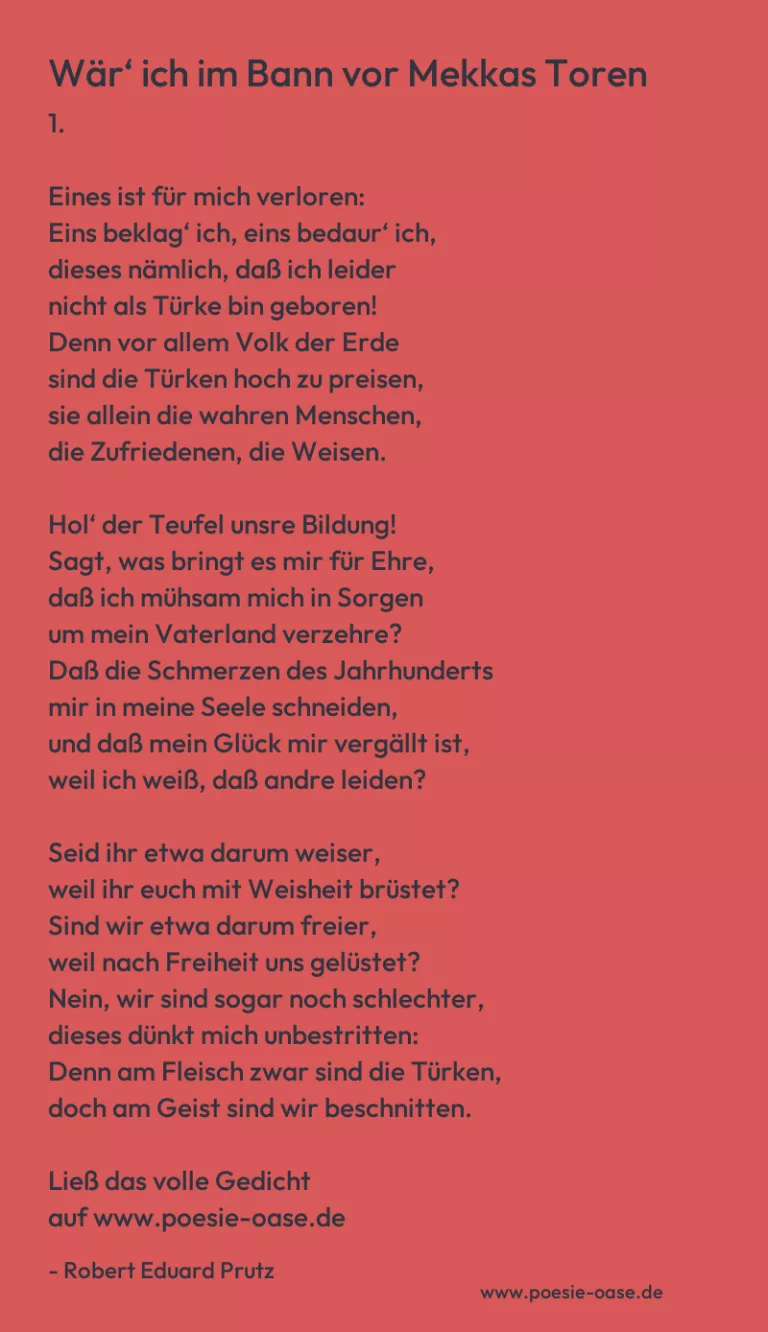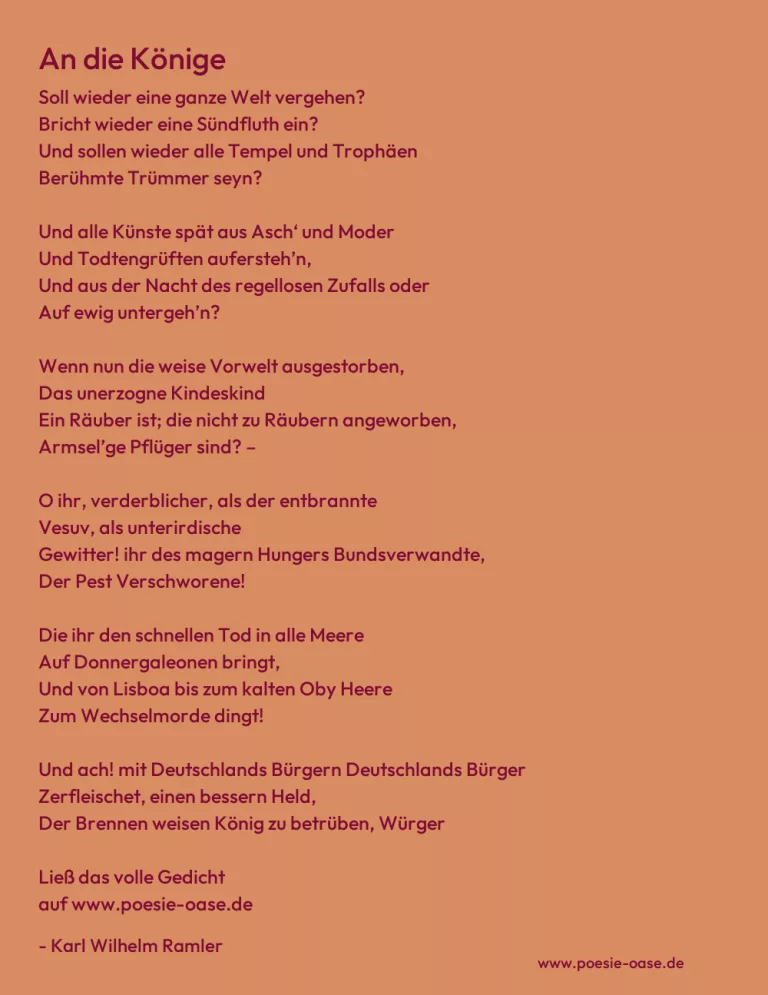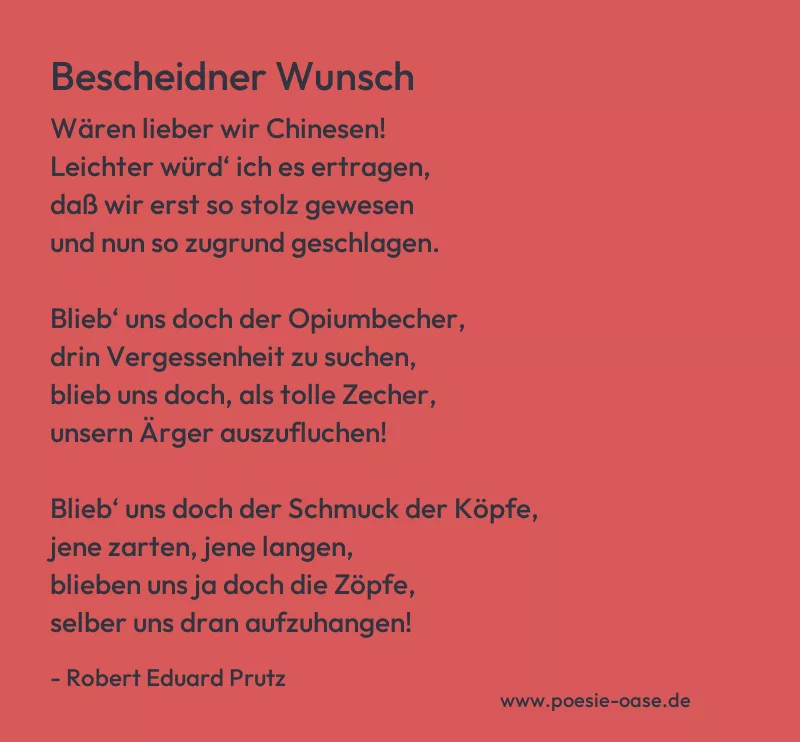Bescheidner Wunsch
Wären lieber wir Chinesen!
Leichter würd‘ ich es ertragen,
daß wir erst so stolz gewesen
und nun so zugrund geschlagen.
Blieb‘ uns doch der Opiumbecher,
drin Vergessenheit zu suchen,
blieb uns doch, als tolle Zecher,
unsern Ärger auszufluchen!
Blieb‘ uns doch der Schmuck der Köpfe,
jene zarten, jene langen,
blieben uns ja doch die Zöpfe,
selber uns dran aufzuhangen!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
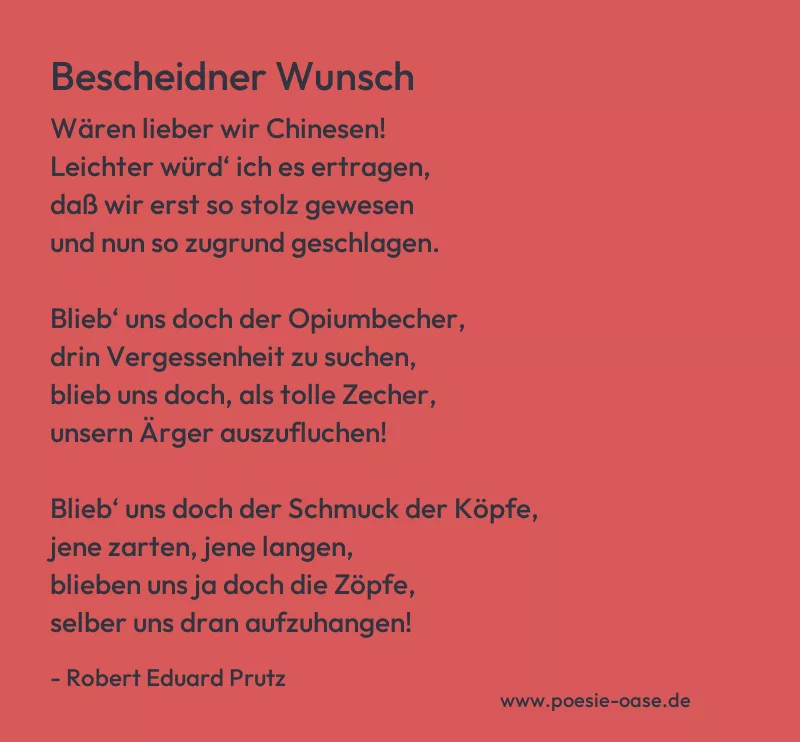
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Bescheidener Wunsch“ von Robert Eduard Prutz reflektiert auf eine ironische und melancholische Weise über den Verlust von Stolz und kultureller Identität. Der Sprecher äußert den Wunsch, lieber „Chinesen“ zu sein, da es ihm leichter erscheinen würde, die Demütigung und den Fall von einstiger Größe zu ertragen. Die „Stolz“ des vergangenen Aufstiegs und der jetzige „Zugrunde“ gegangene Zustand stehen dabei in starkem Kontrast zueinander. Diese Darstellung lässt den Verlust einer ehemals mächtigen Kultur oder Gesellschaft ahnen, was auf eine tiefere Gesellschaftskritik hindeutet.
Die zweite Strophe bringt eine gewisse Tragikomik ins Spiel, wenn der Sprecher sich die Vergessenheit durch den „Opiumbecher“ wünscht. Das Opium, das in der Geschichte mit der chinesischen Kultur verbunden ist, wird hier als Flucht vor der Realität dargestellt. Der Wunsch nach „Vergessenheit“ und der „Ärger auszufluchen“ verdeutlichen die Unfähigkeit oder den Wunsch, den Schmerz des Verlustes durch Verdrängung und Flucht zu überwinden. Der Vergleich zu „tollen Zechern“ verstärkt die Vorstellung, dass der Sprecher sich in eine selbstzerstörerische, aber auch tröstliche Illusion flüchten möchte.
In der dritten Strophe spielt der Sprecher auf die traditionellen „Schmuck der Köpfe“ und die „langen Zöpfe“ an, die symbolisch für das kulturelle Erbe der Chinesen stehen. Diese „Zöpfe“ sind jedoch nicht nur ein Teil des kulturellen Schmucks, sondern auch ein Bild des Verfalls und der Verzweiflung, da der Sprecher anmerkt, dass er sich „selber dran aufzuhangen“ wünschen würde. Diese scharfe Wendung deutet auf eine verzweifelte Stimmung hin, in der der Verlust der eigenen Identität und der Stolz so groß sind, dass er sich eine radikale Lösung wünscht. Es handelt sich dabei um eine düstere Reflexion über die Auswirkungen von Entfremdung und kulturellem Verfall.
Das Gedicht ist insgesamt eine kritische Auseinandersetzung mit dem Verlust von kulturellem und sozialem Wert und einem verzweifelten Blick auf den Zustand einer Gesellschaft, die einst mächtig war und nun dem Untergang geweiht scheint. Der „bescheidene Wunsch“ des Sprechers, die Herausforderungen der Realität durch Flucht und Vergessen zu mildern, zeigt eine tiefe Resignation und eine traurige Akzeptanz des eigenen Schicksals.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.