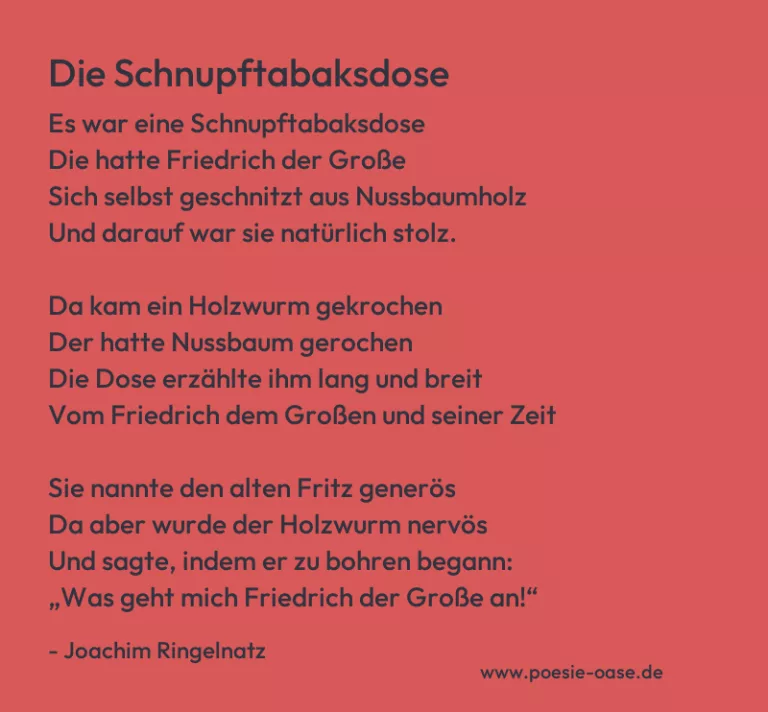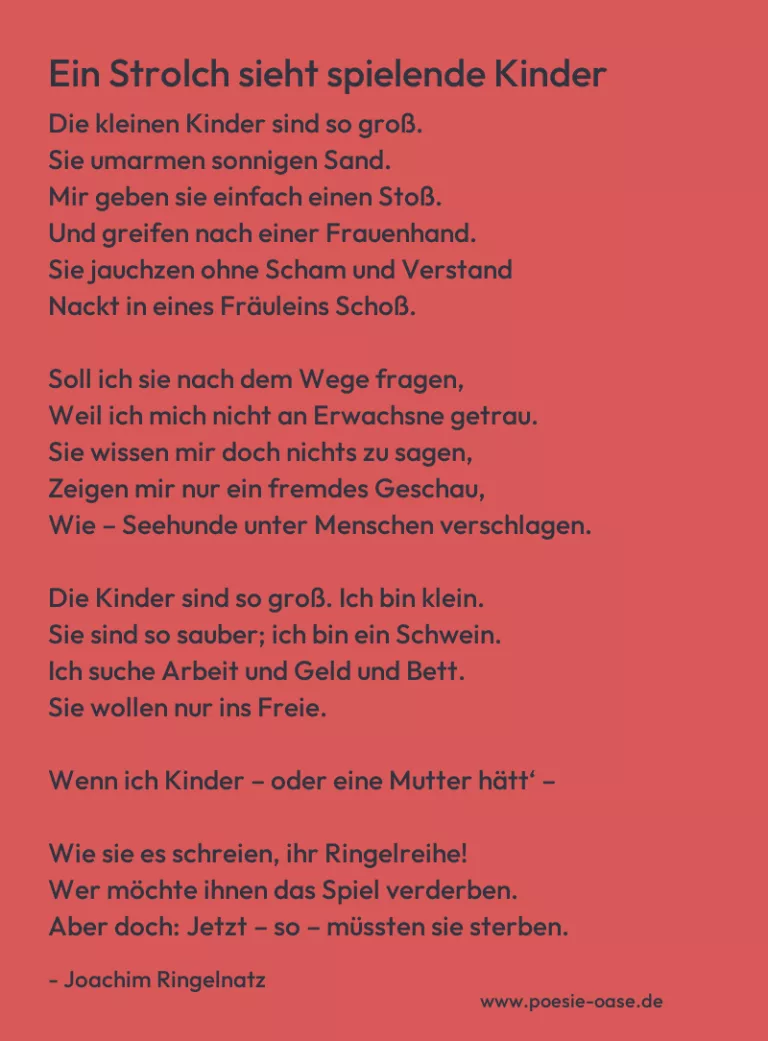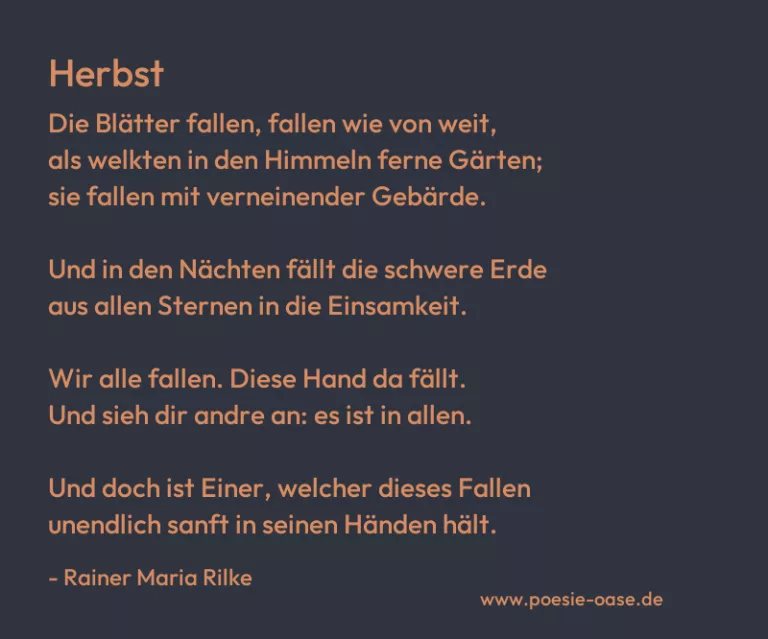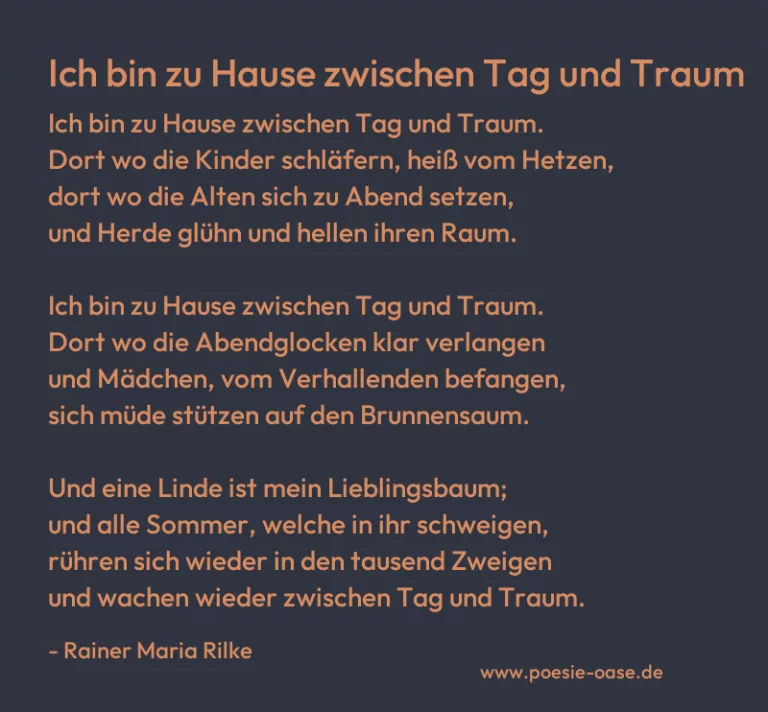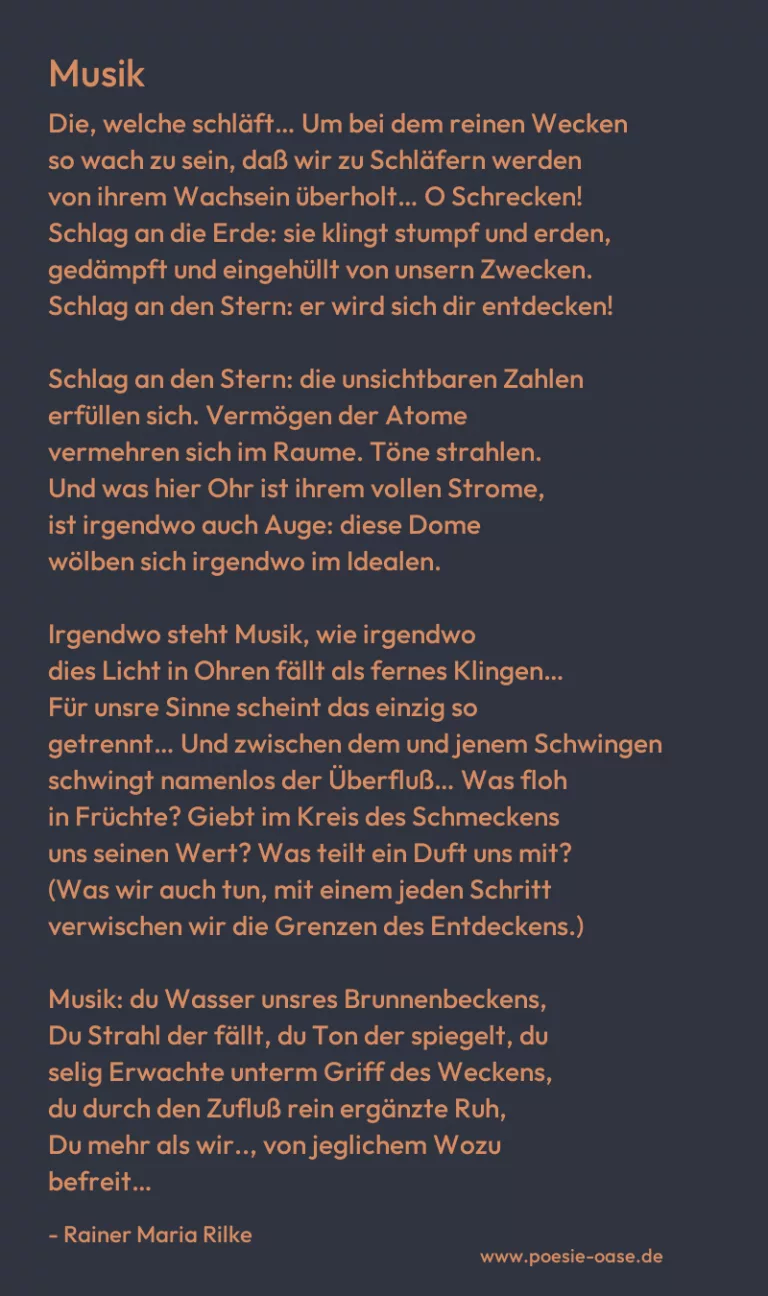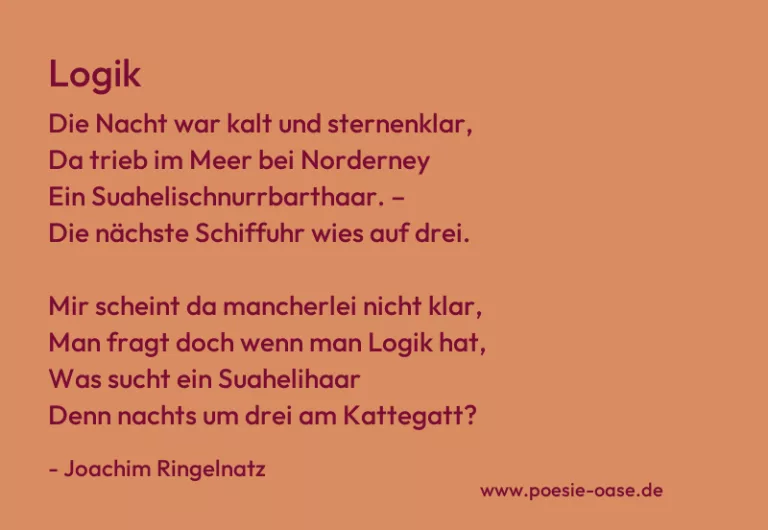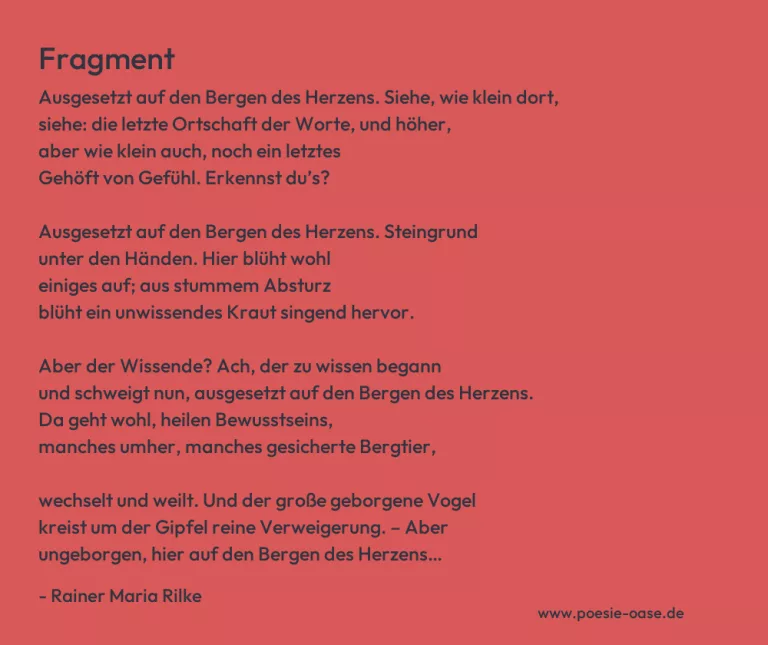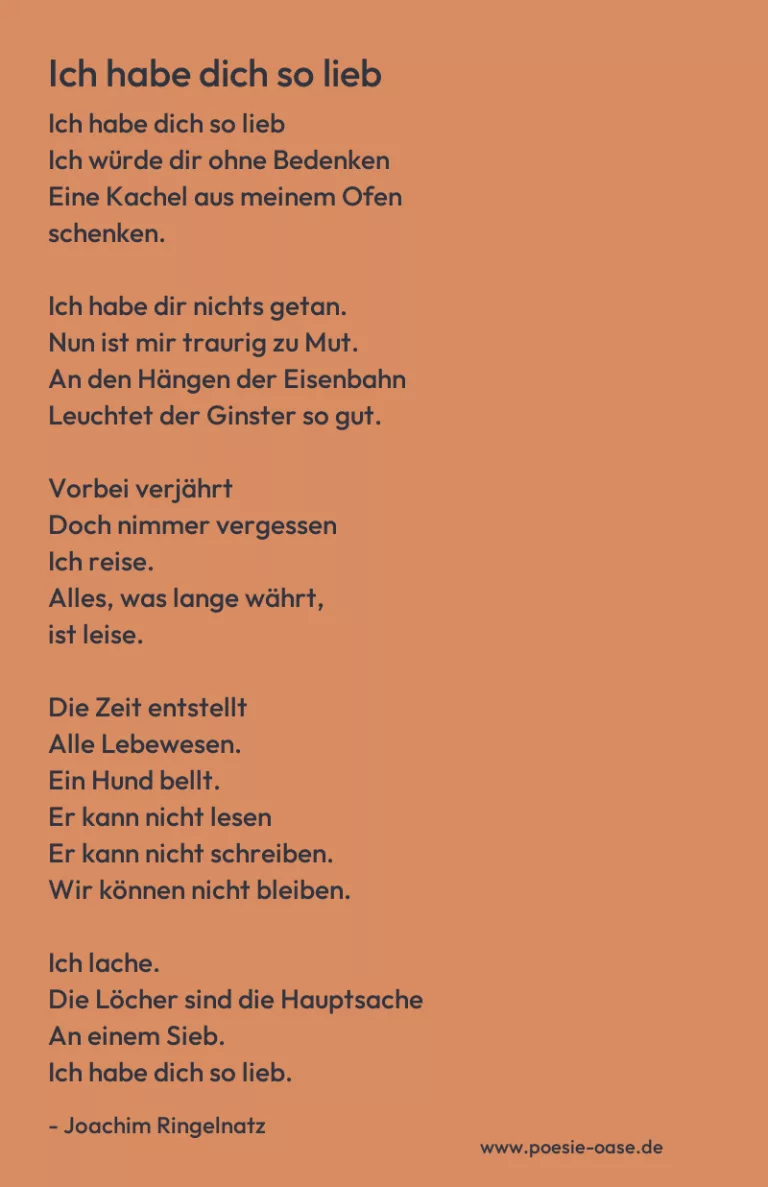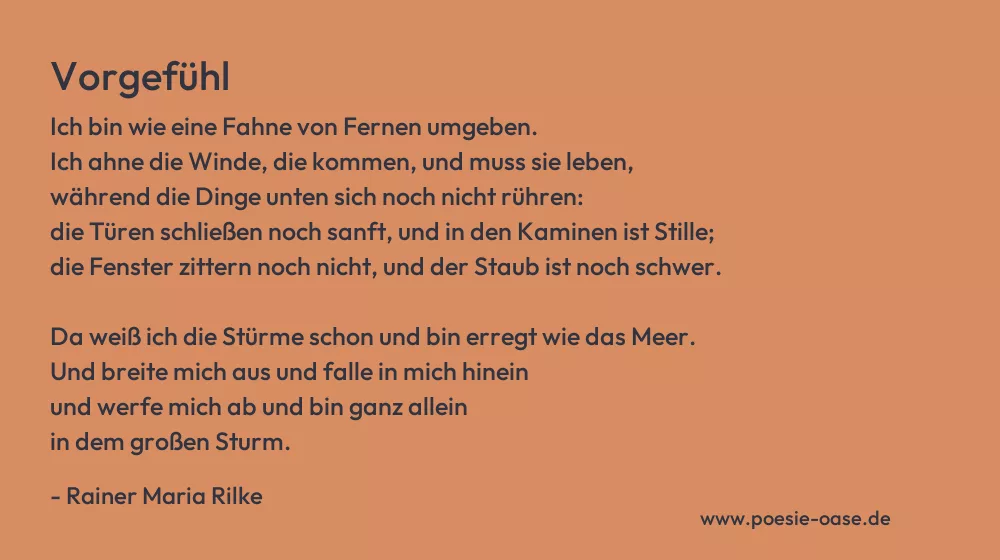Vorgefühl
Ich bin wie eine Fahne von Fernen umgeben.
Ich ahne die Winde, die kommen, und muss sie leben,
während die Dinge unten sich noch nicht rühren:
die Türen schließen noch sanft, und in den Kaminen ist Stille;
die Fenster zittern noch nicht, und der Staub ist noch schwer.
Da weiß ich die Stürme schon und bin erregt wie das Meer.
Und breite mich aus und falle in mich hinein
und werfe mich ab und bin ganz allein
in dem großen Sturm.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
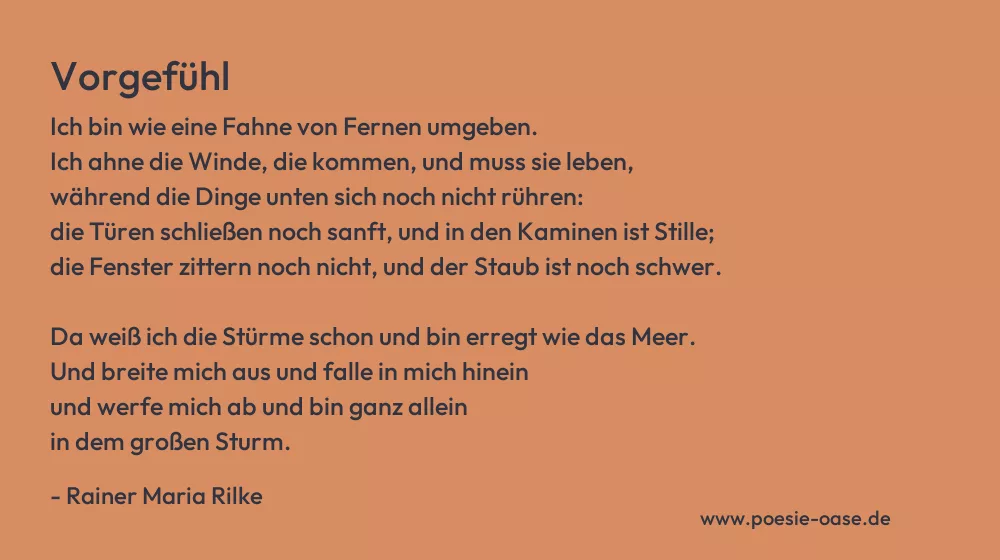
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Vorgefühl“ von Rainer Maria Rilke beschreibt eine sehr intime und emotionale Erfahrung des Ahnes und der Erwartung. Der Sprecher fühlt sich „wie eine Fahne von Fernen umgeben“, was eine bildhafte Darstellung seines Zustands der inneren Erregung ist. Die „Fahne“ symbolisiert etwas, das in den Wind gehängt wird und von ihm bewegt wird – ein Symbol für das Gefühl der Offenheit und Empfänglichkeit, das der Sprecher hat, als ob er von einer fernen Kraft oder einem kommenden Ereignis beeinflusst wird, noch bevor es tatsächlich eintritt. Diese „Fernen“ und die „Winde“, die kommen, stellen nicht nur eine äußere, sondern vor allem eine innere Bewegung dar, die der Sprecher intensiv spürt, obwohl die äußeren Zeichen der Veränderung noch nicht sichtbar sind.
Der Gegensatz zwischen der inneren Aufgewühltheit des Sprechers und der äußeren Ruhe wird in der Beschreibung der Dinge unten verdeutlicht. Die „Türen schließen noch sanft“, die „Kamine“ sind still, die „Fenster zittern noch nicht“, und der „Staub ist noch schwer“. All diese Bilder verweisen auf eine Zeit des Wartens und der Stille, in der die äußere Welt noch in Ruhe verharrt, während der Sprecher bereits eine tiefe, innere Bewegung verspürt. Diese Entfremdung von der äußeren Welt und das frühe Erkennen der Veränderung verleiht dem Gedicht eine fast übernatürliche Dimension – der Sprecher scheint Dinge zu wissen und zu fühlen, die noch nicht in der physischen Welt manifestiert sind.
Das „Vorgefühl“ des Sprechers wird in der letzten Strophe klarer. Er weiß bereits von den kommenden „Stürmen“, obwohl sie noch nicht zu sehen sind, und seine innere Erregung ist so stark wie das Meer, das sich in einem Sturm befindet. Die Metapher des Meeres als Symbol für die Erregung und das kommende Chaos wird kraftvoll und lebendig. Der Sprecher „breitet sich aus“ und „fällt in sich hinein“, was auf eine Bewegung hinweist, bei der er sich selbst auflöst oder zumindest in seine eigene innere Welt eintaucht. Der „Sturm“ scheint unaufhaltsam, und in diesem Moment der Erwartung und der inneren Ausbreitung bleibt der Sprecher schließlich „ganz allein“. Diese Einsamkeit ist keine Trennung von anderen Menschen, sondern eine tiefe innere Erfahrung, in der der Sprecher allein mit seiner eigenen Empfindung und seinem Wissen um das Kommende bleibt.
Insgesamt vermittelt das Gedicht das Gefühl eines tiefen, fast übersinnlichen Vorwissens und einer inneren Aufgewühltheit, die den Sprecher vorzeitig in Bewegung versetzt. Rilke zeigt hier auf eindrucksvolle Weise, wie der Mensch nicht nur durch die äußeren Ereignisse, sondern auch durch innere, gefühlte Vorahnungen bewegt werden kann. Es geht um das Vorwegnahmen von Veränderung und die emotionale Reaktion auf das, was noch nicht sichtbar, aber bereits spürbar ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.