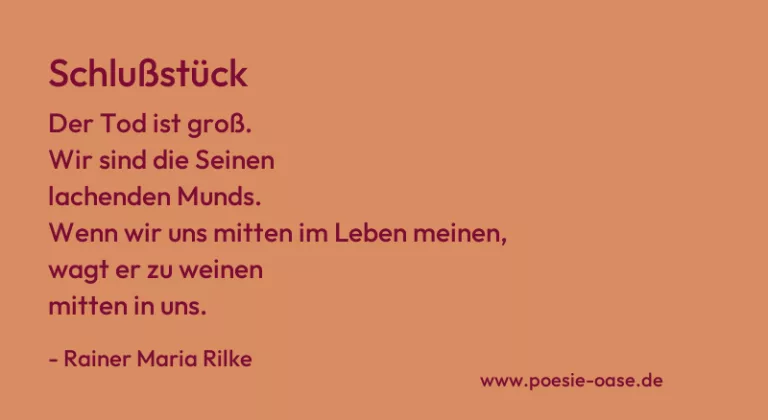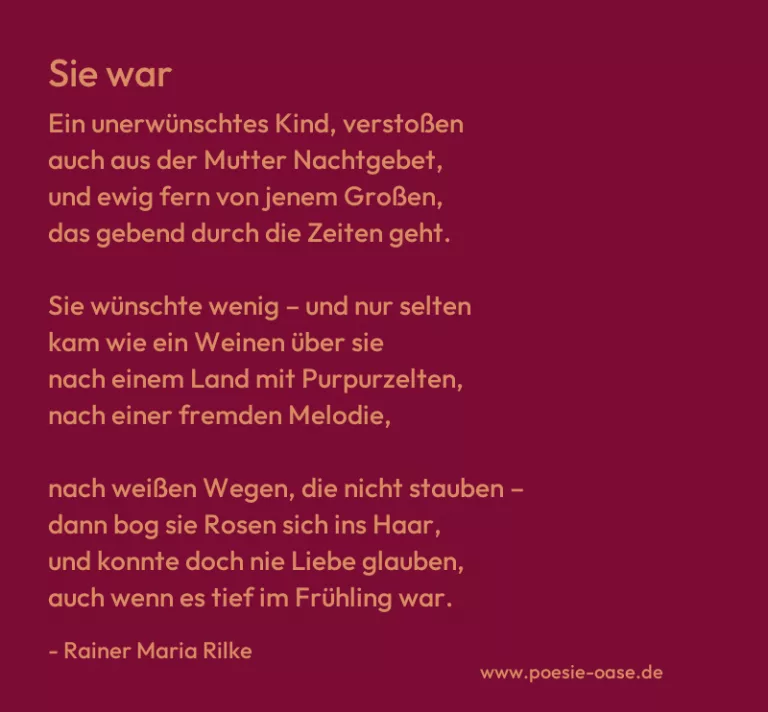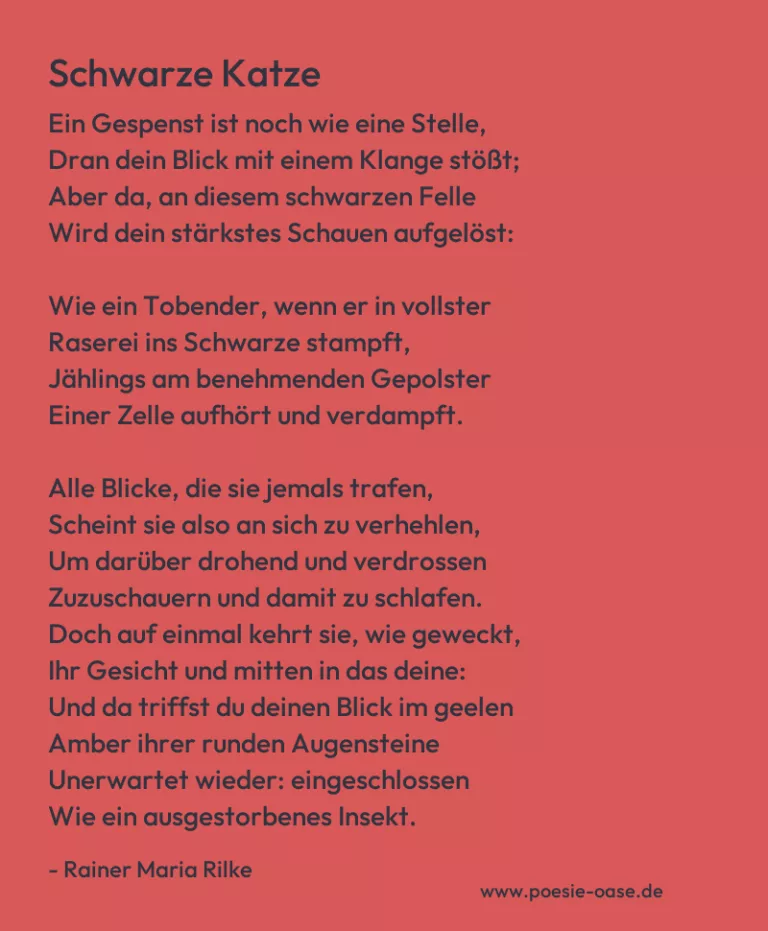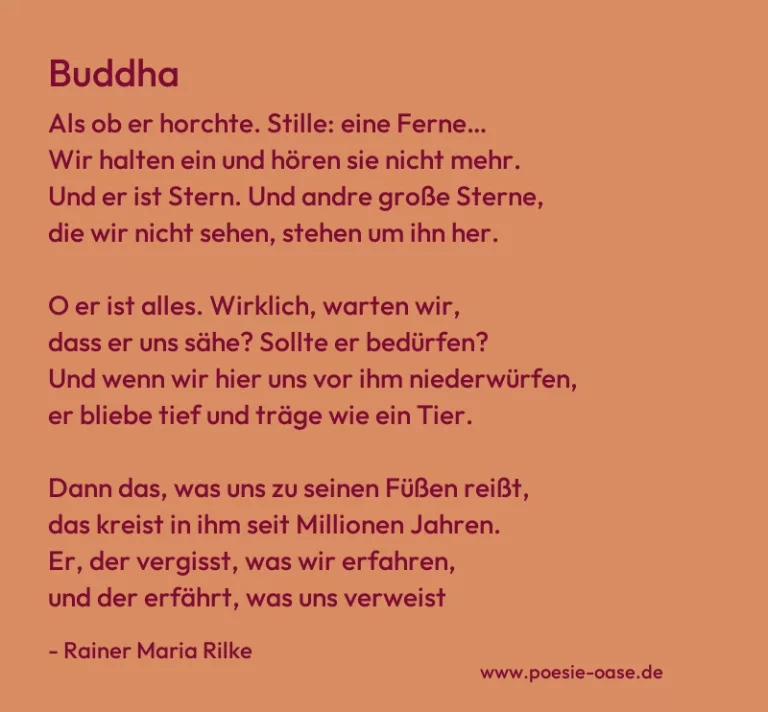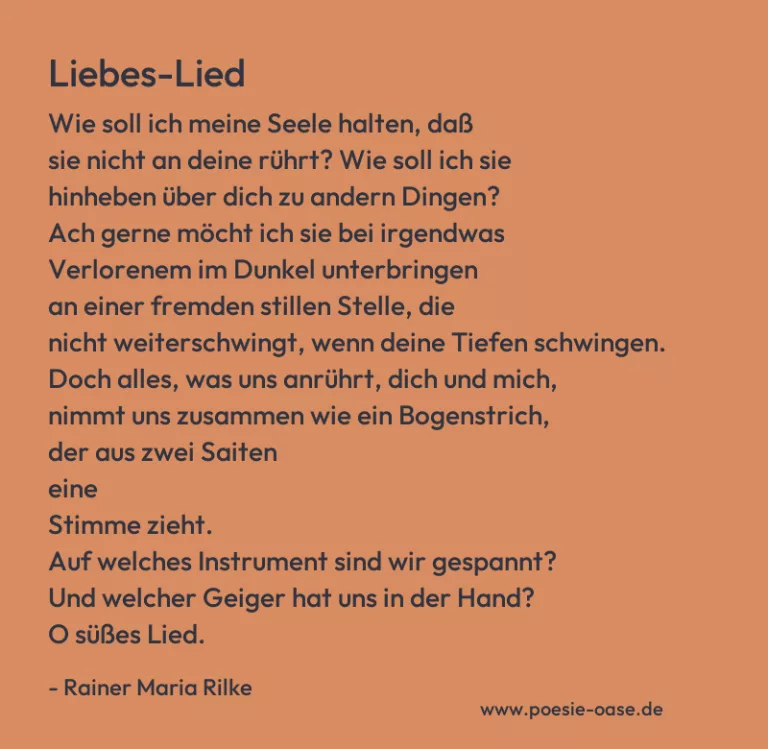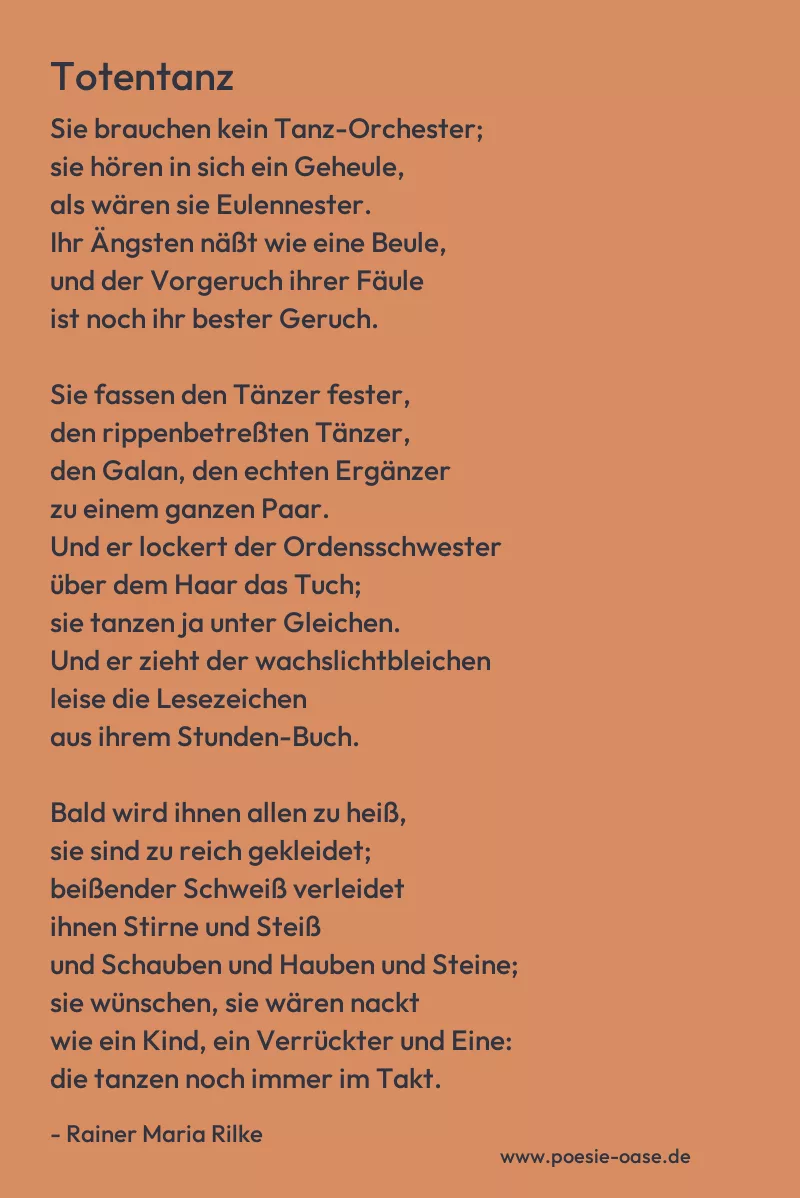Totentanz
Sie brauchen kein Tanz-Orchester;
sie hören in sich ein Geheule,
als wären sie Eulennester.
Ihr Ängsten näßt wie eine Beule,
und der Vorgeruch ihrer Fäule
ist noch ihr bester Geruch.
Sie fassen den Tänzer fester,
den rippenbetreßten Tänzer,
den Galan, den echten Ergänzer
zu einem ganzen Paar.
Und er lockert der Ordensschwester
über dem Haar das Tuch;
sie tanzen ja unter Gleichen.
Und er zieht der wachslichtbleichen
leise die Lesezeichen
aus ihrem Stunden-Buch.
Bald wird ihnen allen zu heiß,
sie sind zu reich gekleidet;
beißender Schweiß verleidet
ihnen Stirne und Steiß
und Schauben und Hauben und Steine;
sie wünschen, sie wären nackt
wie ein Kind, ein Verrückter und Eine:
die tanzen noch immer im Takt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
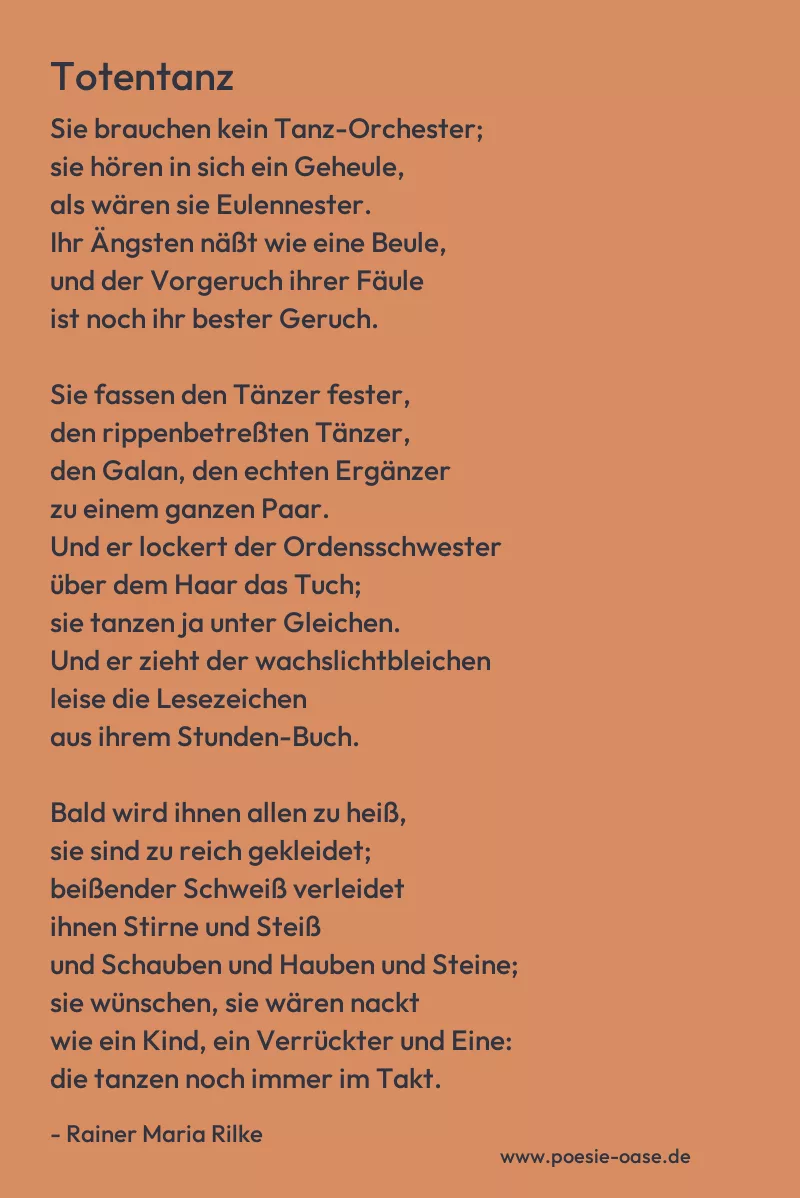
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Totentanz“ von Rainer Maria Rilke thematisiert den Tod, das Unheimliche und die Verbindung von Leben und Tod in einer düsteren, beinahe grotesken Weise. Zu Beginn beschreibt der Sprecher die „Tänzer“ als von inneren Ängsten und einem drückenden, fast körperlich greifbaren Gefühl der Fäule geprägt. Die Tänzer benötigen kein „Tanz-Orchester“, da sie in sich selbst das „Geheule“ hören, ein Klang, der auf ein inneres Chaos und die unaufhaltsame Nähe des Todes hinweist. Die metaphorische „Beule“ und der „Vorgeruch ihrer Fäule“ lassen das Bild einer vergänglichen, vom Verfall geprägten Existenz entstehen. Die Tänzer sind also nicht nur von äußerem, sondern auch von innerem Verfall und einer latenten Todesangst durchzogen.
In der zweiten Strophe wird das Bild des Tanzes weiter entfaltet. Der „Tänzer“ wird „fester“ gefasst, und die „Ordensschwester“ verliert ihr Tuch. Hier wird der Tanz nicht nur als körperliche Bewegung, sondern auch als ein symbolisches Verschmelzen von Leben und Tod verstanden. Die „Ordensschwester“ könnte eine Figur der Reinheit oder Askese sein, die durch den Tanz – als symbolische Vereinigung mit dem Tod – ihre Form und ihren Status verliert. Der „Tänzer“ zieht der Schwester „leise die Lesezeichen aus ihrem Stunden-Buch“, was auf die Auflösung der Zeit und des gelebten Lebens hinweist. Die Lesezeichen sind Symbole für vergangene Momente und die Orientierung im Leben, die im Angesicht des Todes ihre Bedeutung verlieren.
Die Darstellung der Tänzer im weiteren Verlauf des Gedichts wird zunehmend grotesk. Der „Schweiß“ und die „Schauben“ deuten auf den körperlichen Verfall und die Entfremdung der Tänzer von ihrem Körper hin. Die „Schauben und Hauben“ (Teile ihrer Kleidung) und die „Steine“ symbolisieren die Lasten des Lebens, die sie mit sich tragen, während sie dennoch weiter im Takt tanzen, als ob sie den Verfall und das Unvermeidliche nicht wahrnehmen. Der Wunsch, „nackt wie ein Kind“ zu sein, verweist auf das Bedürfnis nach einer Rückkehr zu einer ursprünglichen, reineren Existenz, die frei von den Belastungen des Lebens und des Verfalls ist. Doch auch dieser Wunsch bleibt unerfüllt – die Tänzer tanzen weiterhin im Takt, unaufhaltsam und ohne Ausweg.
Das Gedicht endet mit der Darstellung eines Verfalls, der sowohl physisch als auch geistig zu sein scheint, und einer unaufhörlichen Bewegung hin zum Tod. Der Tanz, der als symbolische Vereinigung von Leben und Tod verstanden werden kann, bleibt in seiner grotesken Form bestehen, selbst wenn sich die Tänzer nach einer Rückkehr in einen unschuldigen Zustand sehnen. Rilke lässt den Tod nicht als einen klaren, endlichen Moment erscheinen, sondern als einen ständigen Begleiter im Tanz des Lebens. Der „Totentanz“ wird so zu einem Bild für die menschliche Existenz als einen ständigen Prozess des Verfalls und der Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.