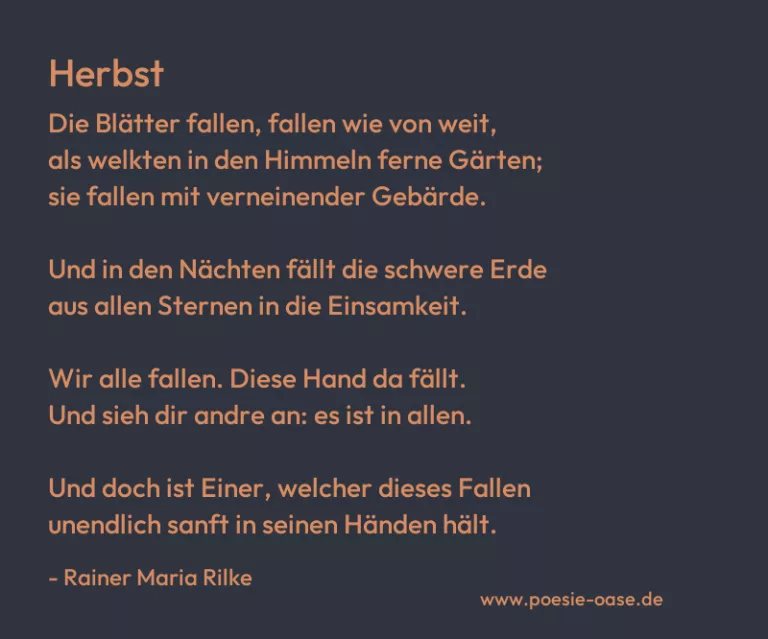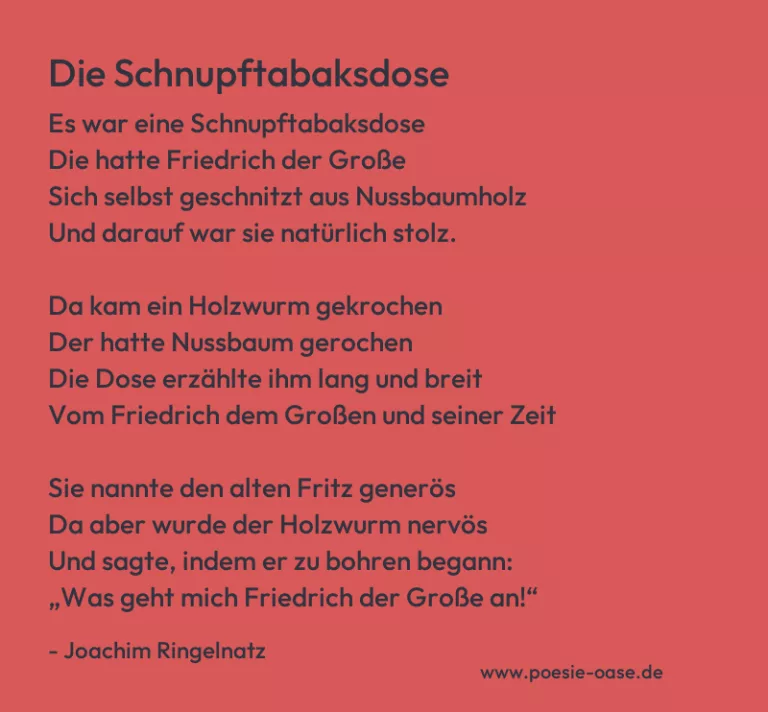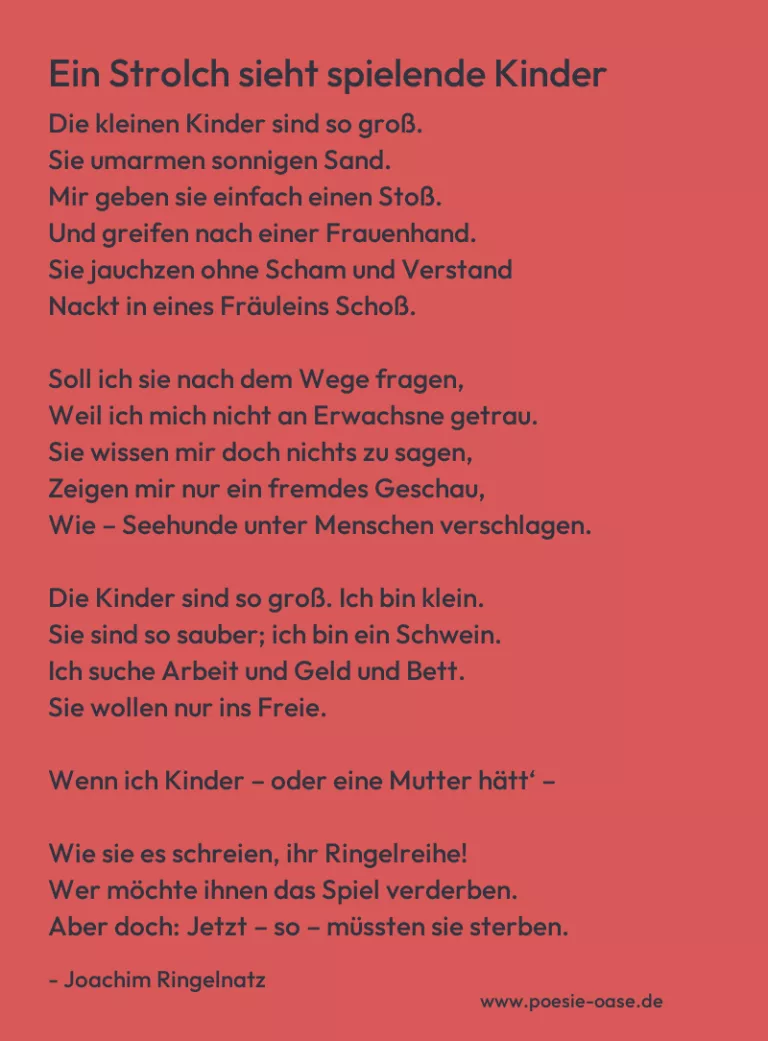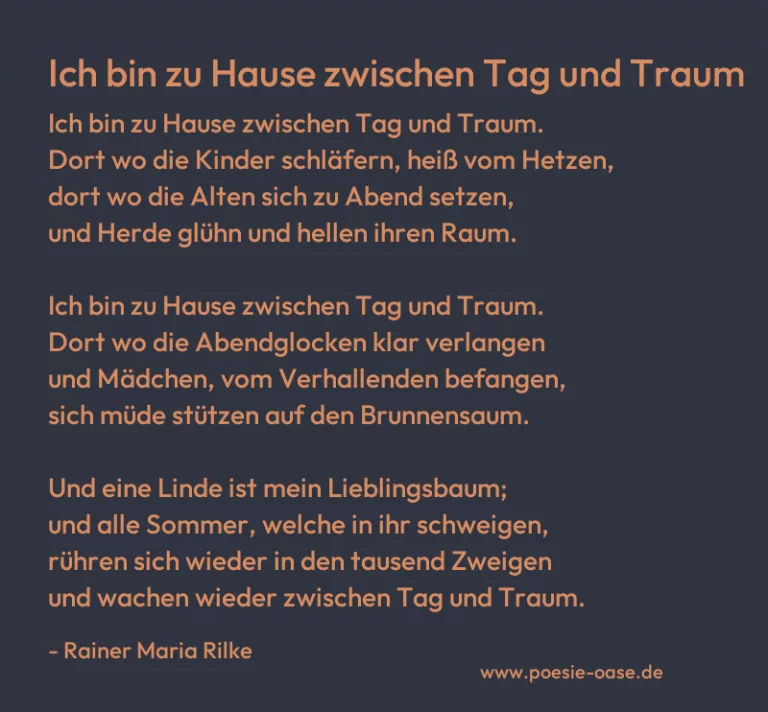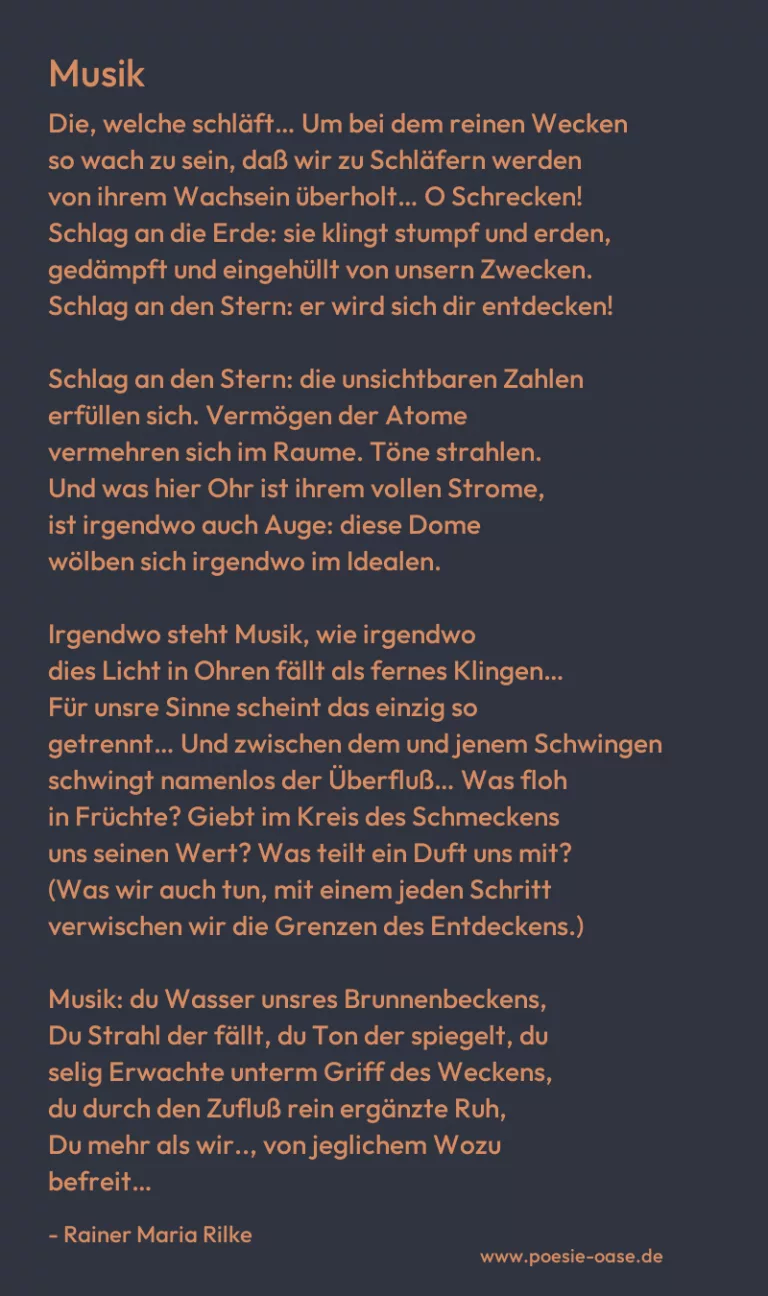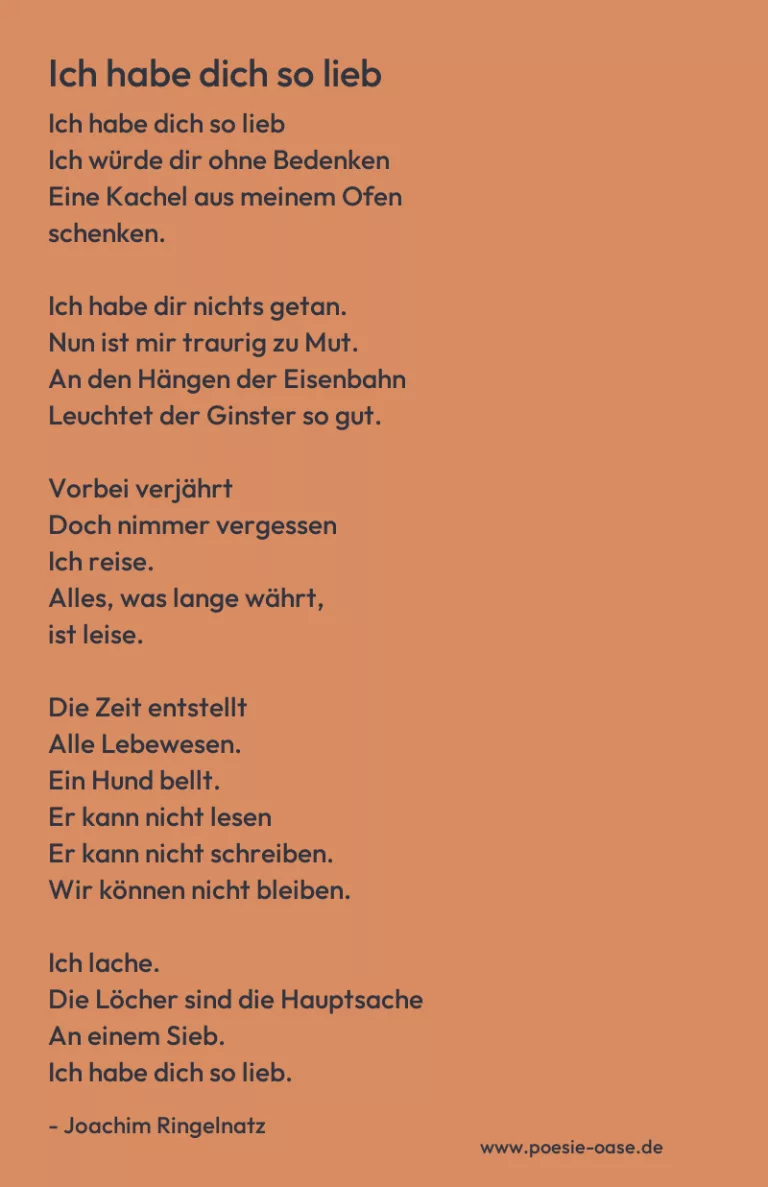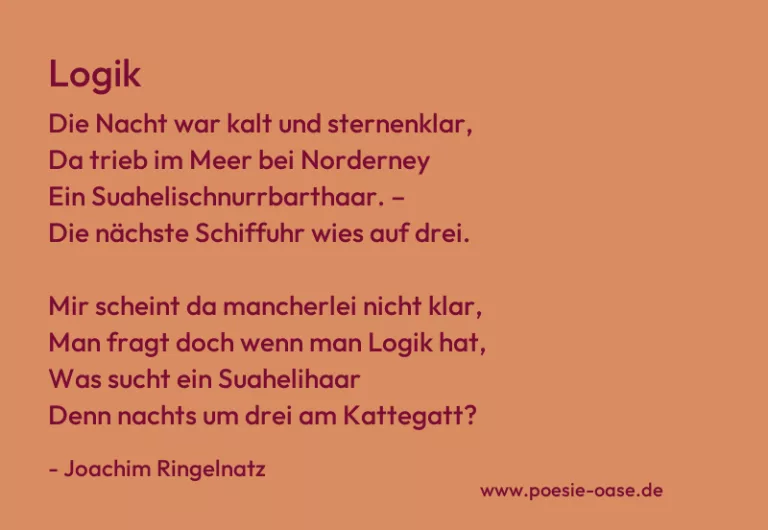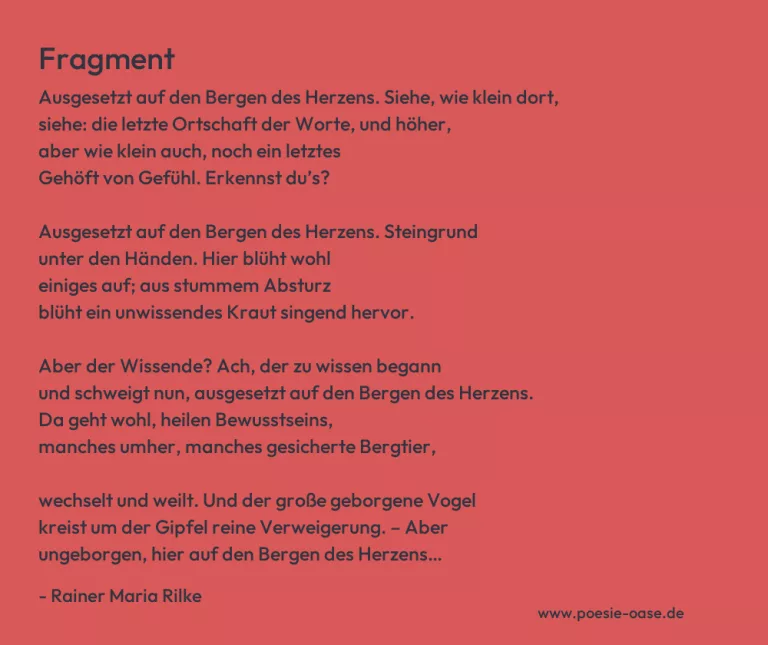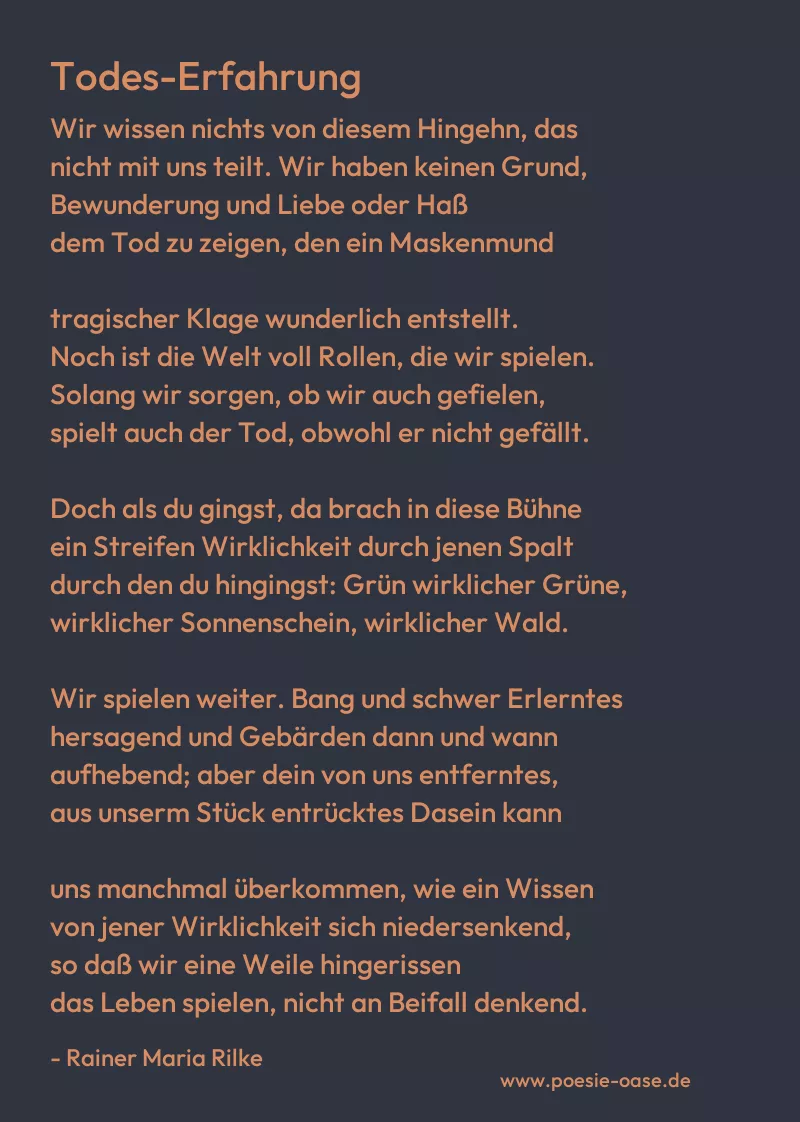Todes-Erfahrung
Wir wissen nichts von diesem Hingehn, das
nicht mit uns teilt. Wir haben keinen Grund,
Bewunderung und Liebe oder Haß
dem Tod zu zeigen, den ein Maskenmund
tragischer Klage wunderlich entstellt.
Noch ist die Welt voll Rollen, die wir spielen.
Solang wir sorgen, ob wir auch gefielen,
spielt auch der Tod, obwohl er nicht gefällt.
Doch als du gingst, da brach in diese Bühne
ein Streifen Wirklichkeit durch jenen Spalt
durch den du hingingst: Grün wirklicher Grüne,
wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald.
Wir spielen weiter. Bang und schwer Erlerntes
hersagend und Gebärden dann und wann
aufhebend; aber dein von uns entferntes,
aus unserm Stück entrücktes Dasein kann
uns manchmal überkommen, wie ein Wissen
von jener Wirklichkeit sich niedersenkend,
so daß wir eine Weile hingerissen
das Leben spielen, nicht an Beifall denkend.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
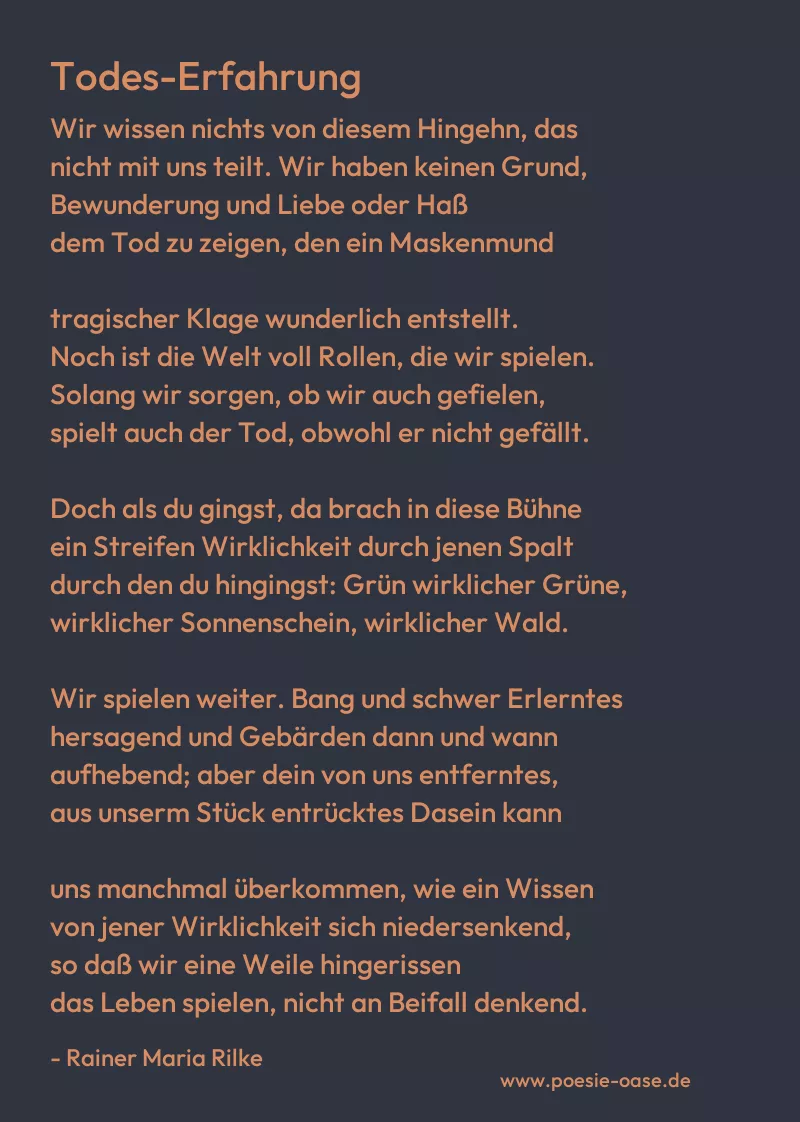
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Todes-Erfahrung“ von Rainer Maria Rilke reflektiert die Konfrontation mit dem Tod als eine Erfahrung, die den Menschen grundsätzlich verschlossen bleibt – bis zu dem Moment, in dem jemand Nahestehendes stirbt. Rilke stellt den Tod nicht als abstraktes Ende, sondern als Durchbruch einer tieferen Wirklichkeit dar, die das gewöhnliche, oft theatralisch inszenierte Leben infrage stellt.
In den ersten beiden Strophen thematisiert das lyrische Ich die Unwissenheit gegenüber dem Tod. Dieser wird oft verzerrt dargestellt – durch kulturelle oder literarische Klischees („Maskenmund / tragischer Klage“). Das Leben erscheint als eine Bühne voller Rollen, und auch der Tod wird auf dieser Bühne gespielt, bleibt aber als Figur fremd und unecht. Solange wir darauf bedacht sind, „zu gefallen“, bleiben wir in der Sphäre des Spiels, der Illusion.
Der Wendepunkt des Gedichts ist der tatsächliche Tod eines geliebten Menschen („Doch als du gingst…“). In diesem Moment zerreißt der Schleier des Bühnenspiels, und durch einen „Spalt“ dringt ein „Streifen Wirklichkeit“ ein. Rilke verwendet eine starke Bildsprache mit „Grün wirklicher Grüne“, „wirklicher Sonnenschein“ und „wirklicher Wald“, um eine Welt zu beschreiben, die jenseits der menschlichen Darstellung liegt – eine Dimension, die echter und unmittelbarer ist als das Leben auf der „Bühne“.
Diese Erfahrung hinterlässt Spuren. Auch wenn das Leben weitergeht, das Rollenspiel weitergespielt wird, bleibt etwas zurück: die Ahnung dieser anderen Wirklichkeit. In besonderen Momenten „überkommt“ dieses Wissen das lyrische Ich – nicht als konkretes Verstehen, sondern als innere Ergriffenheit. Für kurze Zeit wird das Leben dann echt, losgelöst vom Streben nach Anerkennung, getragen von einer stillen Erkenntnis.
Rilkes Gedicht verwebt existenzielle Tiefe mit poetischer Klarheit. Es zeigt, dass der Tod – so unzugänglich er bleibt – in der persönlichen Erfahrung eine erschütternde Öffnung zur Wahrheit sein kann. Nicht als dramatisches Ereignis, sondern als stille Erleuchtung, die unser Spiel durchdringt und das Leben einen Moment lang aus seiner Oberfläche herauslöst.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.