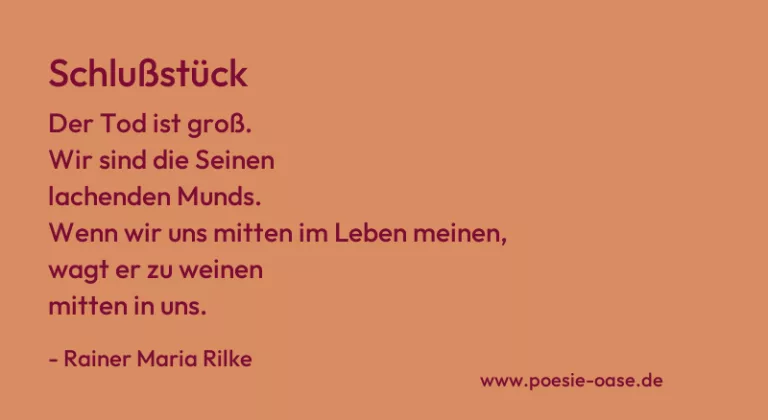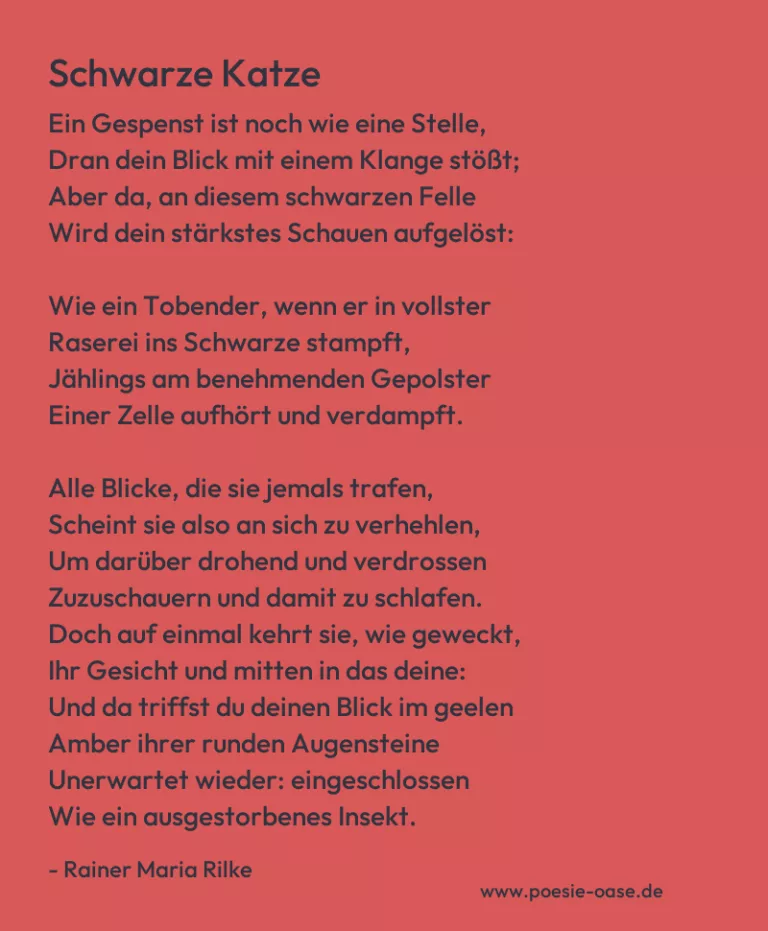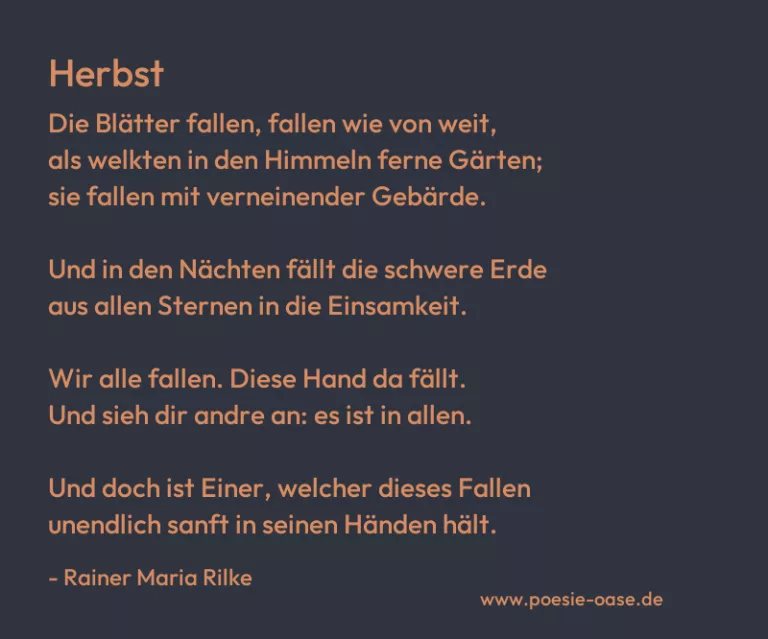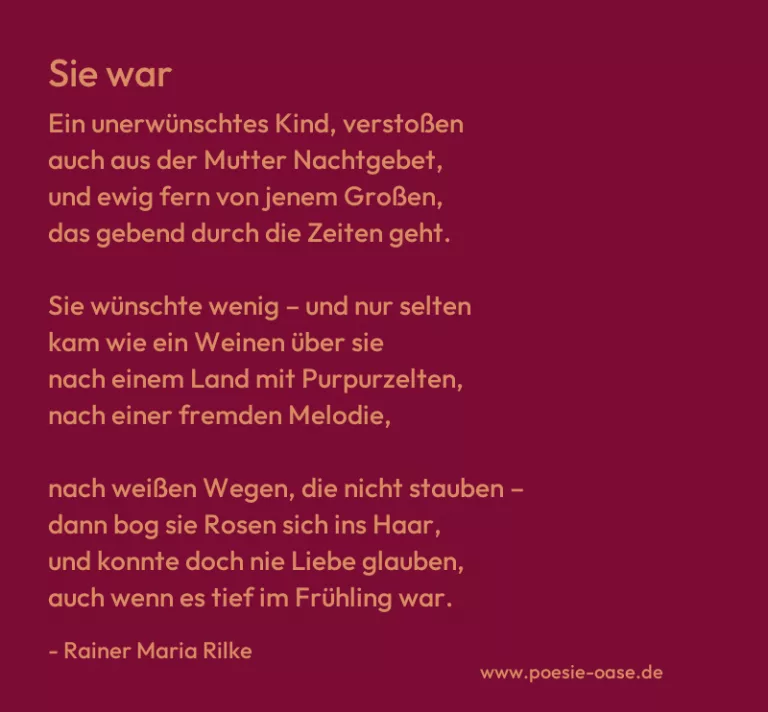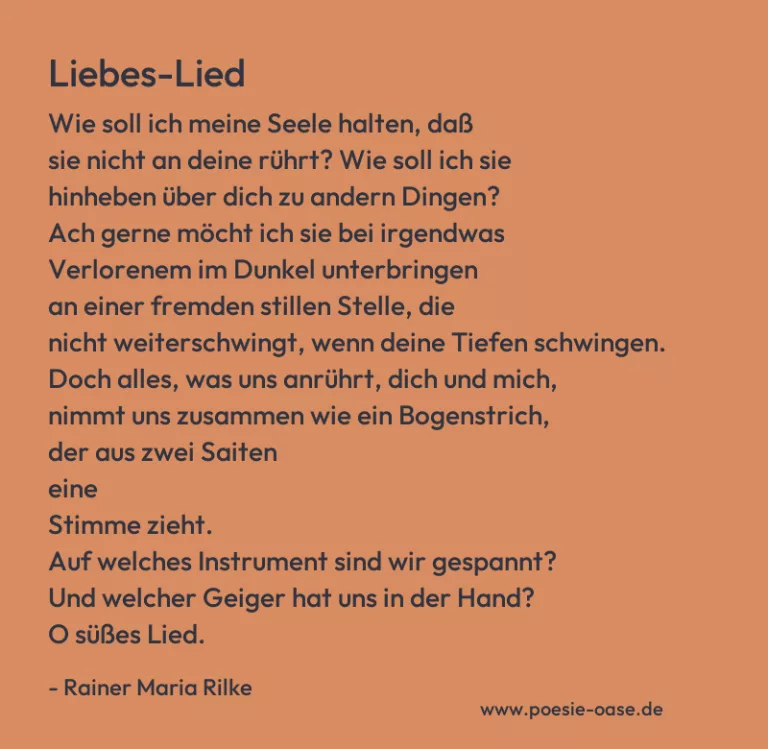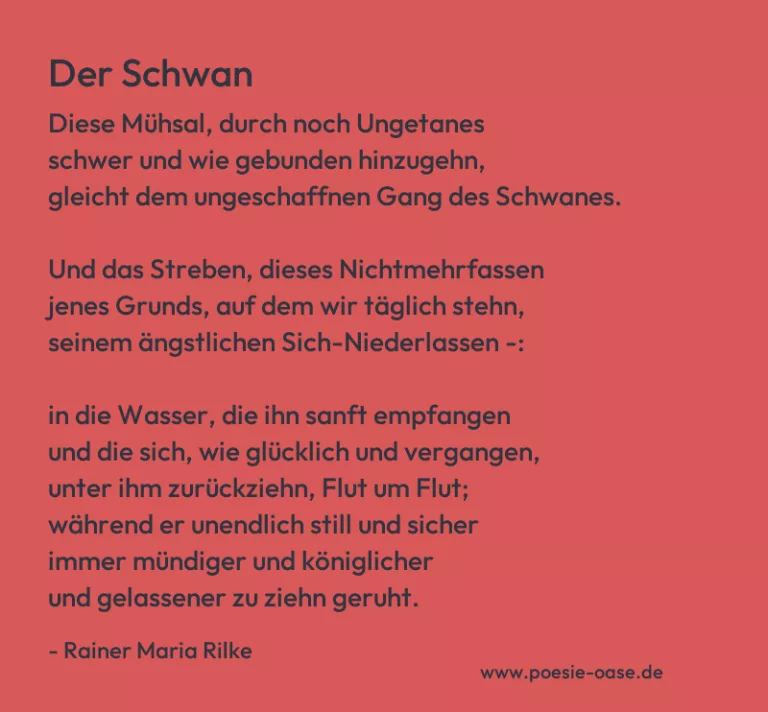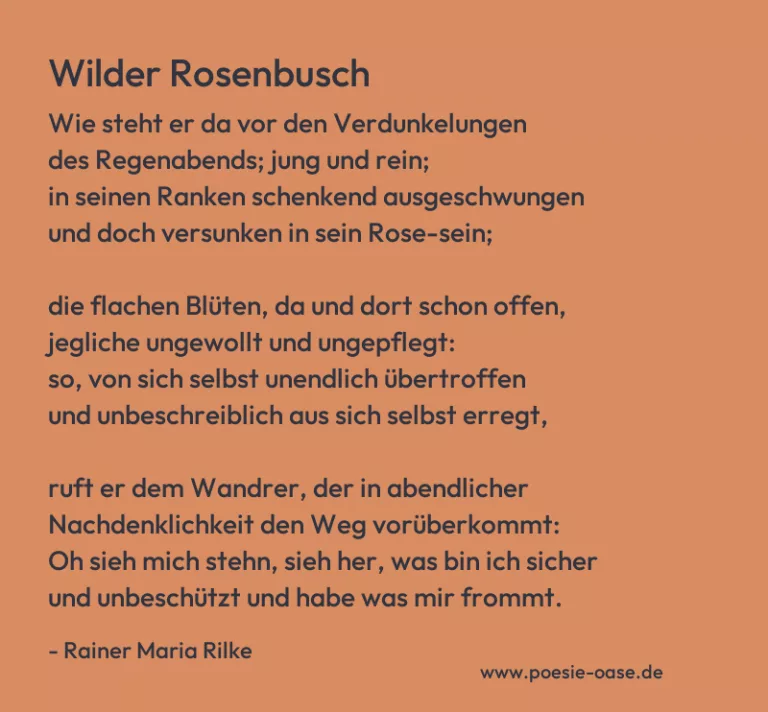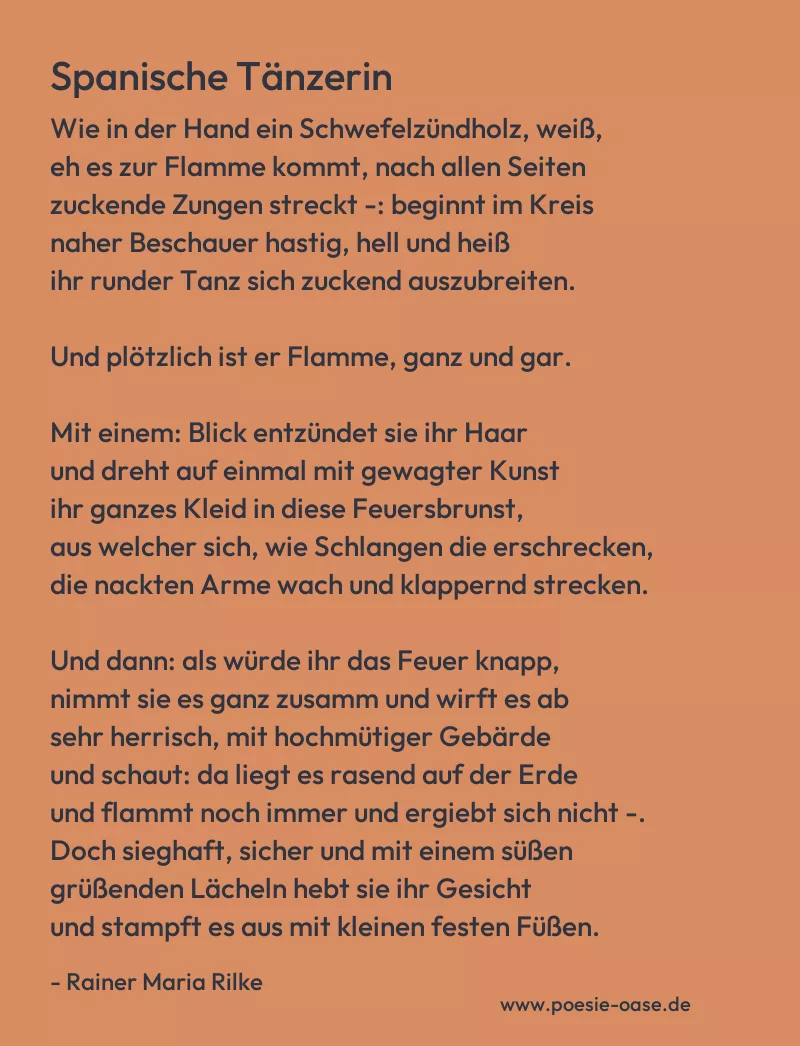Spanische Tänzerin
Wie in der Hand ein Schwefelzündholz, weiß,
eh es zur Flamme kommt, nach allen Seiten
zuckende Zungen streckt -: beginnt im Kreis
naher Beschauer hastig, hell und heiß
ihr runder Tanz sich zuckend auszubreiten.
Und plötzlich ist er Flamme, ganz und gar.
Mit einem: Blick entzündet sie ihr Haar
und dreht auf einmal mit gewagter Kunst
ihr ganzes Kleid in diese Feuersbrunst,
aus welcher sich, wie Schlangen die erschrecken,
die nackten Arme wach und klappernd strecken.
Und dann: als würde ihr das Feuer knapp,
nimmt sie es ganz zusamm und wirft es ab
sehr herrisch, mit hochmütiger Gebärde
und schaut: da liegt es rasend auf der Erde
und flammt noch immer und ergiebt sich nicht -.
Doch sieghaft, sicher und mit einem süßen
grüßenden Lächeln hebt sie ihr Gesicht
und stampft es aus mit kleinen festen Füßen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
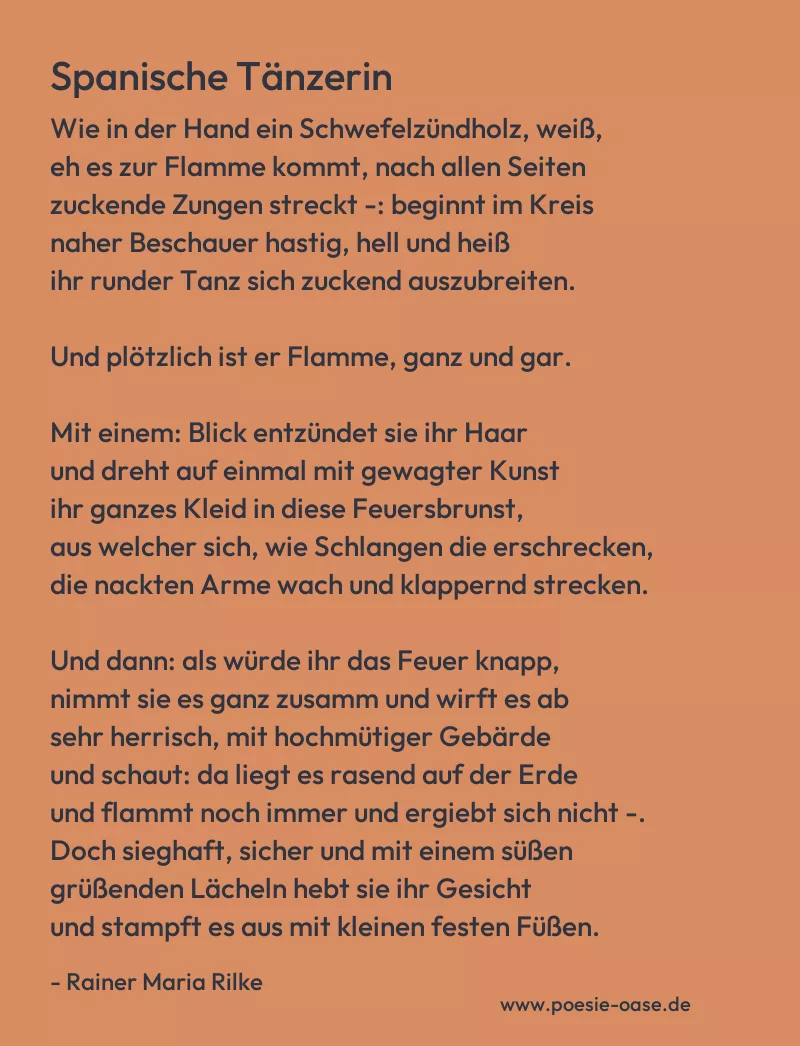
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Spanische Tänzerin“ von Rainer Maria Rilke beschreibt die explosive und kraftvolle Darstellung einer spanischen Tänzerin, deren Tanz von einer Metaphorik des Feuers und der Zerstörung geprägt ist. Zu Beginn wird der Tanz mit dem Bild eines Schwefelzündholzes verglichen, das „zuckende Zungen“ ausstreckt, „eh es zur Flamme kommt“. Dieses Bild unterstreicht die explosive Energie, die im Tanz steckt, noch bevor die Tänzerin selbst zur eigentlichen Flamme wird. Der Tanz breitet sich „zuckend“ aus, was sowohl die körperliche Bewegung als auch die Entfaltung von Leidenschaft und Energie symbolisiert.
Der Moment, in dem die Tänzerin zu „Flamme“ wird, markiert einen Wendepunkt, an dem sie sich mit der Hitze und Intensität des Tanzes vollständig vereint. Der „Blick“, mit dem sie „ihr Haar entzündet“, stellt eine bildhafte Darstellung ihrer inneren Kraft und Kontrolle über die Flamme dar. Der Tanz wird zunehmend gewagter und künstlerischer, als sie „ihr ganzes Kleid in diese Feuersbrunst“ dreht und ihre „nackten Arme“ mit der „Feuersbrunst“ in einer Art Verwandlung vereint. Die „Schlangen“, die sich erschrecken, symbolisieren die Gefahr und die unberechenbare Energie des Feuers, die in der Bewegung ihrer Arme lebendig wird.
Das Gedicht bringt die Zerstörungskraft der Tänzerin zum Vorschein, als sie das Feuer schließlich „zusammennimmt“ und „wirft“, in einer aktiven, beinahe überheblichen Geste. Diese Handlung stellt nicht nur die Macht über das Feuer dar, sondern auch die Kontrolle und die Beherrschung der eigenen Leidenschaft und Energie. Die Tänzerin sieht das Feuer, das noch immer „flammt“, als etwas, das sich ihrer Kontrolle nicht entziehen kann. Diese Szene hat etwas von einer „Herrin“, die den Tanz und das Feuer beherrscht, als Symbol ihrer Dominanz und Selbstsicherheit.
Im letzten Abschnitt des Gedichts zeigt sich die Tänzerin als souverän und sieghaft. Mit einem „süßen grüßenden Lächeln“ und einem festen „Stampfen“ auf dem Boden verbannt sie das Feuer endgültig. Die „kleinen festen Füße“ stellen den Triumph der Tänzerin über das, was sie geschaffen und beherrscht hat, dar. Sie hat das Feuer nicht nur kontrolliert, sondern es auch gezähmt und besiegt, was ihre innere Stärke und Selbstbewusstsein unterstreicht. Rilke beschreibt die Tänzerin als eine kraftvolle und entschlossene Figur, die mit einer Mischung aus Kunstfertigkeit, Leidenschaft und Herrschaft über ihre eigene Energie einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Der Tanz wird so zu einer Metapher für das Leben selbst – voller Intensität, Gefahr und schließlich einer triumphalen Beherrschung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.