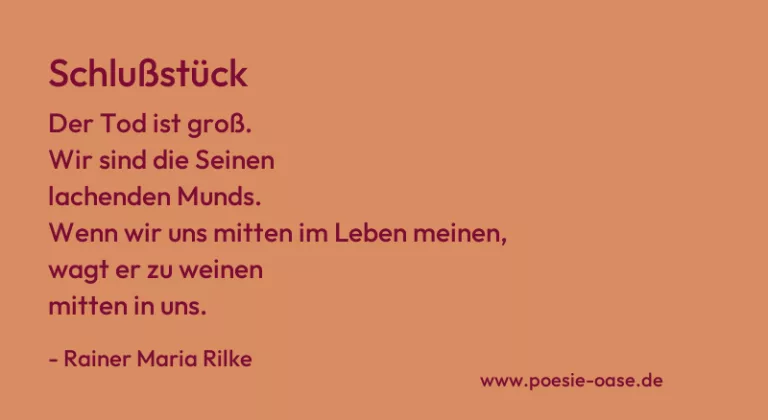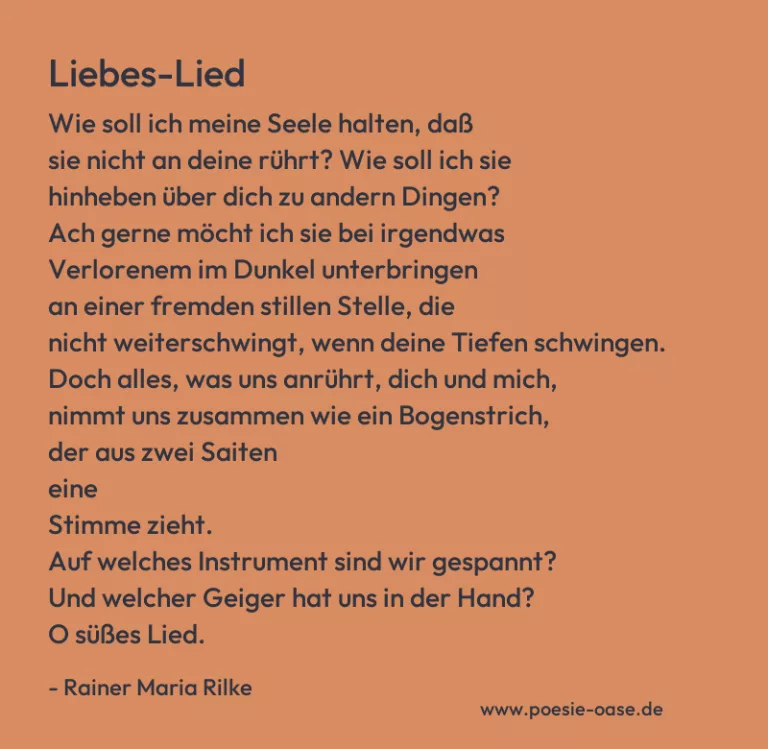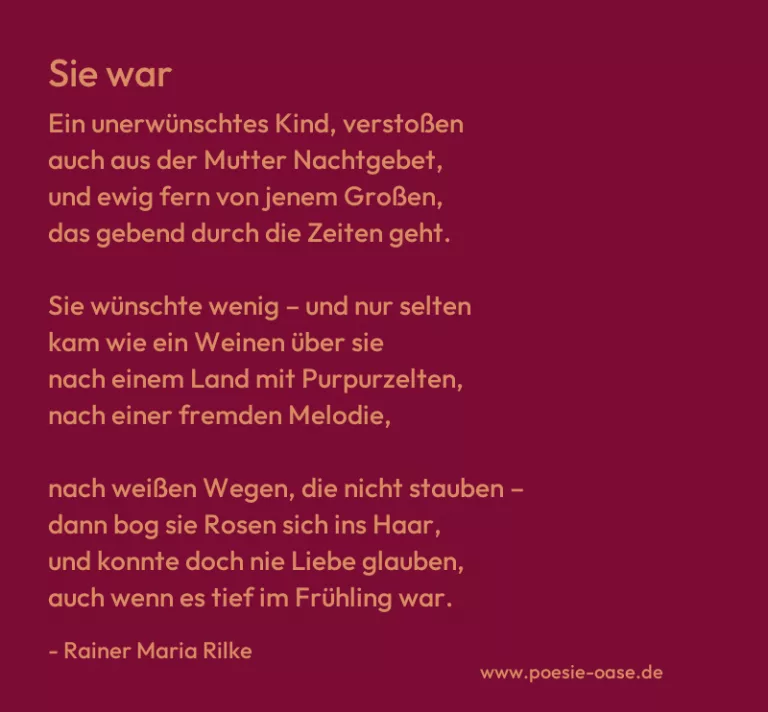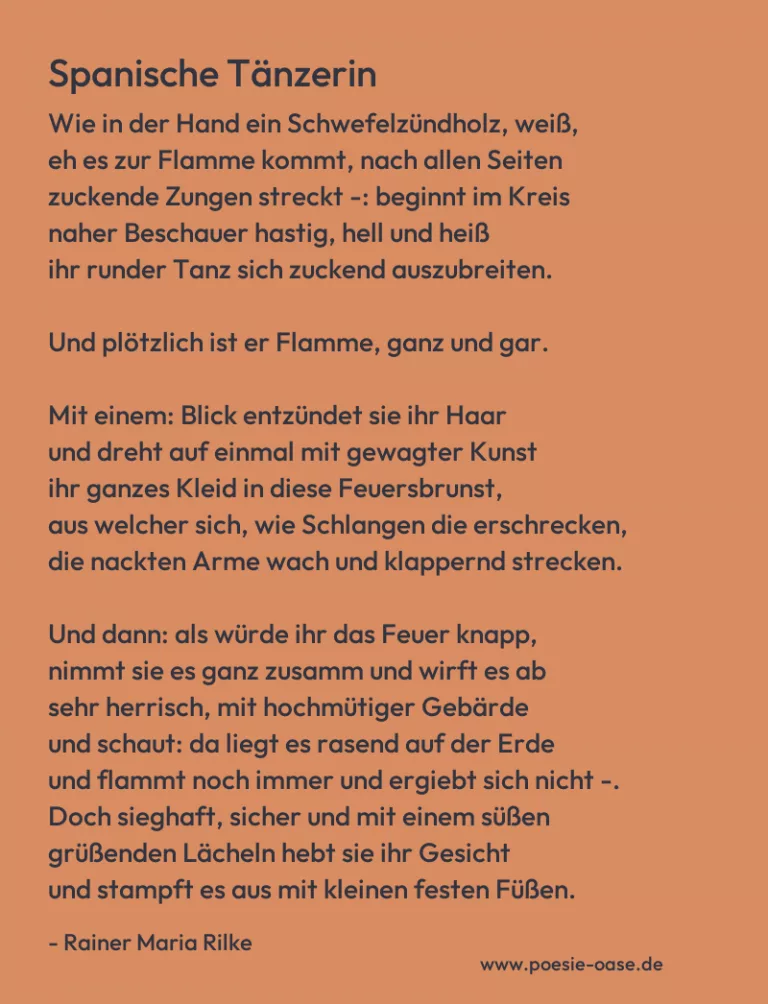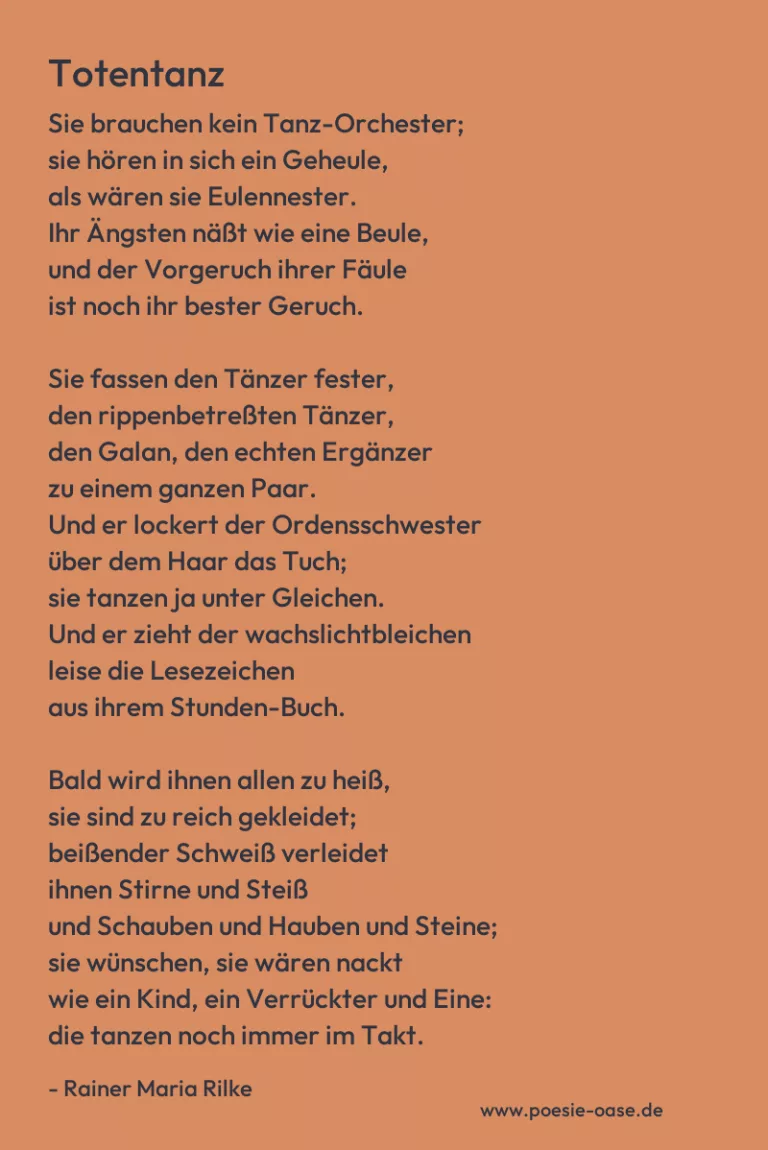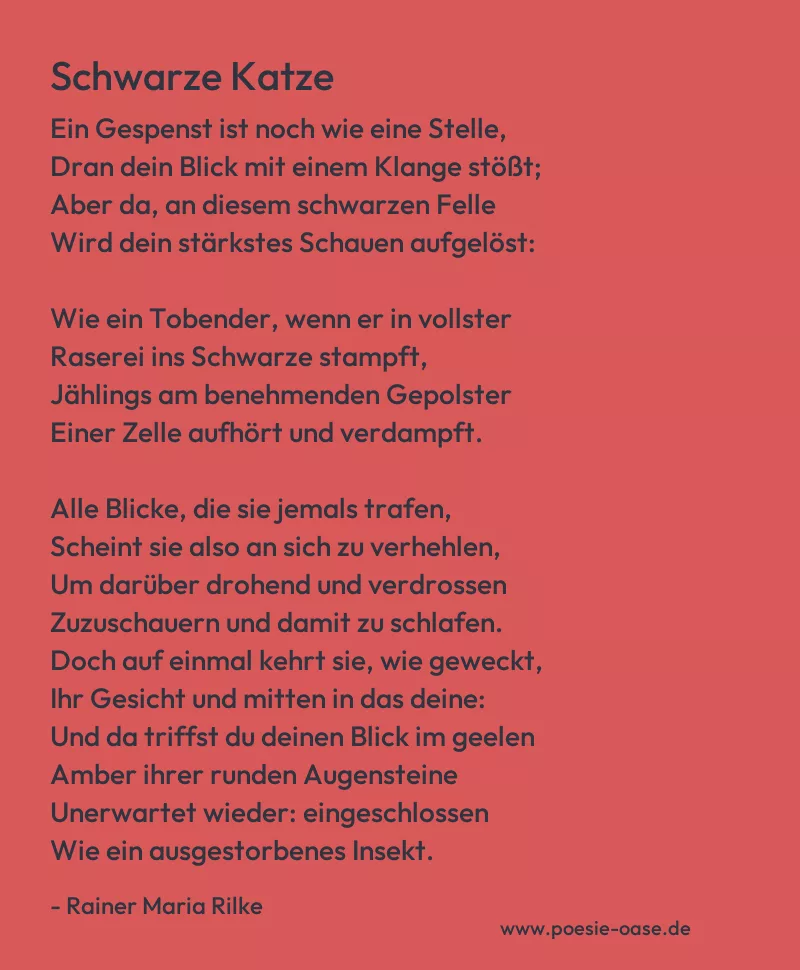Schwarze Katze
Ein Gespenst ist noch wie eine Stelle,
Dran dein Blick mit einem Klange stößt;
Aber da, an diesem schwarzen Felle
Wird dein stärkstes Schauen aufgelöst:
Wie ein Tobender, wenn er in vollster
Raserei ins Schwarze stampft,
Jählings am benehmenden Gepolster
Einer Zelle aufhört und verdampft.
Alle Blicke, die sie jemals trafen,
Scheint sie also an sich zu verhehlen,
Um darüber drohend und verdrossen
Zuzuschauern und damit zu schlafen.
Doch auf einmal kehrt sie, wie geweckt,
Ihr Gesicht und mitten in das deine:
Und da triffst du deinen Blick im geelen
Amber ihrer runden Augensteine
Unerwartet wieder: eingeschlossen
Wie ein ausgestorbenes Insekt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
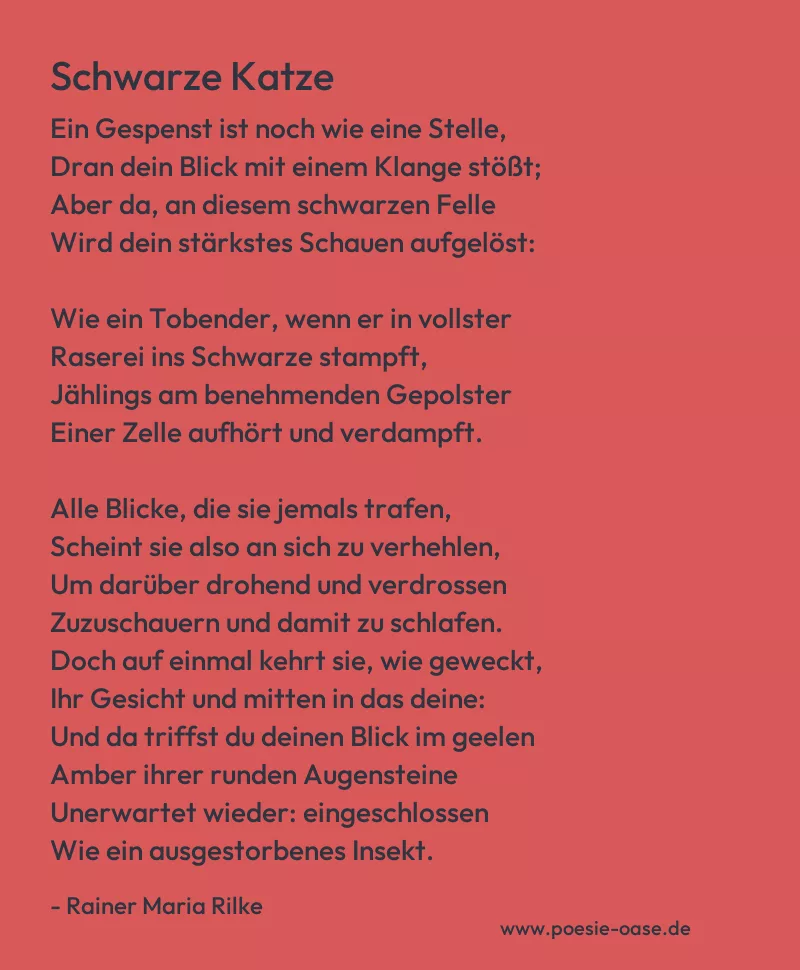
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Schwarze Katze“ von Rainer Maria Rilke beschreibt auf eindrucksvolle Weise die geheimnisvolle und beinahe unheimliche Präsenz einer schwarzen Katze. Zu Beginn wird das Bild des „Gespenstes“ verwendet, das den Blick des Lesers anzieht, als ob es eine Stelle oder ein unbestimmtes Etwas ist, das er fasst, aber nicht wirklich begreifen kann. Die schwarze Katze wird zunächst als ein ungreifbares und flüchtiges Wesen dargestellt, dessen Erscheinung den Blick des Betrachters „aufgelöst“ und in eine Art Unsicherheit oder Unklarheit versetzt. Diese Unbestimmtheit und die mystische Aura der Katze werden durch die Bildsprache der „Raserei“ und des „Schwarzen“ verstärkt – das Bild des „Tobenden“, der im höchsten Zorn in das „Schwarze stampft“, steht für eine plötzliche, unkontrollierte Bewegung, die letztlich in der Ruhe des „Gepolsterten einer Zelle“ endet. Diese Zelle könnte als Metapher für das Verborgene, das Unergründliche im Inneren der Katze verstanden werden.
In der zweiten Strophe wird die Katze selbst als eine Figur der Verschlossenheit und der Geheimnishaftigkeit beschrieben. Sie scheint „alle Blicke, die sie jemals trafen“, zu „verhehlen“, was ihre undurchdringliche Natur noch weiter betont. Die Katze verhält sich „drohend und verdrossen“, als ob sie sich ihrer selbst bewusst ist und sich gleichzeitig von der Welt fernhält. Diese Darstellung der Katze als ein Wesen, das seine Emotionen und Absichten verbirgt, während sie gleichzeitig mit einer bedrohlichen Präsenz über die Umgebung „zuschaut“, erzeugt ein Gefühl der Entfremdung und der Unnahbarkeit.
Der überraschende Wendepunkt kommt, als die Katze plötzlich ihr Gesicht „kehrt“ und dem Betrachter „mitten in das deine“ blickt. In diesem Moment wird die Katze zu einem Spiegelbild des Blickes des Betrachters, was den Eindruck erweckt, dass der Beobachtende von der Katze in gewisser Weise „eingeschlossen“ wird. Die „geelen Amber ihrer runden Augensteine“ – ein Bild von goldenen Augen, die wie Bernstein glänzen – erzeugen eine fast hypnotische Wirkung. Der „geele Amber“ verweist auf eine Art von Verzauberung oder Festgehaltenwerden, das der Betrachter in den Augen der Katze sieht. Die Darstellung des „ausgestorbenen Insekts“ als Metapher für das Gefühl, in einem stillen Moment eingefangen zu sein, unterstreicht das Gefühl der Verlorenheit oder der Hilflosigkeit, das beim Blickkontakt mit der Katze entsteht.
Das Gedicht insgesamt schafft eine Atmosphäre der Geheimnisumwitterung und der Irritation. Die schwarze Katze, die zu Beginn wie ein Gespenst oder ein unbestimmtes Etwas erscheint, wird im Verlauf des Gedichts zu einer Konstante, die den Blick des Betrachters in ihrer mystischen und fast unheimlichen Weise festhält. Rilke stellt die Katze als ein Symbol für das Unerklärliche und das Unbewusste dar – ein Wesen, das sich der vollen Wahrnehmung entzieht, aber gleichzeitig tief in das Innere des Betrachters eindringt. Die Katze wird hier zu einem Spiegel für den Leser, in dem er sich selbst und die Grenzen seiner eigenen Wahrnehmung erkennt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.