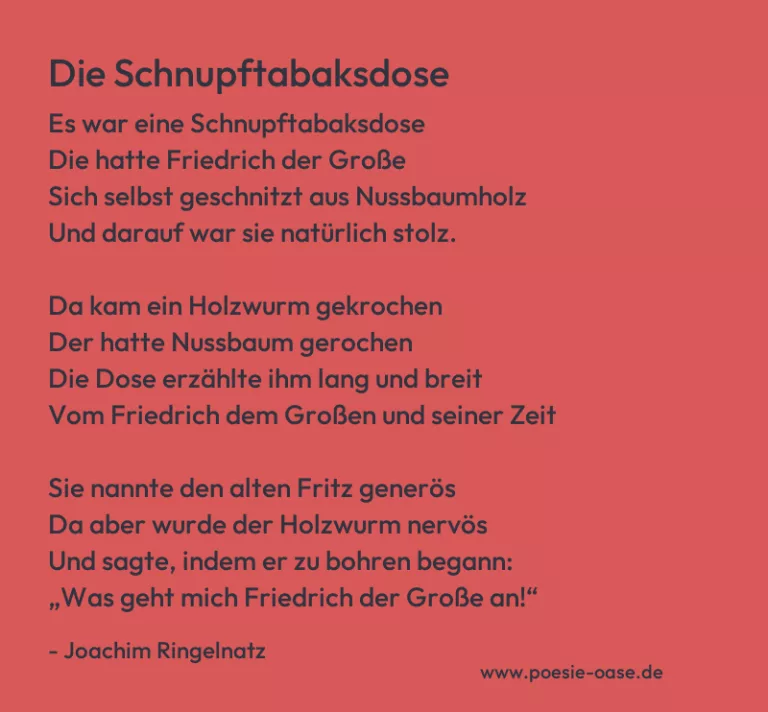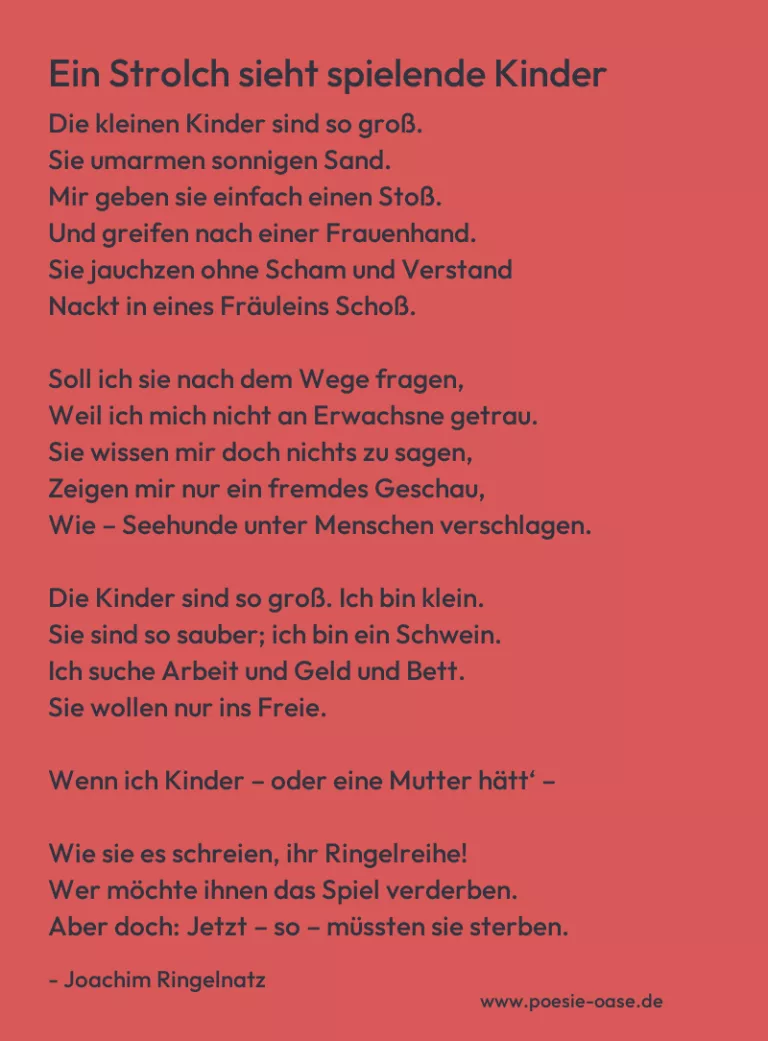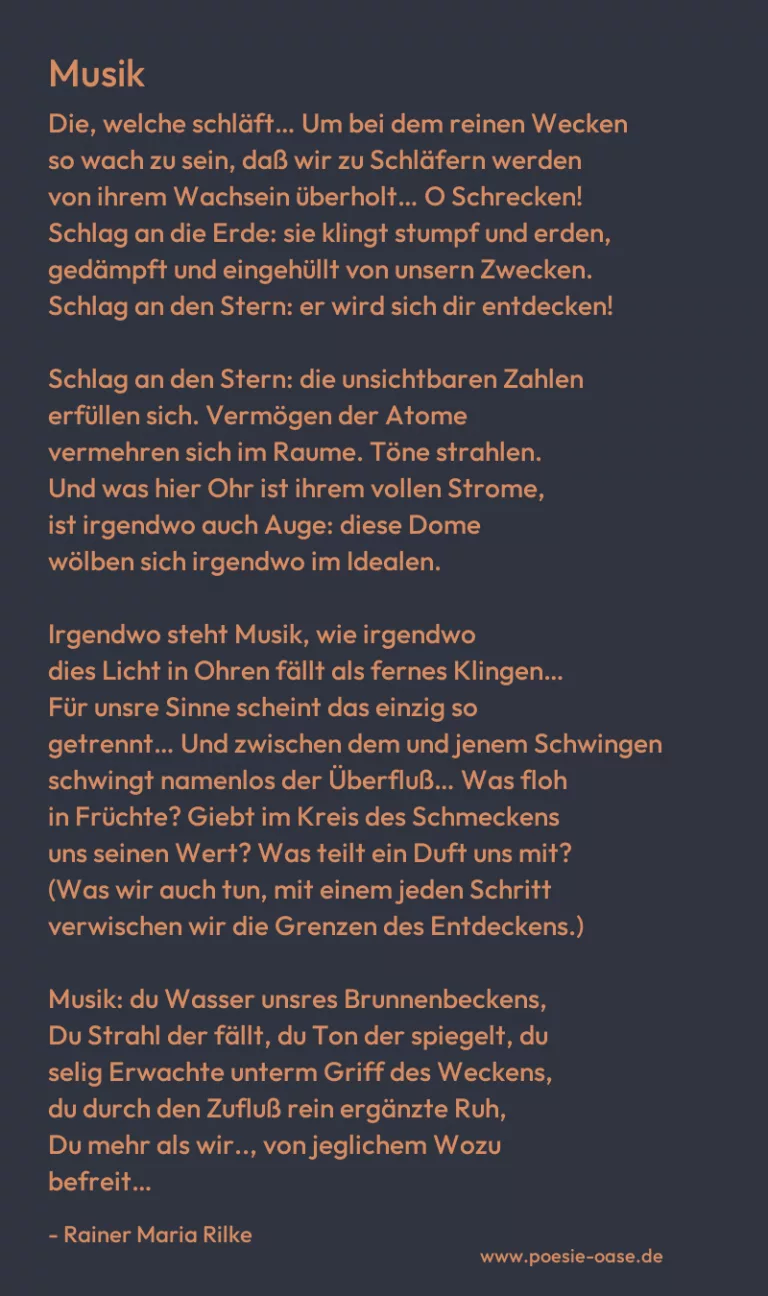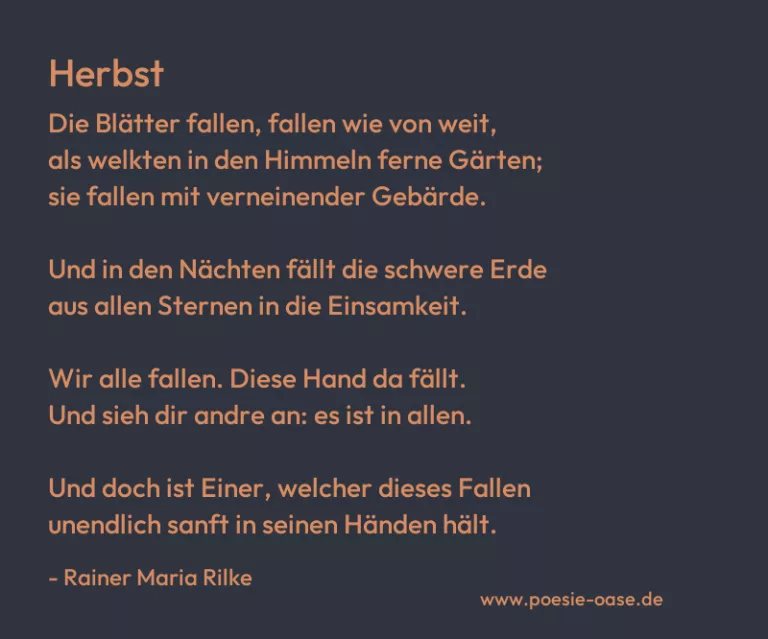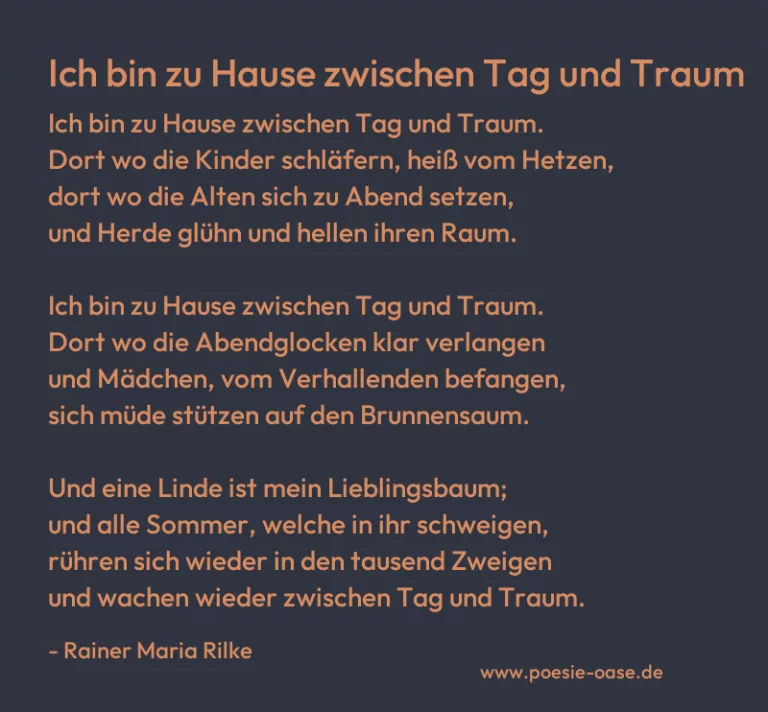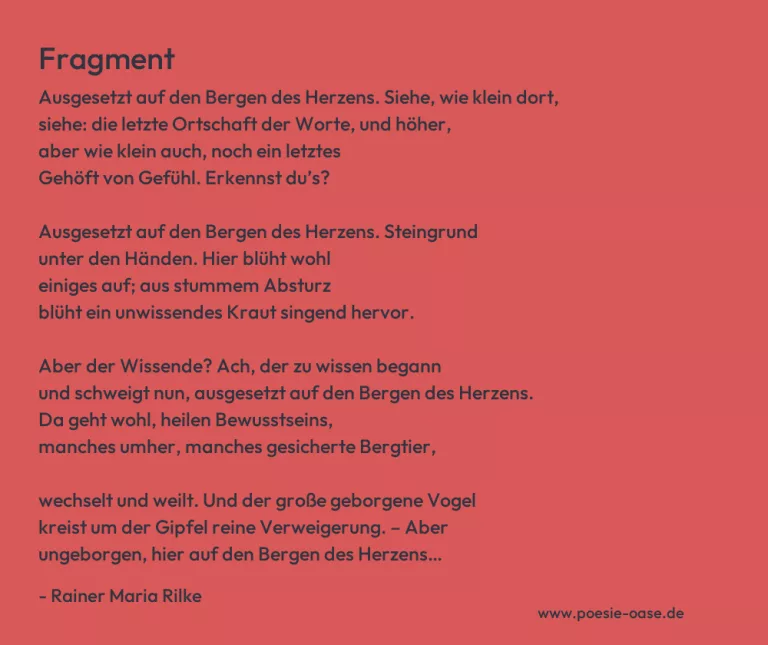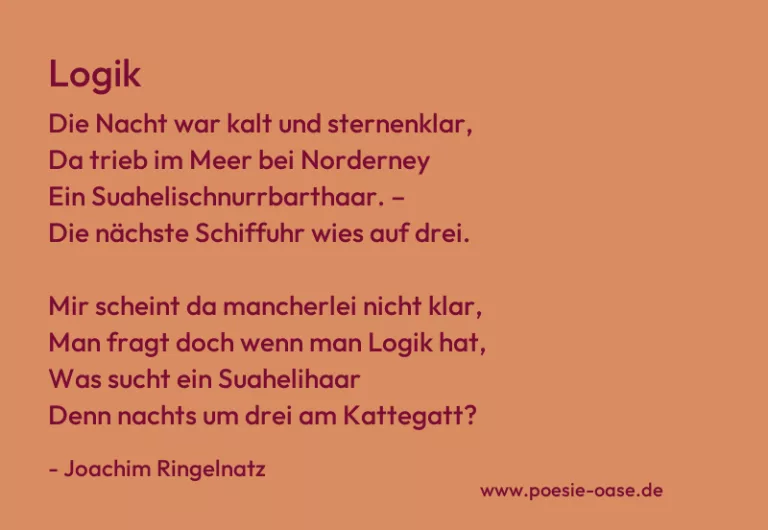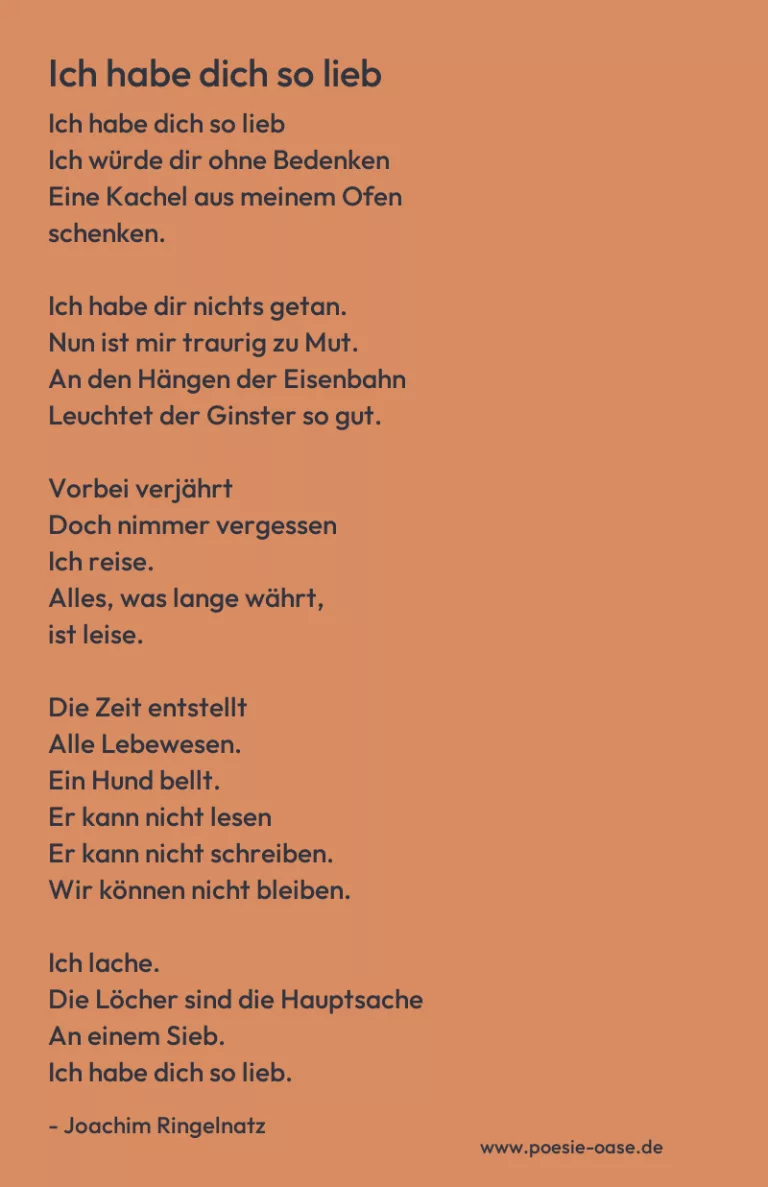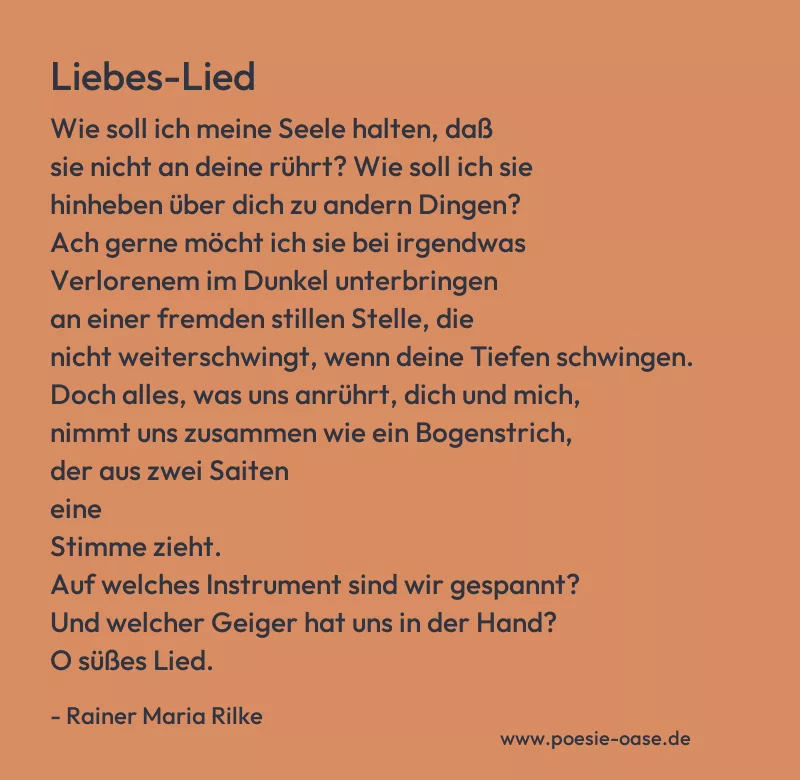Liebes-Lied
Wie soll ich meine Seele halten, daß
sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie
hinheben über dich zu andern Dingen?
Ach gerne möcht ich sie bei irgendwas
Verlorenem im Dunkel unterbringen
an einer fremden stillen Stelle, die
nicht weiterschwingt, wenn deine Tiefen schwingen.
Doch alles, was uns anrührt, dich und mich,
nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich,
der aus zwei Saiten
eine
Stimme zieht.
Auf welches Instrument sind wir gespannt?
Und welcher Geiger hat uns in der Hand?
O süßes Lied.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
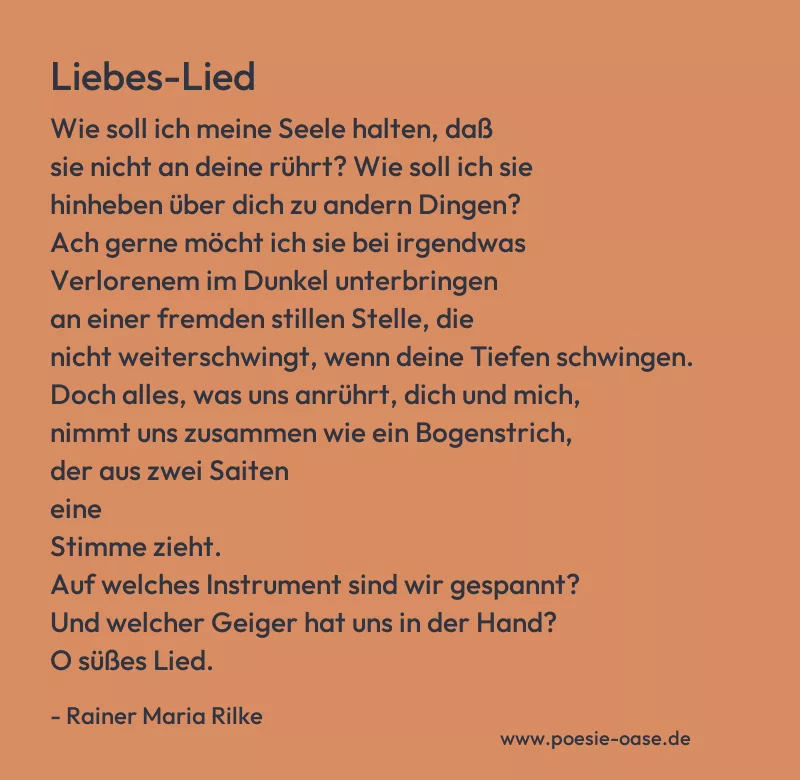
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Liebes-Lied“ von Rainer Maria Rilke drückt auf eindrucksvolle Weise die tiefen Konflikte und Sehnsüchte aus, die mit der Liebe und der Nähe zu einem anderen Menschen verbunden sind. Zu Beginn stellt der Sprecher die Frage, „wie soll ich meine Seele halten, daß sie nicht an deine rührt?“ Diese Frage zeigt das Dilemma des Sprechers: Wie kann er seine eigene Identität und Integrität bewahren, wenn er so stark von der anderen Person berührt wird? Der Sprecher möchte seine Seele „hinheben über dich zu andern Dingen“, was den Wunsch ausdrückt, sich von der starken Anziehungskraft der Liebe zu befreien und sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Es ist der Versuch, sich vom Einfluss des anderen zu lösen, ohne die Verbindung vollständig aufzugeben.
Doch dieser Wunsch, sich zu entziehen, wird schnell als unerreichbar erkannt. Der Sprecher gesteht, dass er seine Seele gerne „bei irgendwas Verlorenem im Dunkel unterbringen“ möchte, an einem Ort, der „nicht weiterschwingt“, wenn die „Tiefen“ des anderen Menschen schwingen. Das Bild des „Verlorenen im Dunkel“ steht für den Versuch, die eigene Seele zu verstecken und vor der intensiven emotionalen Wirkung der Liebe zu schützen. Doch gleichzeitig erkennt der Sprecher, dass diese Flucht unmöglich ist, da „alles, was uns anrührt, dich und mich“ uns auf eine Weise zusammenführt, die wir nicht kontrollieren können. Diese unaufhaltsame Verbindung wird durch den metaphorischen „Bogenstrich“ dargestellt, der aus zwei Saiten eine „Stimme zieht“. Die Liebe wird so zu einer kraftvollen, musikalischen Verbindung, die aus den beiden Individuen eine Einheit macht, die sich nicht einfach trennen lässt.
Die zentrale Frage des Gedichts – „Auf welches Instrument sind wir gespannt?“ – zeigt die Ohnmacht des Sprechers gegenüber der Liebe. Die beiden Menschen sind wie Saiten eines Instruments, die durch einen „Geiger“ gespielt werden. Das Bild des Geigers, der das Instrument in der Hand hat, lässt den Sprecher in der Rolle eines Passiven erscheinen, der keine Kontrolle über die Melodie hat, die gespielt wird. Es wird eine gewisse Fremdbestimmung durch die Liebe angedeutet, die sowohl süß als auch schmerzhaft ist. Doch trotz dieser Ohnmacht ist die Liebe zugleich eine Quelle der Schönheit, wie das „süße Lied“ am Ende des Gedichts betont.
Insgesamt stellt „Liebes-Lied“ die Ambivalenz der Liebe dar: Einerseits ist sie eine tief empfundene, intime Verbindung, die den Sprecher mit der anderen Person untrennbar vereint, andererseits fühlt sich der Sprecher von dieser Verbindung auch gefangen und sucht nach einem Weg, sich zu befreien. Doch die Liebe bleibt eine unaufhaltsame, harmonische Kraft, die den Sprecher dazu zwingt, sich dieser tiefen Verbindung zu hingeben, selbst wenn sie ihn über seine eigene Kontrolle hinausführt. Rilke zeigt uns die duale Natur der Liebe – sie ist sowohl eine Quelle der Freude als auch der Ohnmacht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.