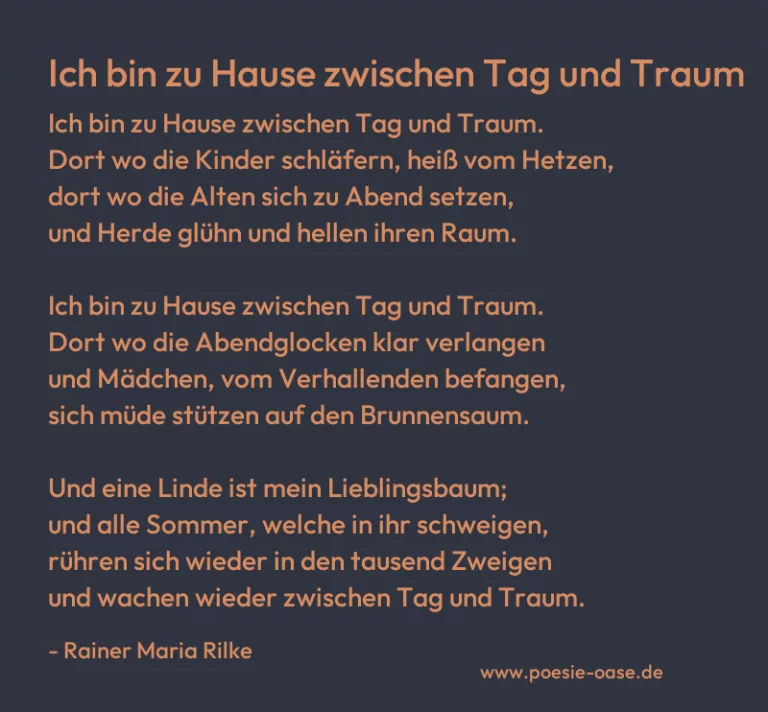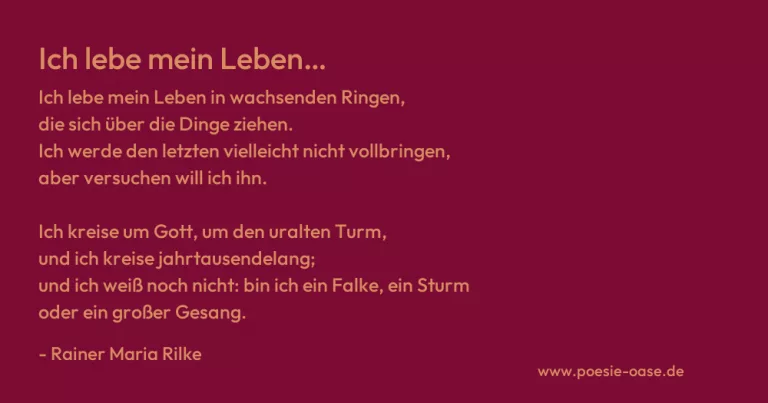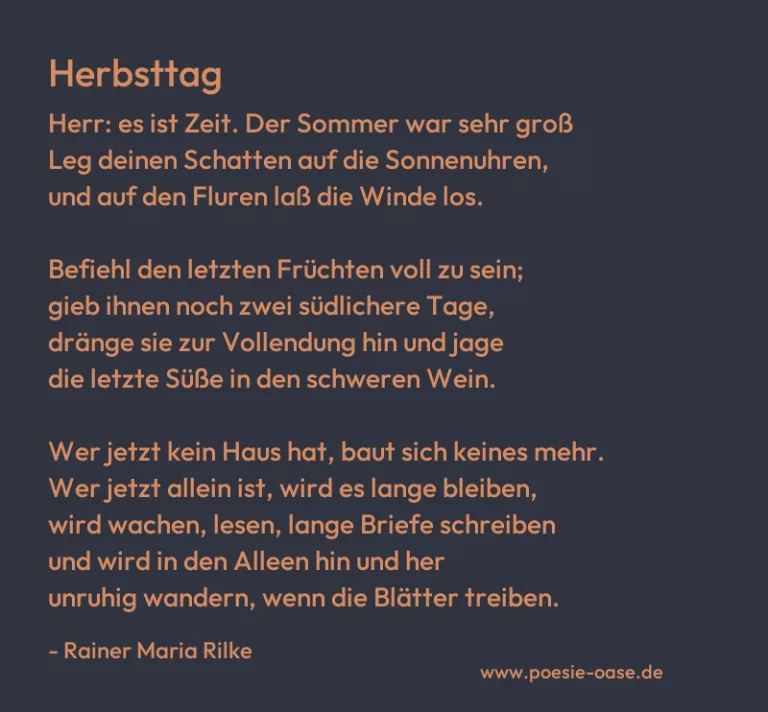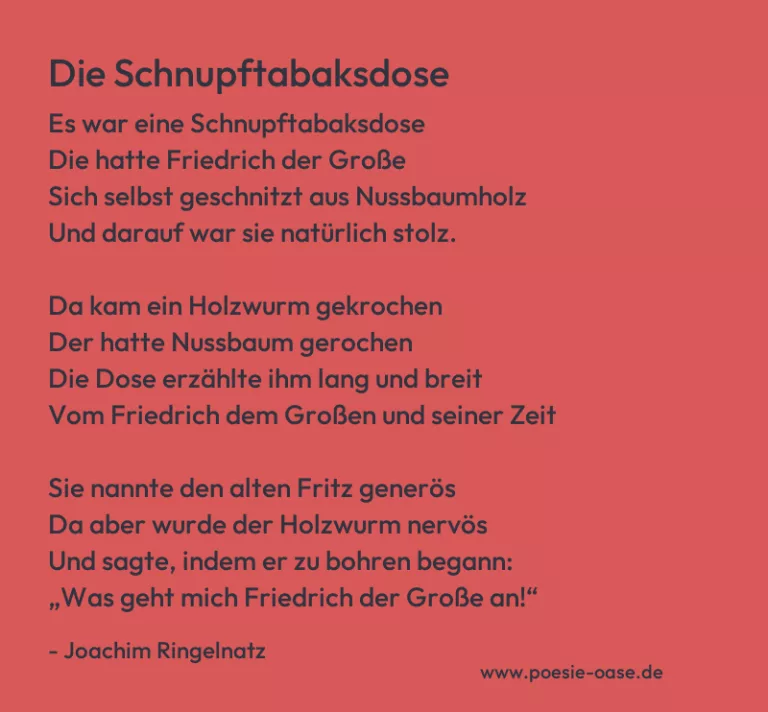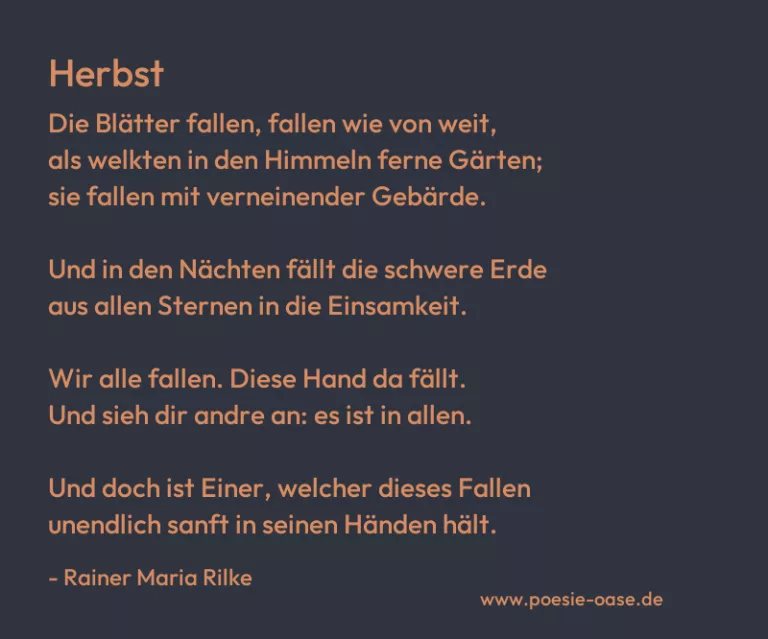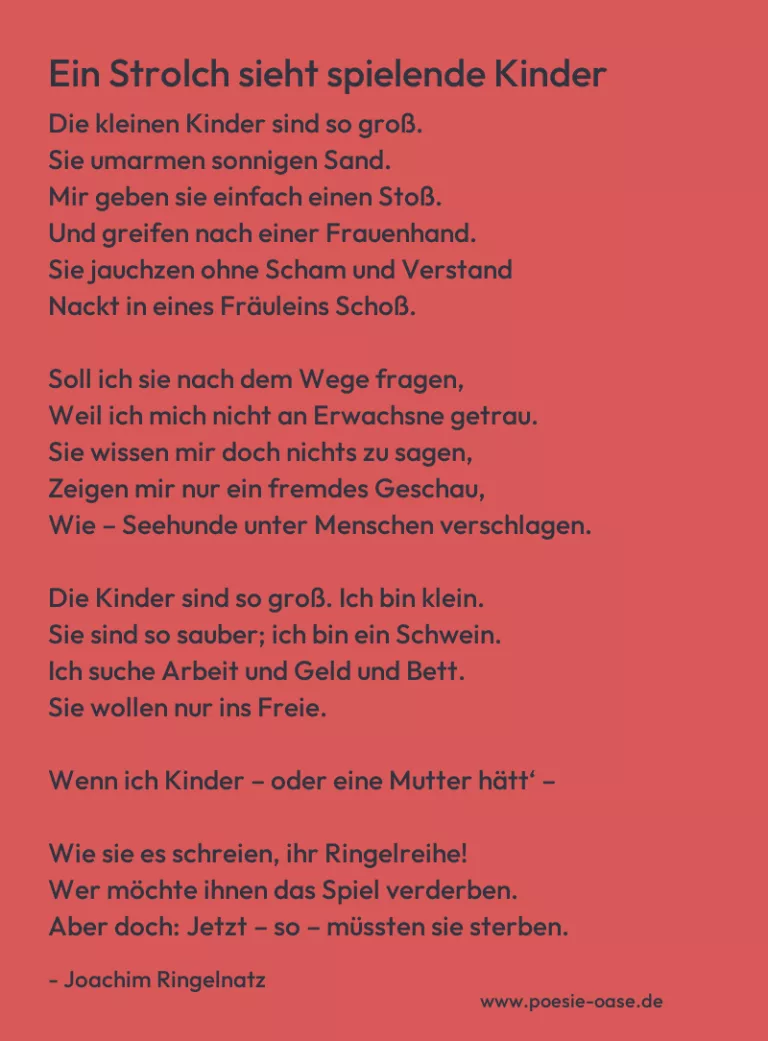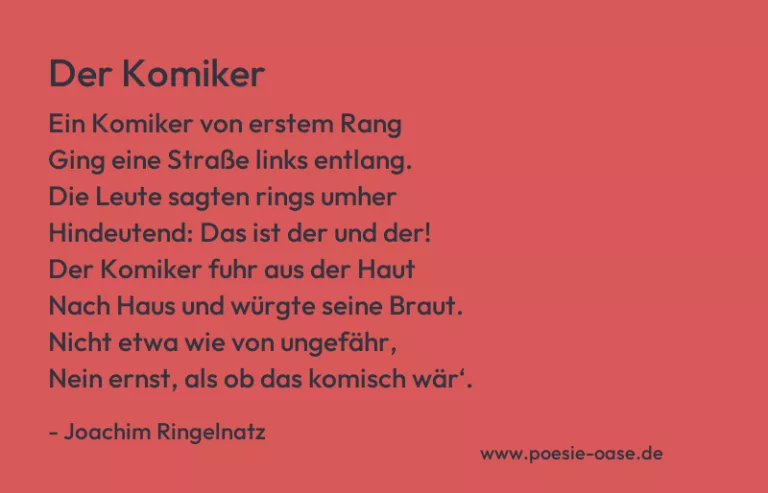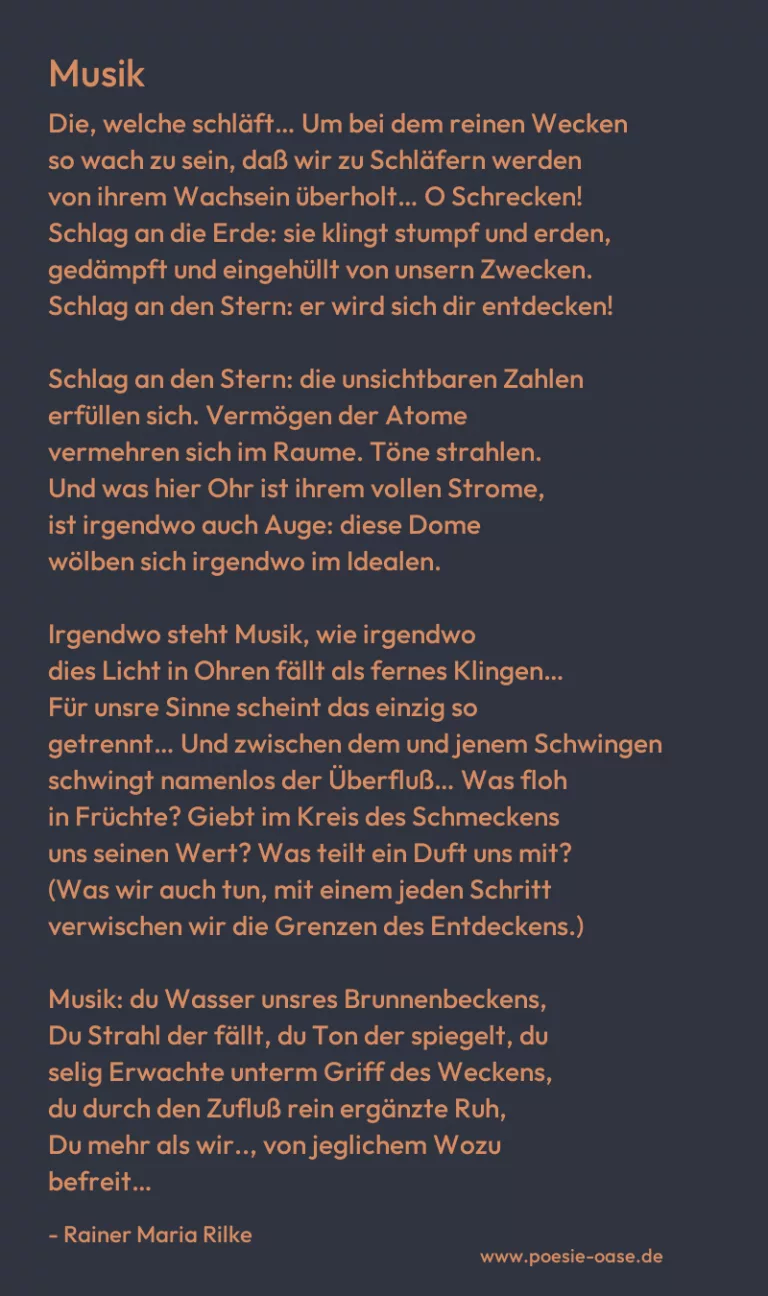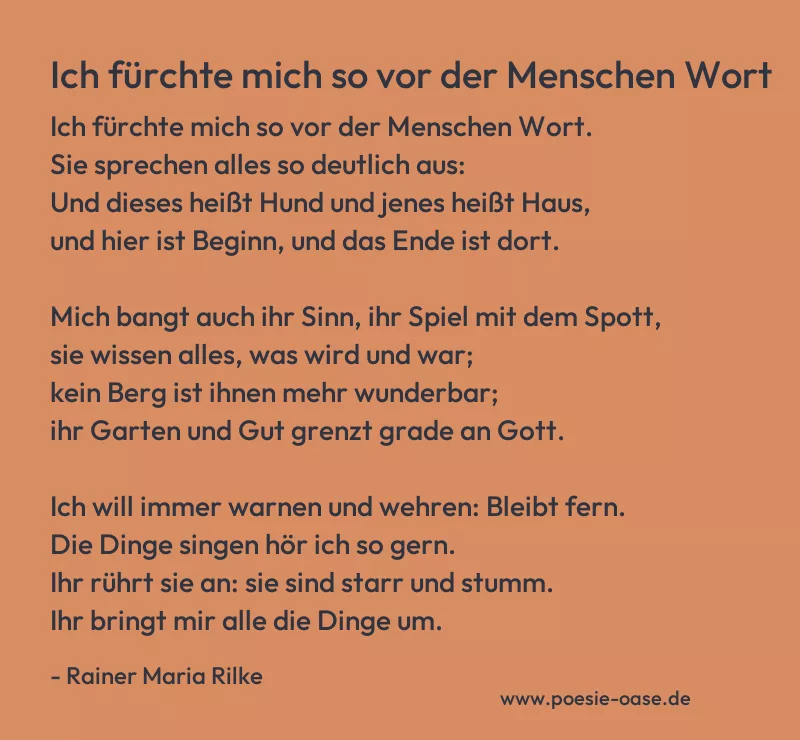Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort
Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort.
Sie sprechen alles so deutlich aus:
Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus,
und hier ist Beginn, und das Ende ist dort.
Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott,
sie wissen alles, was wird und war;
kein Berg ist ihnen mehr wunderbar;
ihr Garten und Gut grenzt grade an Gott.
Ich will immer warnen und wehren: Bleibt fern.
Die Dinge singen hör ich so gern.
Ihr rührt sie an: sie sind starr und stumm.
Ihr bringt mir alle die Dinge um.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
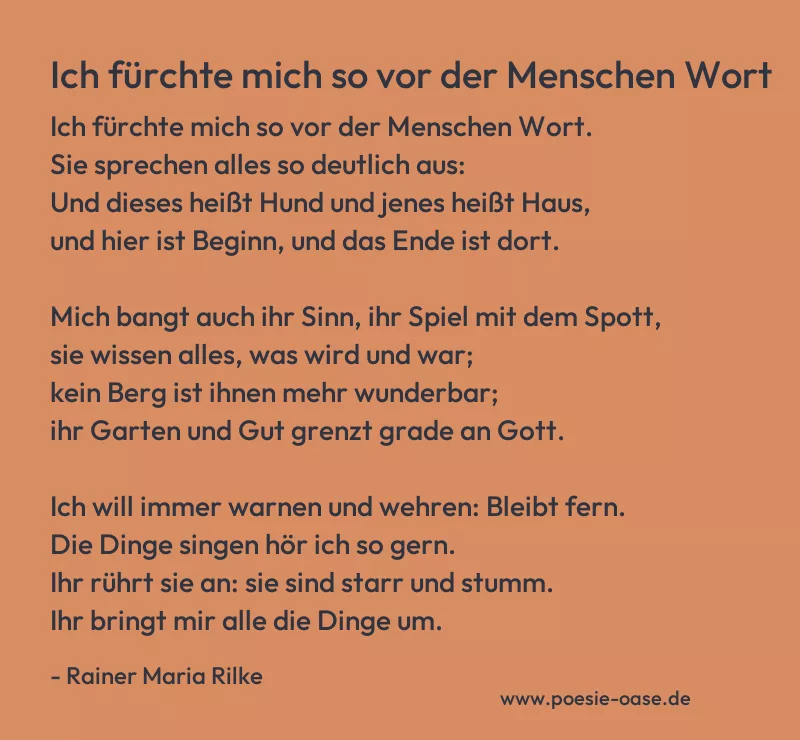
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort“ von Rainer Maria Rilke drückt eine tiefe Angst und Zurückhaltung gegenüber der Art und Weise aus, wie der Mensch mit Sprache und Begriffen die Welt entzaubert. Der Sprecher fürchtet sich vor den „Menschen Wort“, da diese „alles so deutlich aussprechen“. In dieser Klarheit und Deutlichkeit liegt eine Reduzierung der Dinge auf ihre bloße Benennung, was sie ihrer Tiefe und ihrem geheimen, lebendigen Wesen beraubt. Der Begriff „Hund“ wird nur als „Hund“ verstanden und das „Haus“ als bloßes Gebäude, ohne dass deren tiefere Bedeutung oder ihre symbolische Kraft erkannt wird.
Im zweiten Abschnitt des Gedichts wird der überhebliche und spöttische Umgang der Menschen mit der Welt kritisiert. Der Mensch glaubt, alles zu wissen – „kein Berg ist ihnen mehr wunderbar“, was die Perspektive widerspiegelt, dass die Welt durch Sprache und Wissen entzaubert wird. Wenn der Mensch glaubt, alles zu begreifen, verliert er die Fähigkeit, die Wunder und Geheimnisse der Welt zu erfahren. Der Garten und das Gut, das „gerade an Gott grenzt“, stellt eine weitere Ironie dar: Was heilig und erhaben ist, wird durch menschliches Wissen und Besitzansprüche in seiner Bedeutung entwertet.
Der Sprecher zieht sich aus diesem Spiel der Menschen zurück und ruft zur Distanz auf: „Bleibt fern.“ Diese Distanz ist nicht nur räumlich, sondern auch geistig. Der Sprecher möchte sich von der rationalen, alles erklärenden Welt der Menschen abgrenzen. Er zieht es vor, die „Dinge singen“ zu hören, also die Welt in ihrer unbeschreiblichen, nicht greifbaren Tiefe zu erleben. Die Dinge haben für ihn eine innewohnende Melodie und Lebendigkeit, die durch menschliches Benennen und Kategorisieren zerstört wird.
Am Ende des Gedichts betont der Sprecher, dass das Eingreifen der Menschen in die Dinge diese „starr und stumm“ macht. Indem sie versuchen, die Dinge in Begriffe und Definitionen zu fassen, verlieren sie ihre Lebendigkeit und Schönheit. Der Mensch beraubt sich der Fähigkeit, die Welt in ihrer vollen Tiefe und mit ihrer unvermittelten, unmittelbaren Erfahrung zu begreifen. Die Dinge werden „umgebracht“, weil sie in einem ständigen Prozess des Erklärens und Rationalisierens ihre ursprüngliche Poesie und Magie verlieren. Rilke kritisiert hier die Entfremdung von der Welt durch das Rationalisieren und Verdinglichen von Sprache.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.