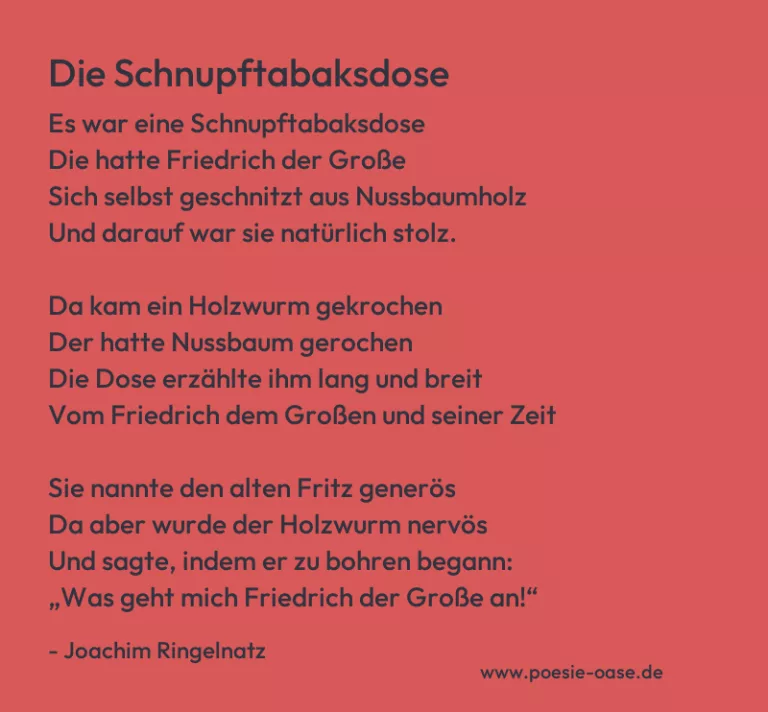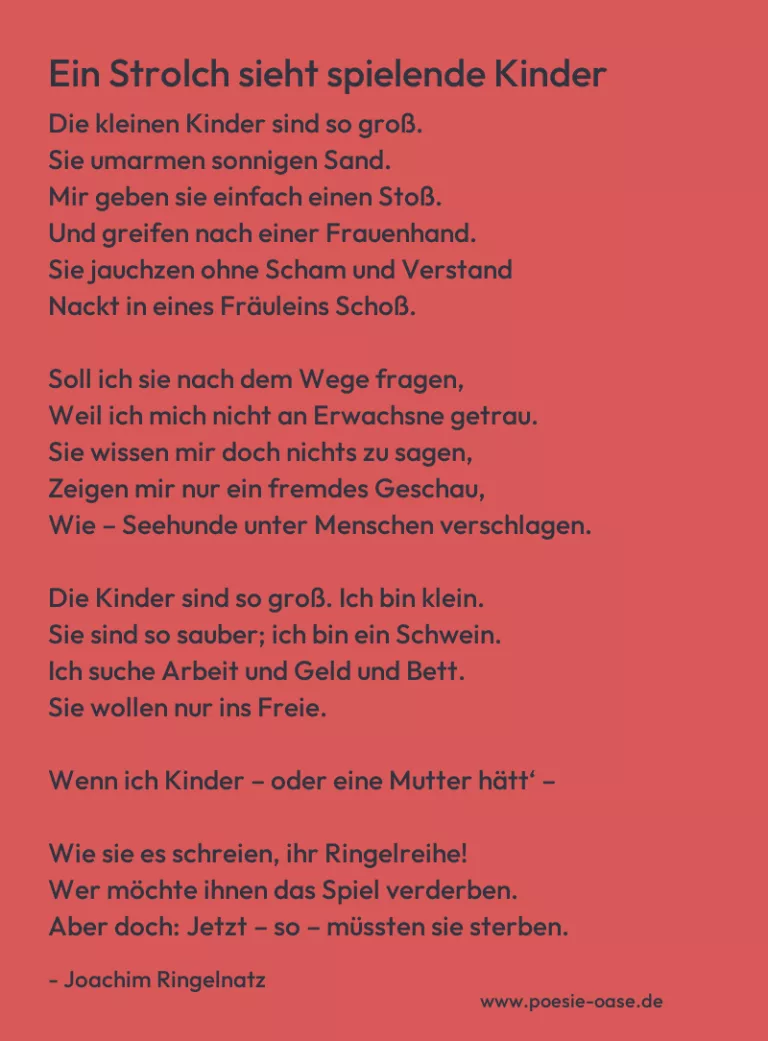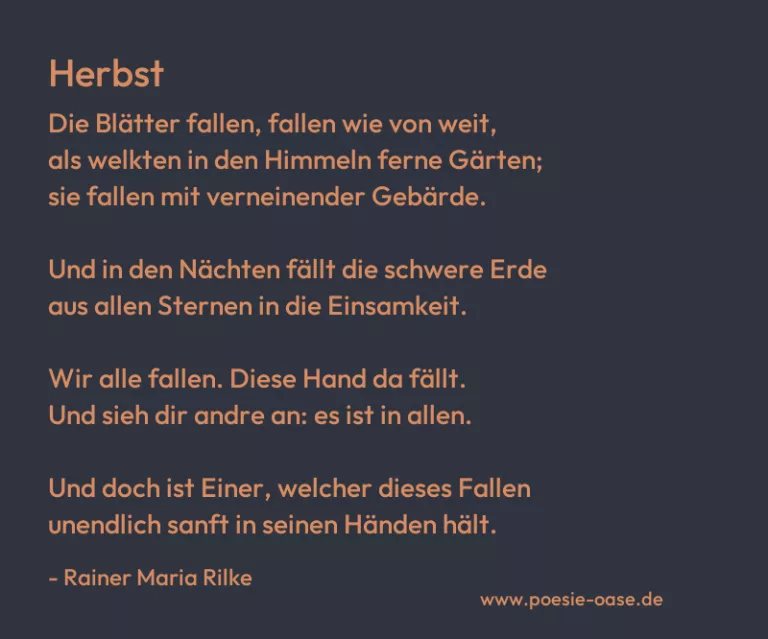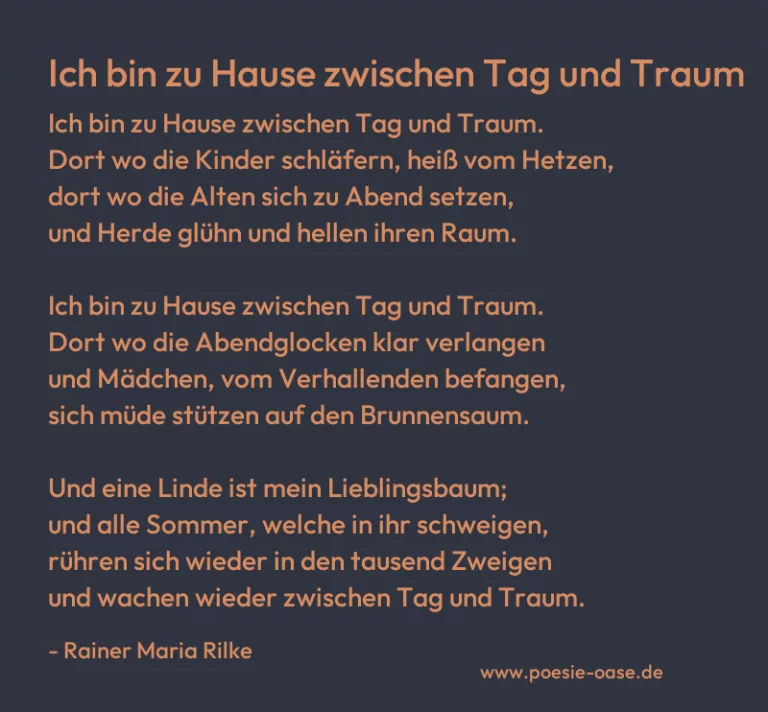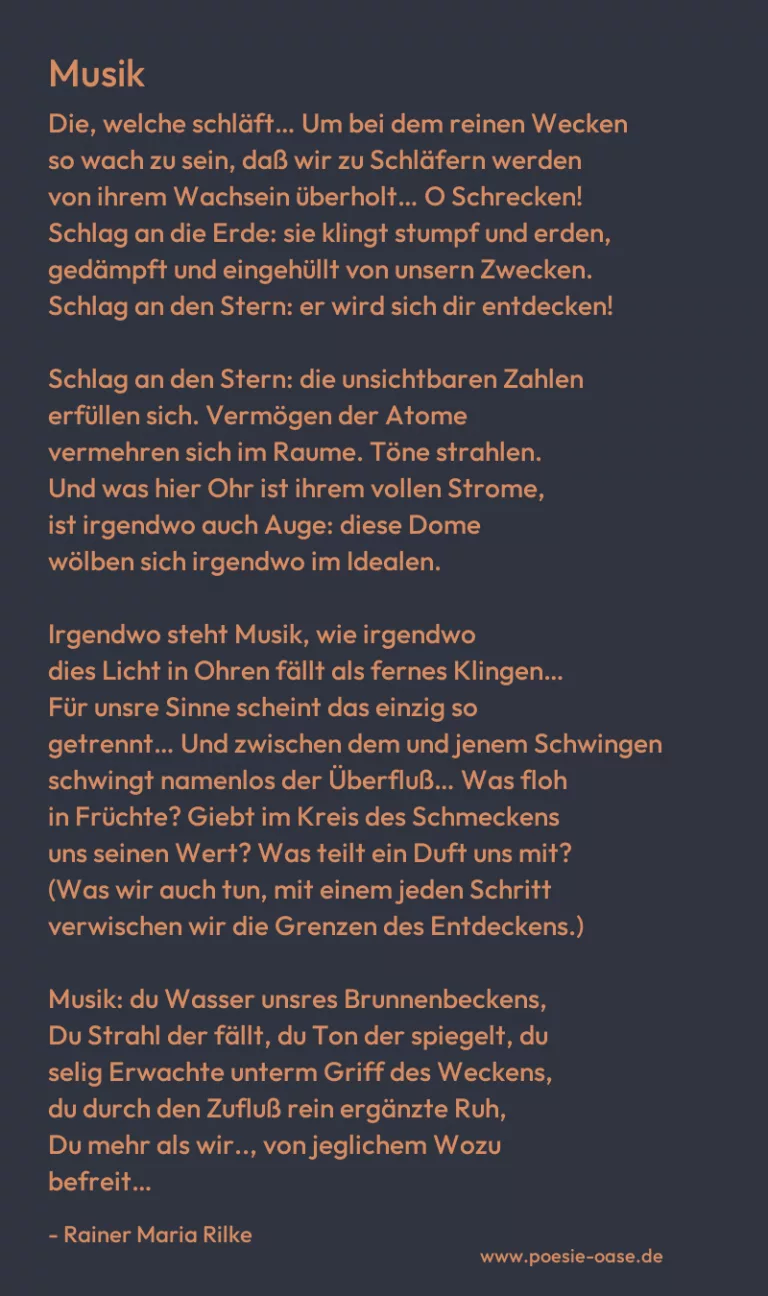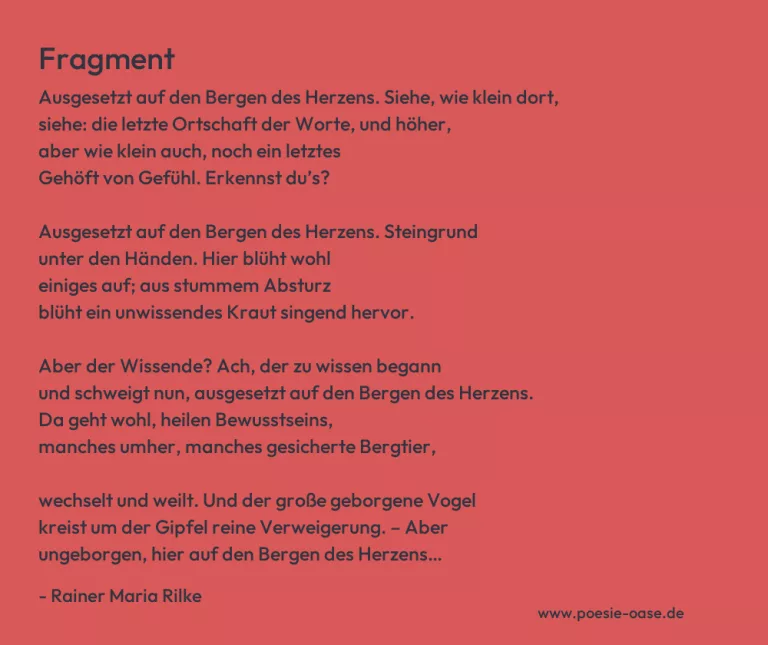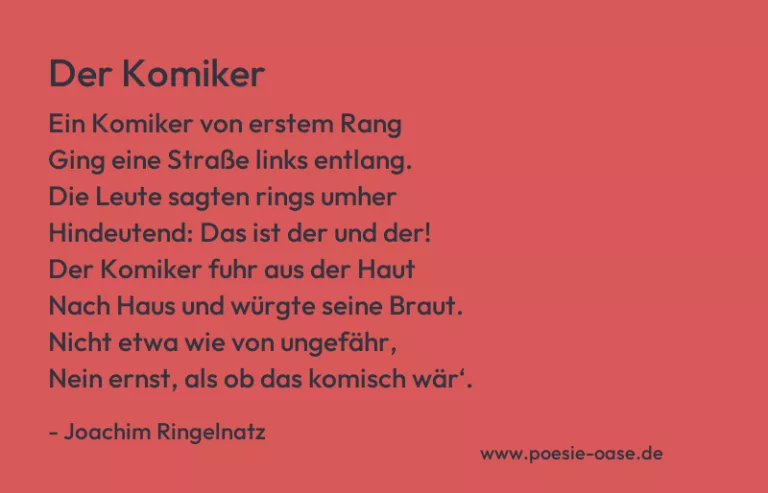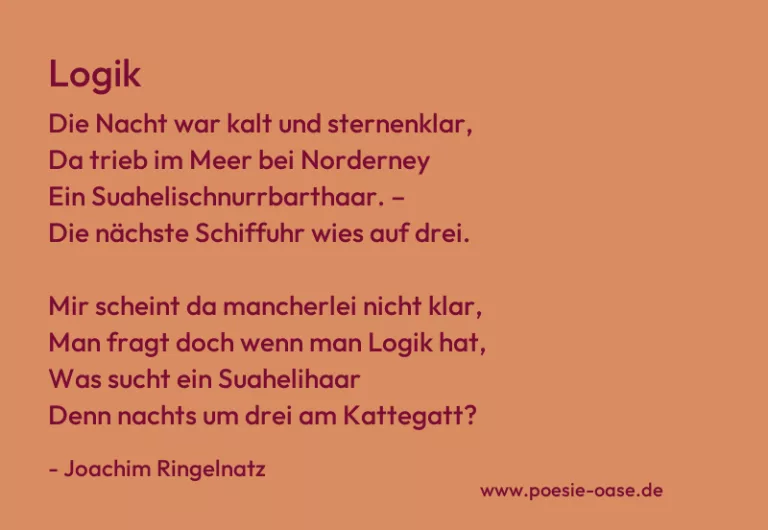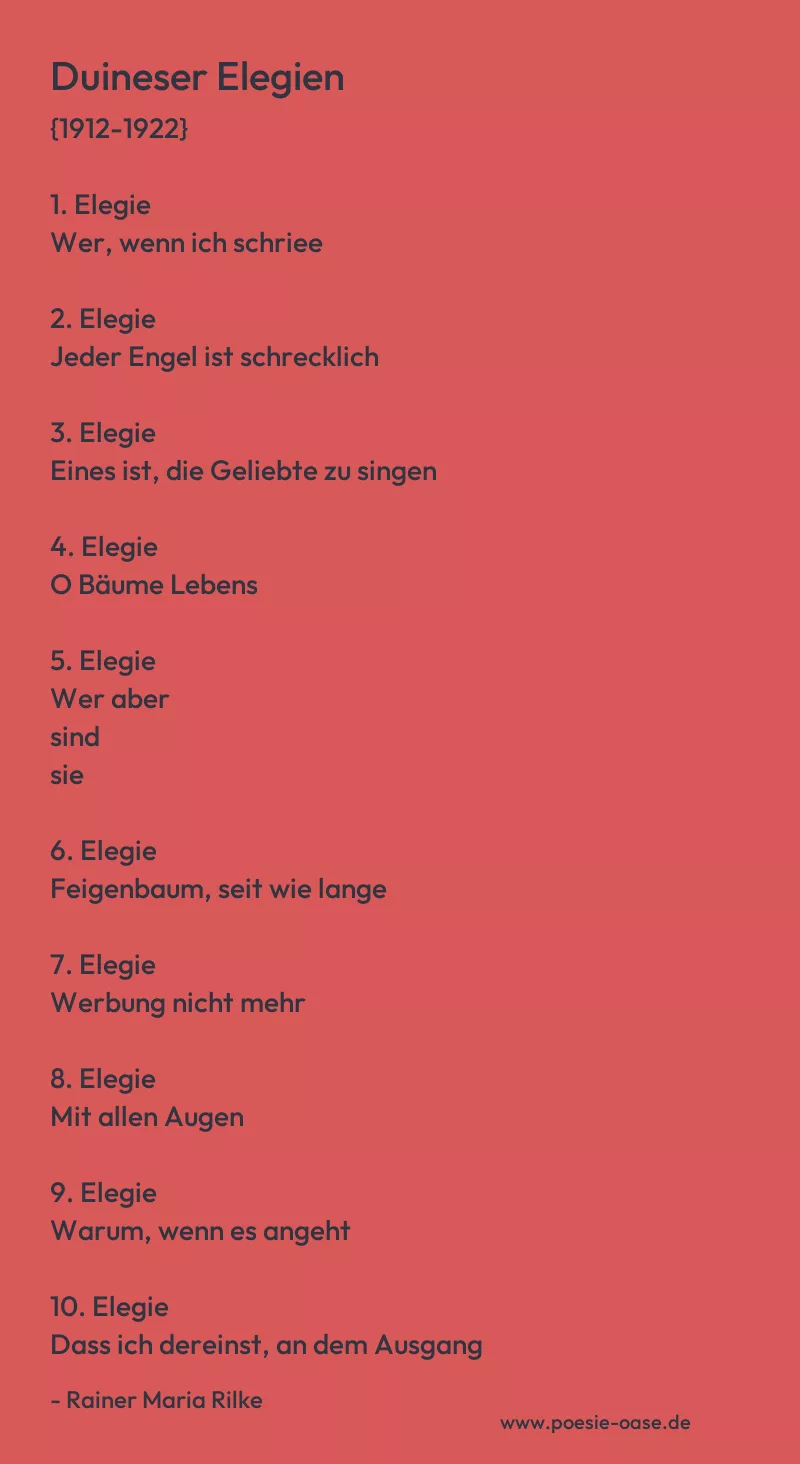Duineser Elegien
{1912-1922}
1. Elegie
Wer, wenn ich schriee
2. Elegie
Jeder Engel ist schrecklich
3. Elegie
Eines ist, die Geliebte zu singen
4. Elegie
O Bäume Lebens
5. Elegie
Wer aber
sind
sie
6. Elegie
Feigenbaum, seit wie lange
7. Elegie
Werbung nicht mehr
8. Elegie
Mit allen Augen
9. Elegie
Warum, wenn es angeht
10. Elegie
Dass ich dereinst, an dem Ausgang
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
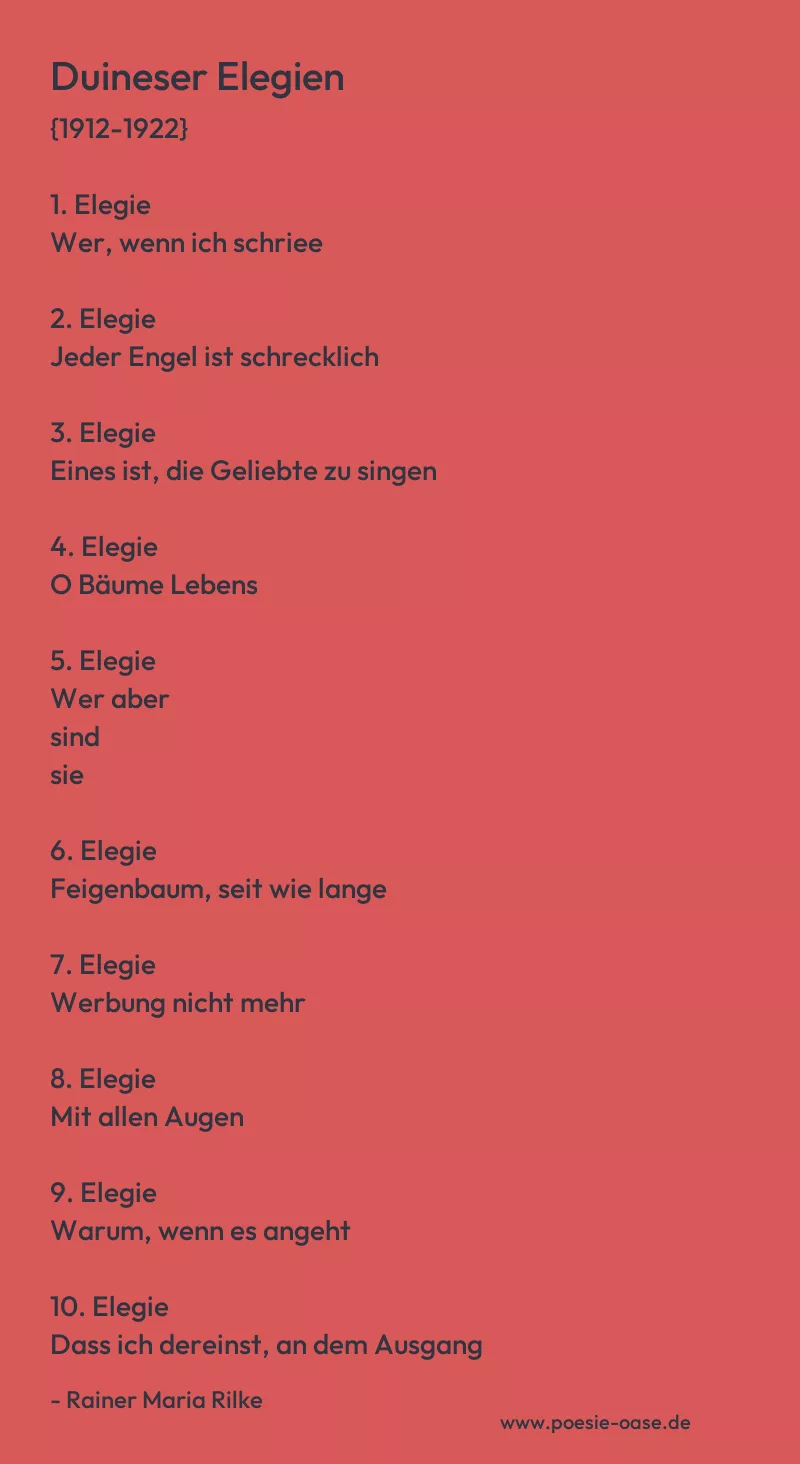
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedichtzyklus „Duineser Elegien“ von Rainer Maria Rilke, geschrieben zwischen 1912 und 1922, ist eines der bedeutendsten Werke der deutschsprachigen Lyrik des 20. Jahrhunderts. In zehn Elegien entfaltet Rilke eine dichte, philosophisch-poetische Auseinandersetzung mit den zentralen Fragen der menschlichen Existenz: Leben und Tod, Liebe, Zeitlichkeit, Kunst, Engel und das Wesen des Menschen. Der Elegienton ist getragen von einer tiefen Sehnsucht nach Sinn, aber auch vom Bewusstsein der Unerreichbarkeit des Absoluten.
Bereits die erste Elegie eröffnet mit dem berühmten Ausruf: „Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen?“ – eine Frage, die den Ton des ganzen Zyklus bestimmt. Der Mensch erscheint als verletzliches, in seiner Endlichkeit gefangenes Wesen, das sich nach Verbindung zum Transzendenten sehnt, aber an dessen Unerreichbarkeit leidet. Engel, immer wiederkehrende Figuren, sind Sinnbilder dieser jenseitigen Ordnung – sie sind schön, mächtig, aber auch „schrecklich“, weil sie unsere Grenzen aufzeigen und uns mit der eigenen Ohnmacht konfrontieren.
Zugleich durchzieht eine tiefe Bewunderung für das Irdische, das Vergängliche den gesamten Zyklus. Rilke entwickelt das Konzept des „Ruhm des Irdischen“, das besagt, dass gerade im Vergehen, in der Sterblichkeit, eine besondere Würde liegt. Die Elegien feiern nicht das Ewige, sondern das flüchtige Dasein – wie in der vierten Elegie, wo es heißt: „O Bäume Lebens“, und das menschliche Leben mit einem Blattwerk verglichen wird, das sich im Wind bewegt, verbunden mit allem Lebendigen.
Die Liebe wird in den Elegien nicht nur als emotionale Erfahrung verstanden, sondern als spirituelle Übung, als Weg zur Überschreitung des eigenen Ichs. Doch auch hier bleibt Rilke ambivalent – in der dritten Elegie etwa wird das Singen der Geliebten als Möglichkeit und zugleich als unmögliche Aufgabe beschrieben: „Eines ist, die Geliebte zu singen. Ein Anderes, ach, das verborgene, schuldige Göttliche“.
In der zehnten und letzten Elegie kulminiert der Gedankengang des Zyklus in einem weiten Blick auf das Leben als ein großes Ganzes. Hier wird die Trauer verwandelt in eine Art Zustimmung zum Leben: „Dass ich dereinst, an dem Ausgang der grimmigen Klage, / jauchzend den preisenden Engel begrüße“. Der Mensch wird aufgefordert, das Leben mit all seinen Widersprüchen zu umarmen – nicht in Hoffnung auf Ewigkeit, sondern in tiefer Annahme der Endlichkeit.
Die „Duineser Elegien“ sind so eine große metaphysische Dichtung, die aus der Vereinzelung des modernen Menschen heraus einen Raum eröffnet, in dem Schönheit, Leid, Vergänglichkeit und Sehnsucht auf poetisch verdichtete Weise miteinander verwoben sind. Rilkes Sprache changiert dabei zwischen Pathos und Zartheit, Klarheit und Dunkelheit – eine Herausforderung an den Leser, aber auch eine Einladung zu innerer Weite und Tiefe.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.