In Leipzig wohnt ein Bäckermeister,
Hans=back=die=Semmeln=größer heißt er;
Seine Mutter, die Frau Meisterin,
Zieht den Teig wer weiß wie dünn,
Rollt ihn mit der Mangel aus,
Macht sieben bucklige Bretzeln draus,
Drei für den Vater,
Drei für die Mutter,
Eine für unser Plappermündchen;
Dann schweigt′s vielleicht ein Viertelstündchen!
Plappermündchen
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
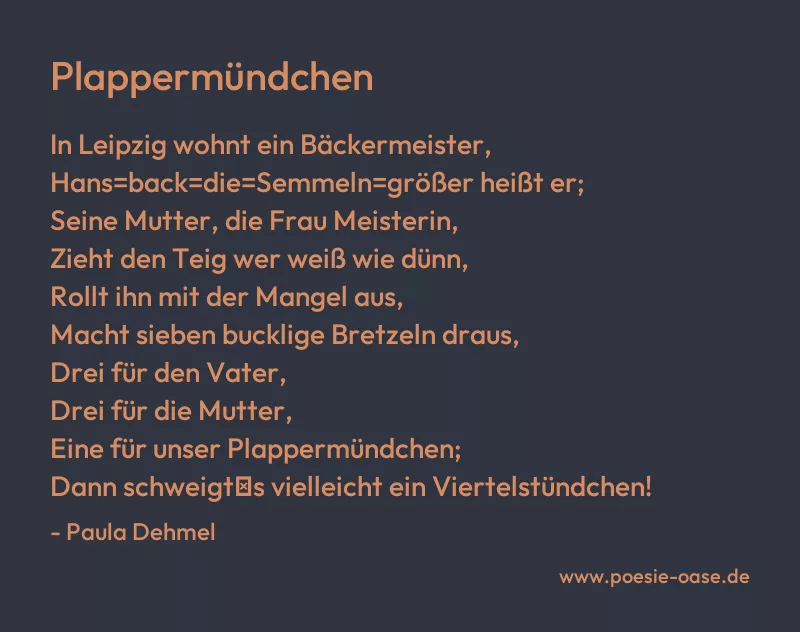
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Plappermündchen“ von Paula Dehmel ist ein charmantes Kindergedicht, das auf humorvolle Weise die Angewohnheit eines Kindes, insbesondere eines „Plappermündchens“, zu viel zu reden, thematisiert. Der Text ist einfach und eingängig gehalten, mit Reimen, die für Kinder leicht zu verstehen sind und die Geschichte lebendig machen. Die Verwendung von volkstümlichen Elementen wie dem Bäcker und der Mutter, die Brezeln backen, schafft eine vertraute und behagliche Atmosphäre, die das Gedicht kindgerecht macht.
Die Geschichte spielt in Leipzig und handelt von einem Bäckermeister namens Hans, der für seine großen Semmeln bekannt ist. Seine Frau, die Meisterin, bereitet den Teig vor, rollt ihn dünn aus und formt sieben Brezeln. Die Aufteilung der Brezeln, drei für den Vater, drei für die Mutter und eine für das „Plappermündchen“, offenbart die Struktur der Familie und die unterschiedlichen Bedürfnisse jedes Mitglieds. Interessanterweise erhält das Kind nur eine Brezel, was möglicherweise darauf hindeutet, dass die Eltern hoffen, dass das Kind nach dem Essen der Brezel für eine Weile still sein wird.
Die zentrale Aussage des Gedichts liegt in der letzten Zeile: „Dann schweigt’s vielleicht ein Viertelstündchen!“ Diese Zeile ist der Kern des Gedichts und bringt die Intention der Eltern zum Ausdruck. Es ist ein liebevoller, aber auch ironischer Kommentar auf das Kind, das scheinbar unaufhörlich spricht. Die Hoffnung, dass das Kind nach dem Genuss der Brezel eine kurze Pause einlegen wird, ist ein typisches Eltern-Kind-Szenario, das viele Leser anspricht.
Das Gedicht zeichnet sich durch seinen leichten Ton und seine spielerische Natur aus. Dehmel verwendet einfache Sprache und Reime, um eine humorvolle Situation zu beschreiben, die im Familienleben häufig vorkommt. Die Wahl des Wortes „Plappermündchen“ selbst ist liebevoll und neckisch, was die Zuneigung der Eltern zu ihrem Kind erkennen lässt, selbst wenn sie sich manchmal nach etwas Ruhe sehnen. Insgesamt ist das Gedicht eine liebenswerte Momentaufnahme des Familienlebens und der Herausforderungen, die mit der Erziehung von Kindern einhergehen, verpackt in eine humorvolle und leicht verständliche Form.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
