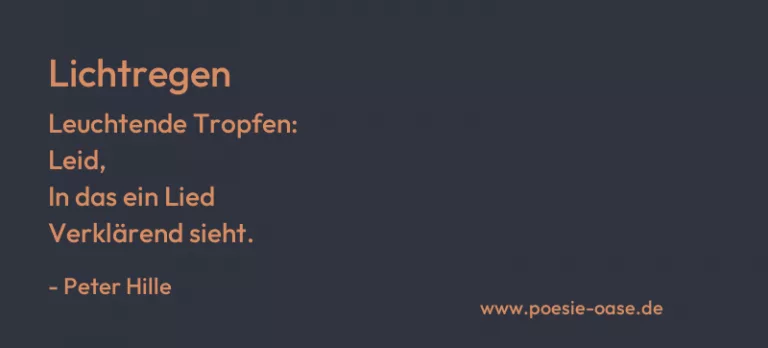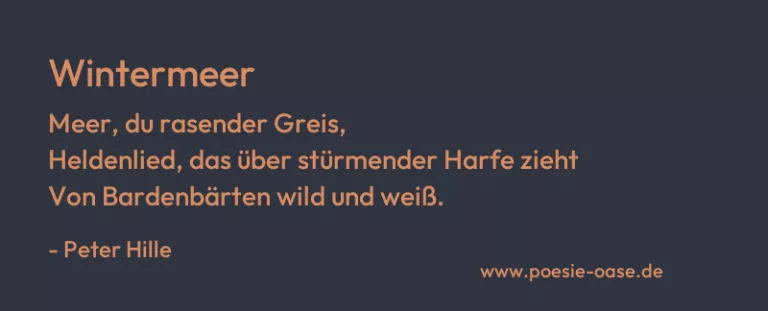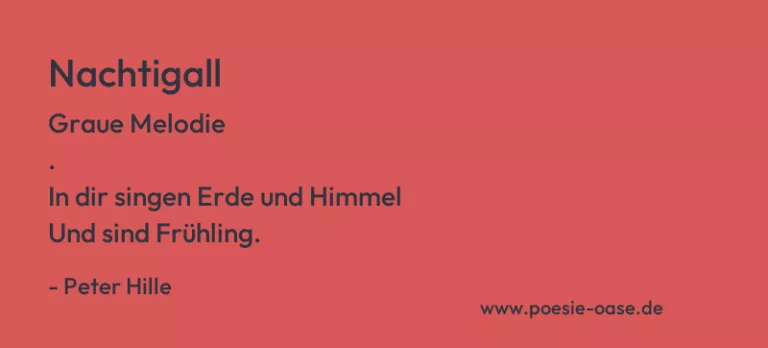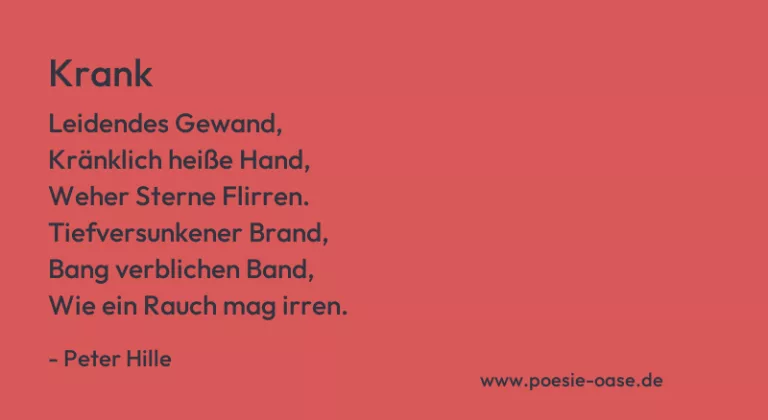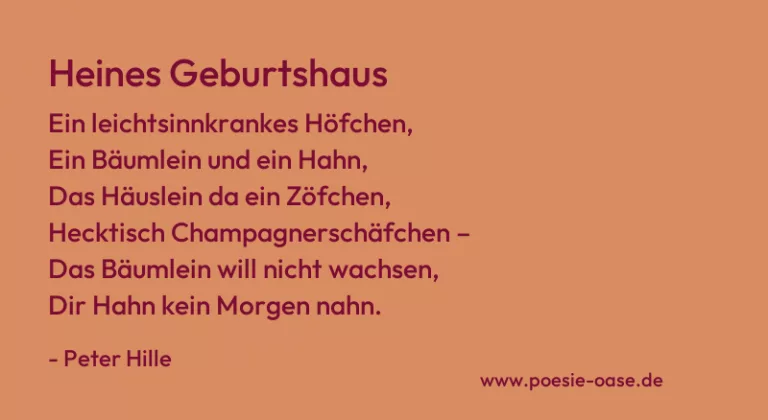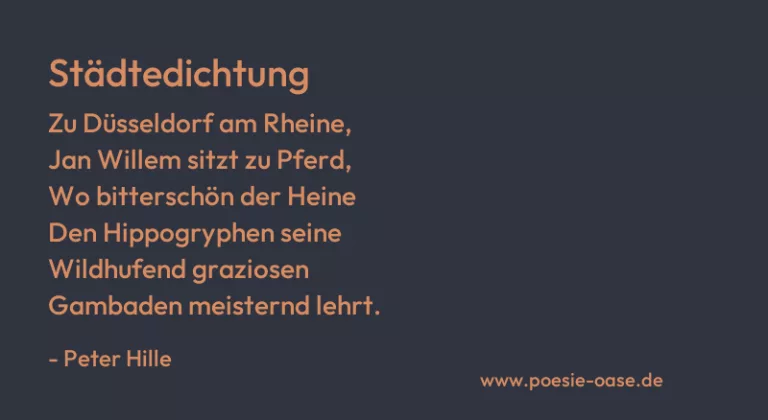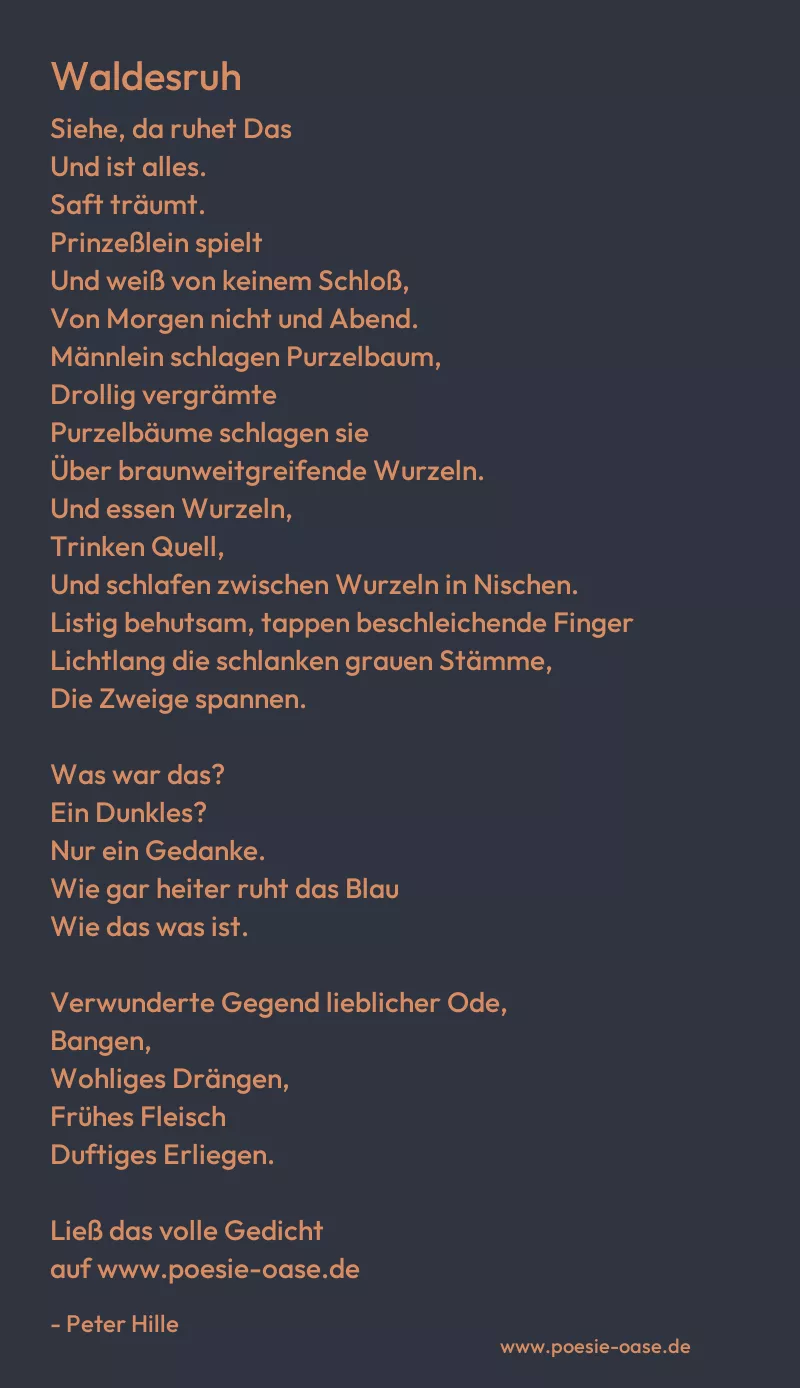Siehe, da ruhet Das
Und ist alles.
Saft träumt.
Prinzeßlein spielt
Und weiß von keinem Schloß,
Von Morgen nicht und Abend.
Männlein schlagen Purzelbaum,
Drollig vergrämte
Purzelbäume schlagen sie
Über braunweitgreifende Wurzeln.
Und essen Wurzeln,
Trinken Quell,
Und schlafen zwischen Wurzeln in Nischen.
Listig behutsam, tappen beschleichende Finger
Lichtlang die schlanken grauen Stämme,
Die Zweige spannen.
Was war das?
Ein Dunkles?
Nur ein Gedanke.
Wie gar heiter ruht das Blau
Wie das was ist.
Verwunderte Gegend lieblicher Ode,
Bangen,
Wohliges Drängen,
Frühes Fleisch
Duftiges Erliegen.
Graue zottige Bärte fahren
Über zerrieseltes Leuchten,
Stöhnende Wonne des Wachseins
Ein rauschendes Duften:
All das perlende Moos.
Vier Schwingen tauschen
In blauen Bahnen
Ein rüstiger Anruf
Beieinander,
Fort sind beide –
Da –
Dort!
Pfade spielen,
Warnender Pfiff,
Springende Bogen,
Ein Strom von Hirschen
Raschelt tiefer hinab.
Ein spähender Pfeil,
Trifft sie das schauende Licht
Meines heiligen Auges.
Herbsthoher Dom
Hohe Weihrauchscheine,
Leuchtende Geister
Schwingen leicht
Hin die prallen, blauen Strahlen.
Eine graue Leiche
Halten sie hochgebahrt
Und singen Requiem…
Heiter ruhet,
Heiter ruhet das Blau,
Wie was ist,
Taten schlummern
Immer.