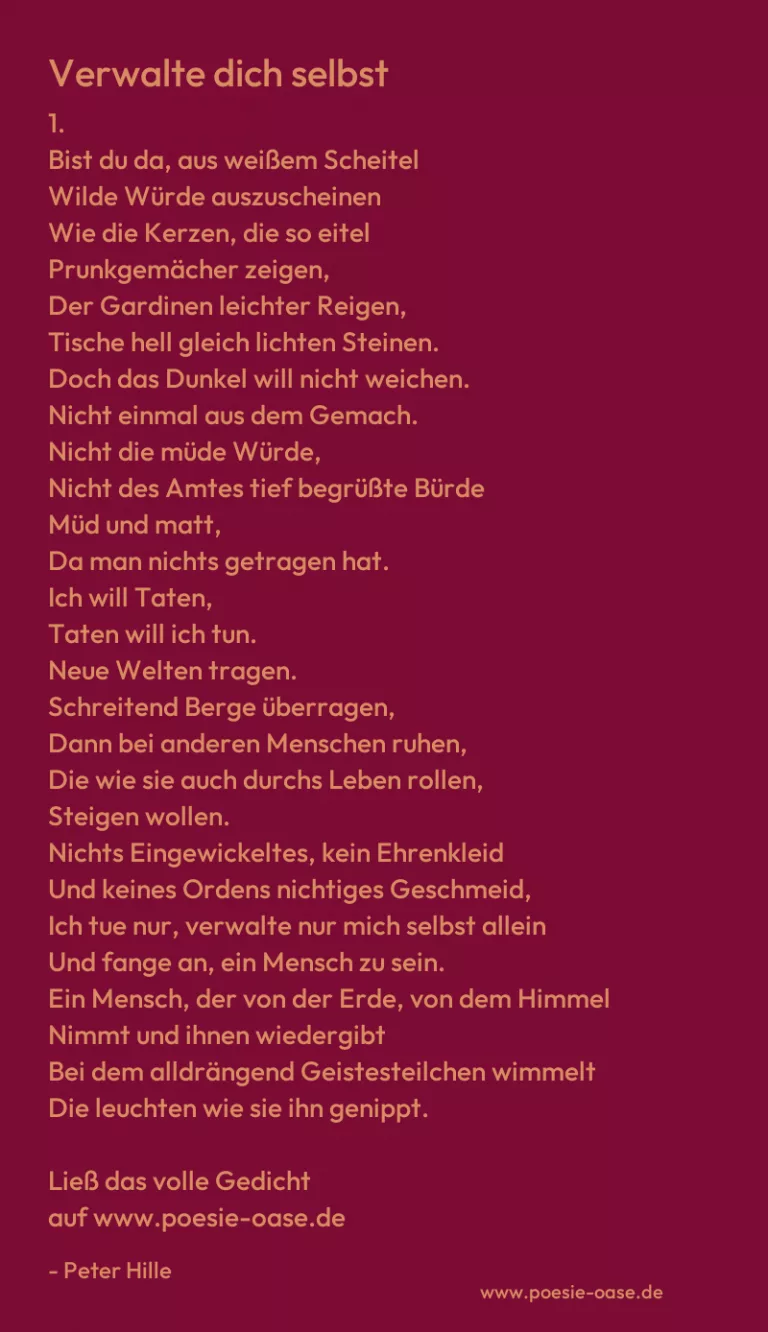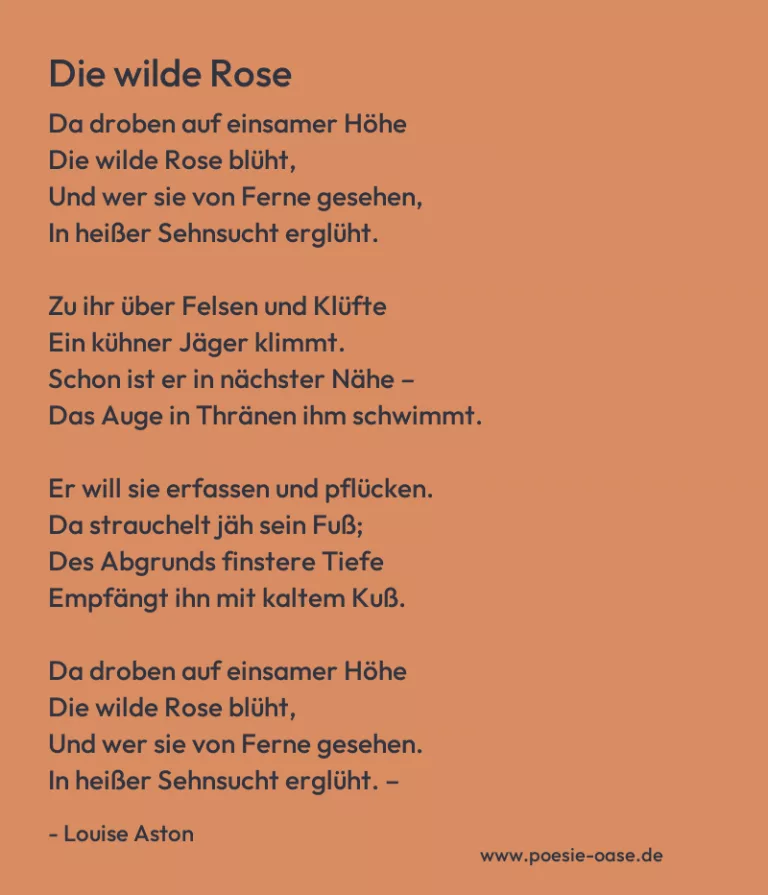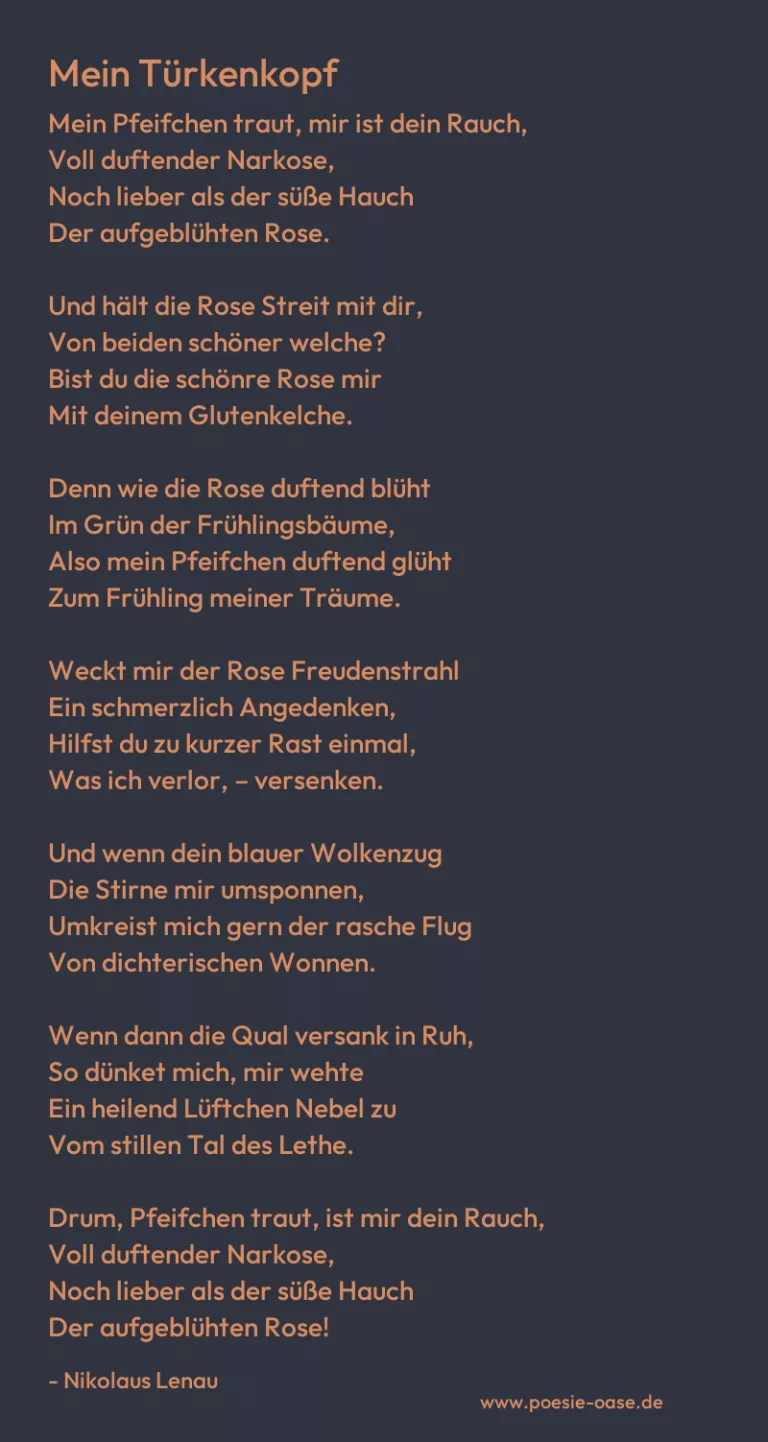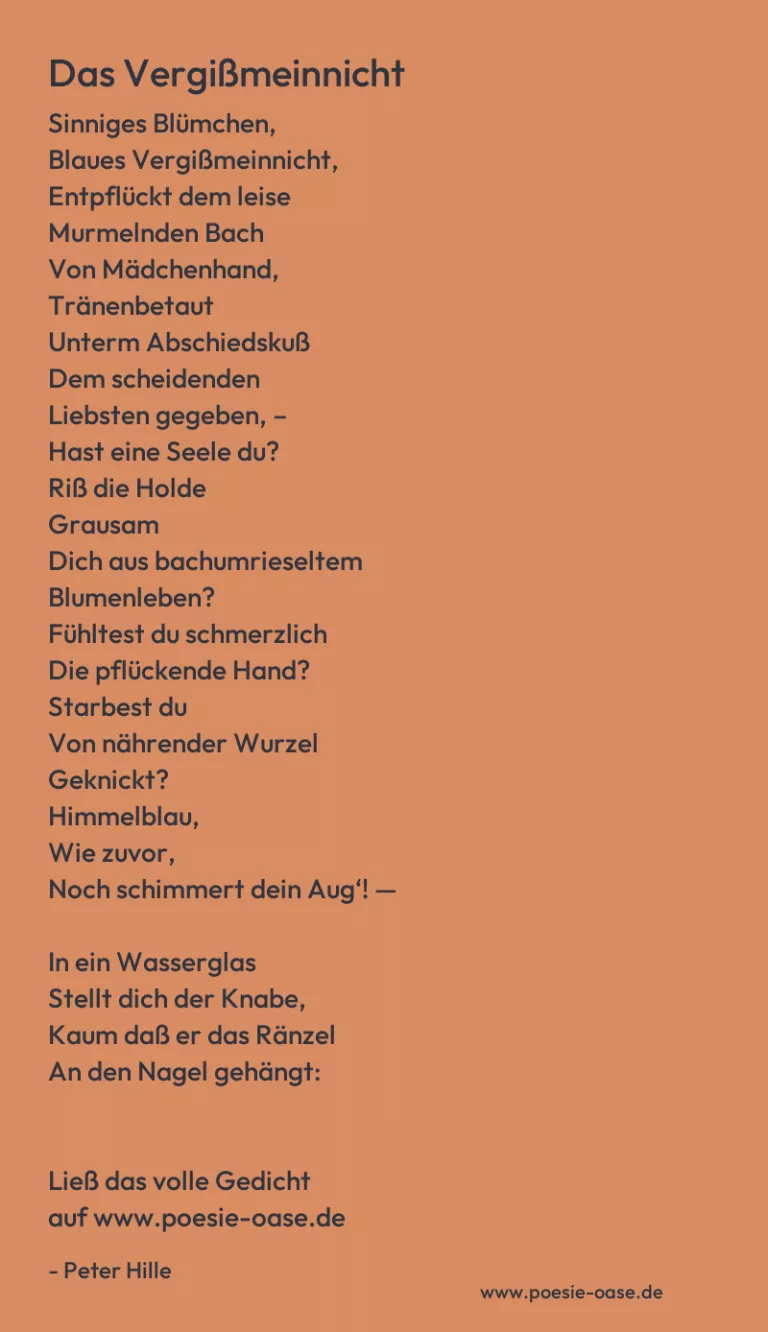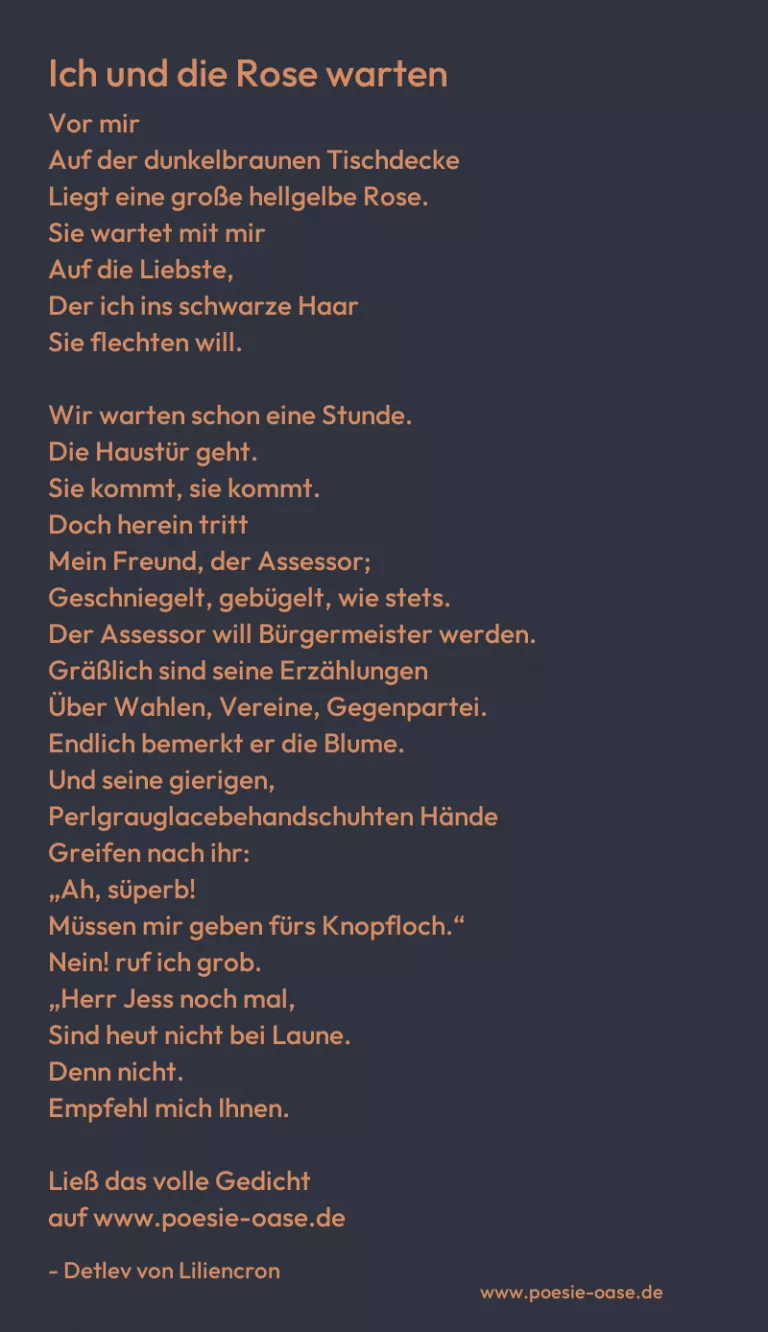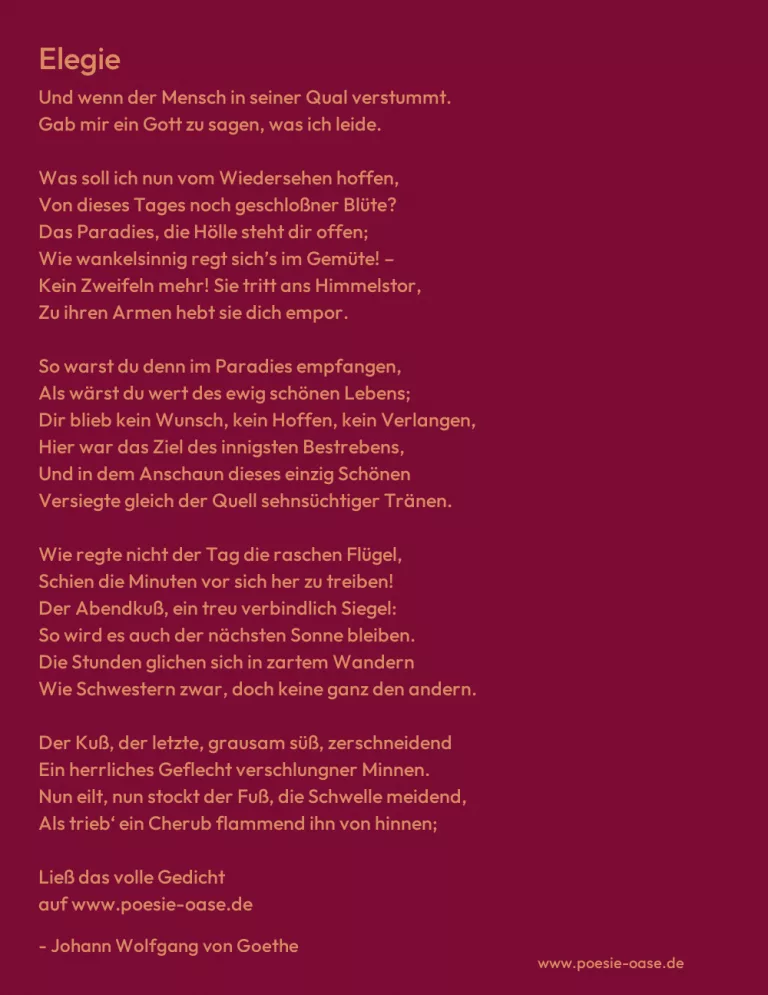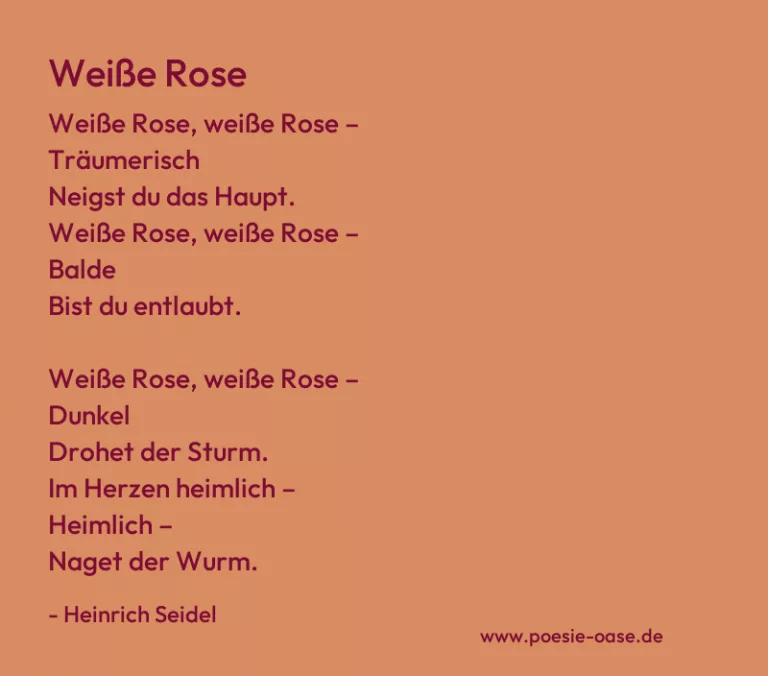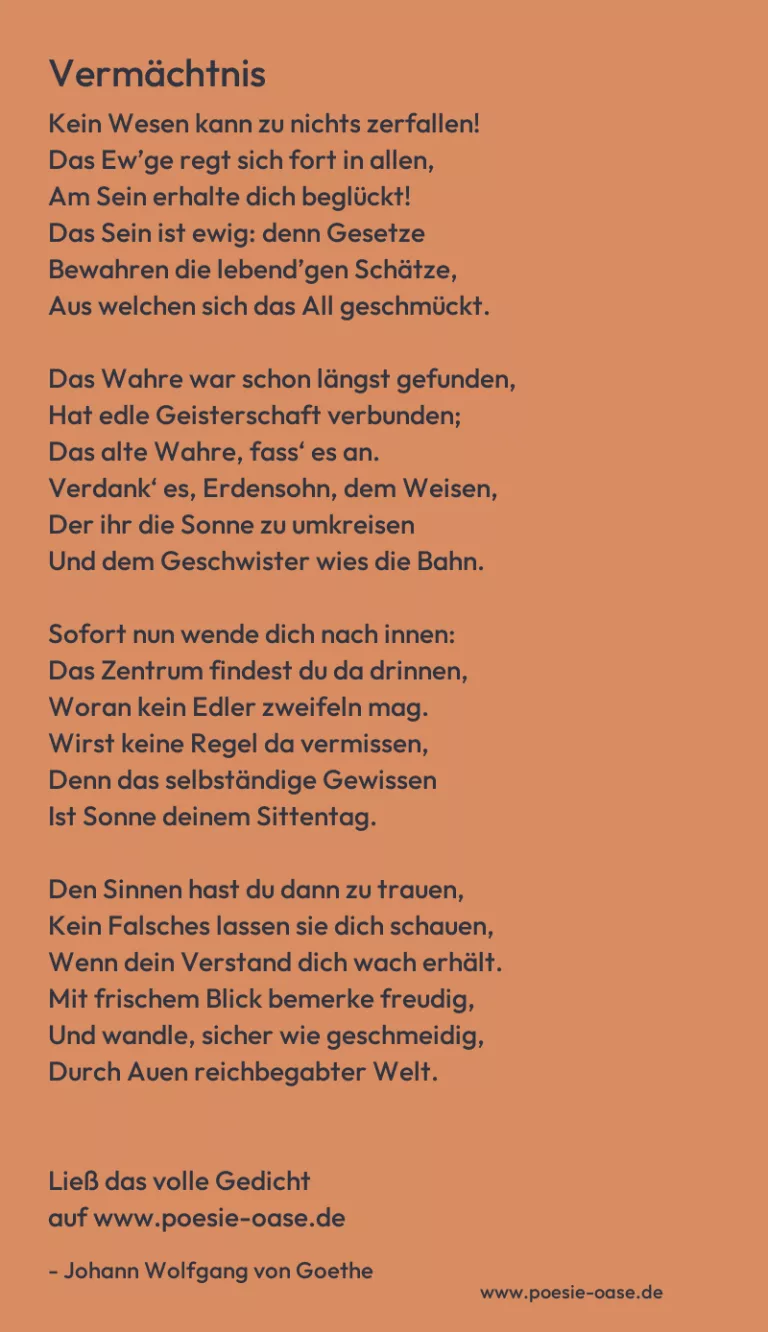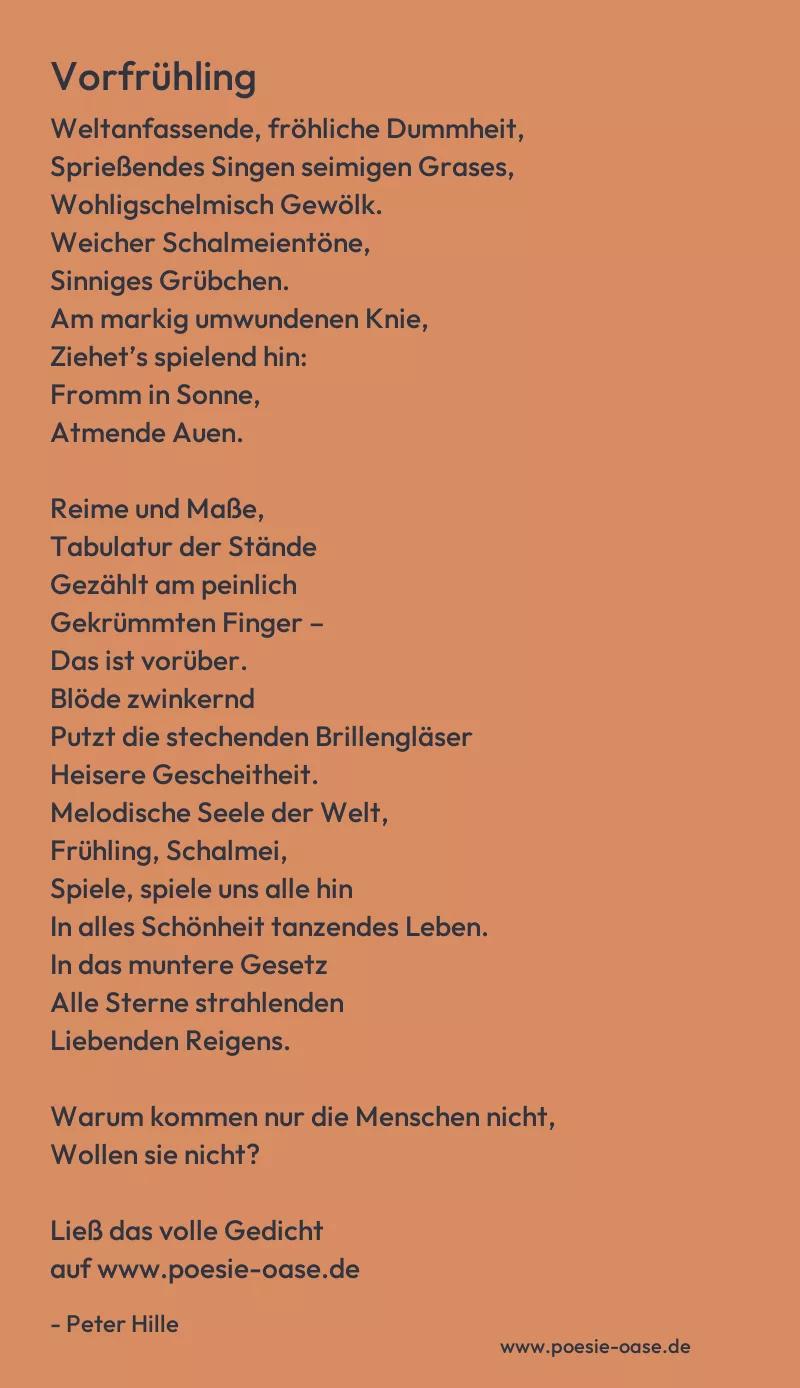Alltag, Flüsse & Meere, Frühling, Gemeinfrei, Glaube & Spiritualität, Götter, Harmonie, Himmel & Wolken, Legenden, Leichtigkeit, Leidenschaft, Liebe & Romantik, Natur, Politik, Religion, Sommer, Weihnachten, Winter
Vorfrühling
Weltanfassende, fröhliche Dummheit,
Sprießendes Singen seimigen Grases,
Wohligschelmisch Gewölk.
Weicher Schalmeientöne,
Sinniges Grübchen.
Am markig umwundenen Knie,
Ziehet’s spielend hin:
Fromm in Sonne,
Atmende Auen.
Reime und Maße,
Tabulatur der Stände
Gezählt am peinlich
Gekrümmten Finger –
Das ist vorüber.
Blöde zwinkernd
Putzt die stechenden Brillengläser
Heisere Gescheitheit.
Melodische Seele der Welt,
Frühling, Schalmei,
Spiele, spiele uns alle hin
In alles Schönheit tanzendes Leben.
In das muntere Gesetz
Alle Sterne strahlenden
Liebenden Reigens.
Warum kommen nur die Menschen nicht,
Wollen sie nicht?
Und
zwingen
zum Tanz?…
Nun –
Und die spatzschreienden Hecken
Und die paarenden Tiere sagen:
Die Welt geht weiter.
Auf vermoderter Triebe Rost
Immer wieder nachquillend
Tauender Teufel bereuender Frost.
Auf der grünen weiteblauen
Himmelswiese
Dauern hin, spielend versonnen,
Weltverlorne Lichtungen,
Locken rötlich träumende Kindesköpfe.
Gelbes rotes strotzendes Feuer
Roter Blumen.
Blitzelt auf bräunlichen Ständern
Suchend wach…
Entgilbender Himmel –
Ist es nicht wärmer schon oben?
Da Gott Vater erst
Und erste Welt;
War das nicht so wie himmlische
Weltanfassende Dummheit.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
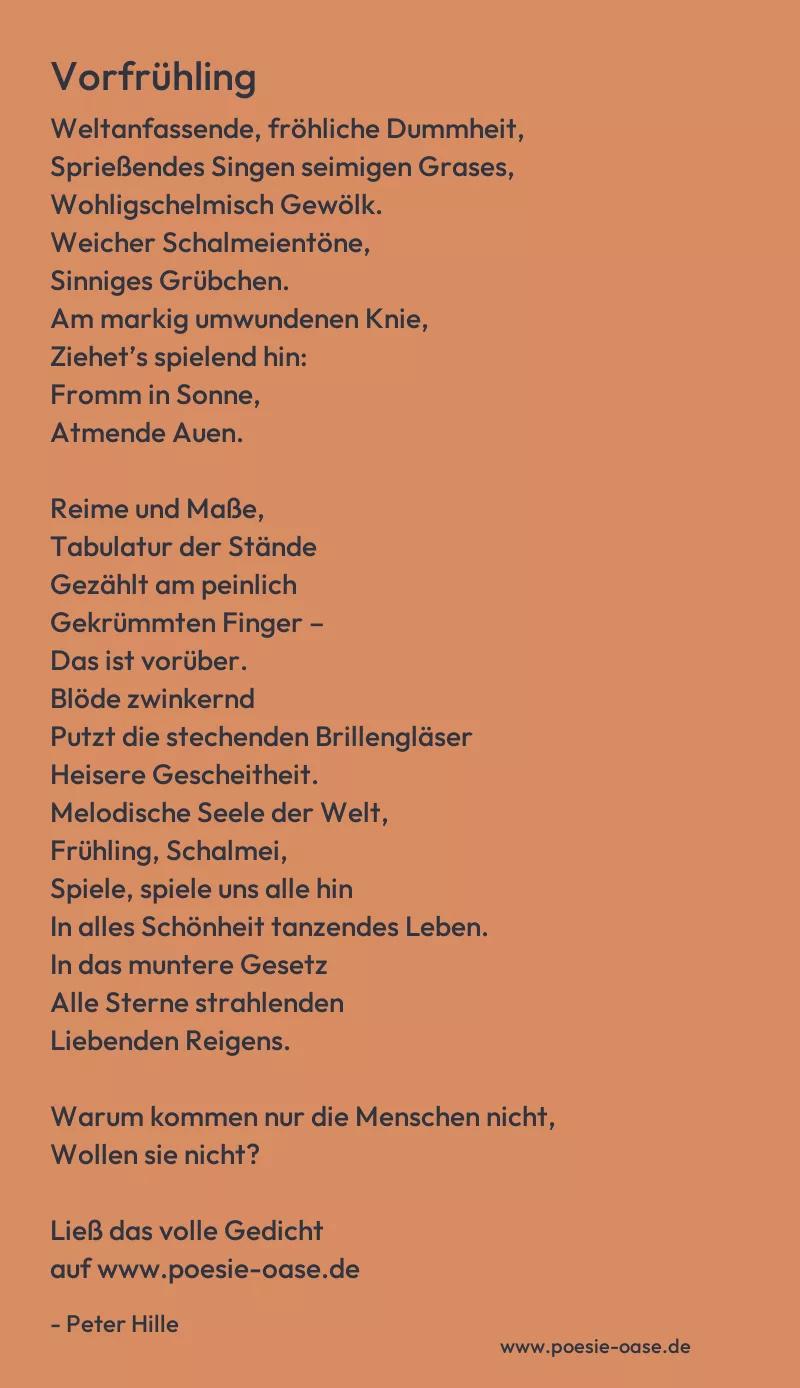
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Vorfrühling“ von Peter Hille ist eine hymnische Feier der erwachenden Natur und der kindlichen Unschuld im Angesicht des kommenden Frühlings. Bereits in der ersten Zeile beschreibt Hille die Welt mit „weltanfassender, fröhlicher Dummheit“, was eine liebenswerte, naive Ursprünglichkeit andeutet. Die Natur zeigt sich im beginnenden Frühling verspielt und unbedarft: „Sprießendes Singen seimigen Grases“ und „wohligschelmisch Gewölk“ erzeugen Bilder von Leichtigkeit und unbeschwertem Erwachen. In dieser Welt wirkt der Frühling wie eine lebendige, musizierende Kraft, symbolisiert durch die „Schalmeientöne“.
Das Gedicht betont den Kontrast zwischen der belebten Natur und der nüchternen, „heiseren Gescheitheit“ des Menschen. Während das „melodische“ Wesen der Welt zu einem tanzenden, freien Leben aufruft, verharrt der Mensch in einem regelhaften, distanzierten Denken – sichtbar etwa im Bild der „Tabulatur der Stände“ und der „gekrümmten Finger“, die das Alte und Erstarrte symbolisieren. Doch diese Zeit scheint vorbei zu sein, der Frühling bricht das Alte auf und lädt ein zum Mitspielen in einem „strahlenden liebenden Reigen“ aller Gestirne.
Doch das lyrische Ich bleibt ambivalent: Es fragt, warum die Menschen diesen natürlichen Tanz verweigern. Statt sich dem Lebensstrom hinzugeben, bleiben sie zurückhaltend, fast wie Zauderer. Im Gegensatz dazu folgen Tiere und Pflanzen dem natürlichen Rhythmus: „Die spatzschreienden Hecken / Und die paarenden Tiere sagen: / Die Welt geht weiter.“ Das Gedicht verweist hier auf den zyklischen Charakter des Lebens – auf dem „Rost vermoderter Triebe“ sprießt stets neues Leben, auch wenn der „bereuende Frost“ des Winters noch nachwirkt.
Zum Ende hin wird die Natur als eine lichtdurchflutete und spielerische Welt beschrieben, in der „weltverlorene Lichtungen“ und „träumende Kindesköpfe“ das Bild der kindlichen Ursprünglichkeit weiterführen. Das „gelbe, rote, strotzende Feuer roter Blumen“ steht für die explosive Kraft des Neubeginns, während der „entgilbende Himmel“ auf das Vergehen des Winters verweist. Die Schlussfrage, ob „es nicht wärmer schon oben“ sei, bringt die Hoffnung auf ein neues, göttlich inspiriertes Leben zum Ausdruck. In der letzten Zeile wird die anfängliche „fröhliche Dummheit“ in einen fast mystischen Kontext gestellt: Sie war vielleicht schon immer Teil einer göttlichen, schöpferischen Ordnung, die den Frühling als Urszene des Lebens feiert.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.