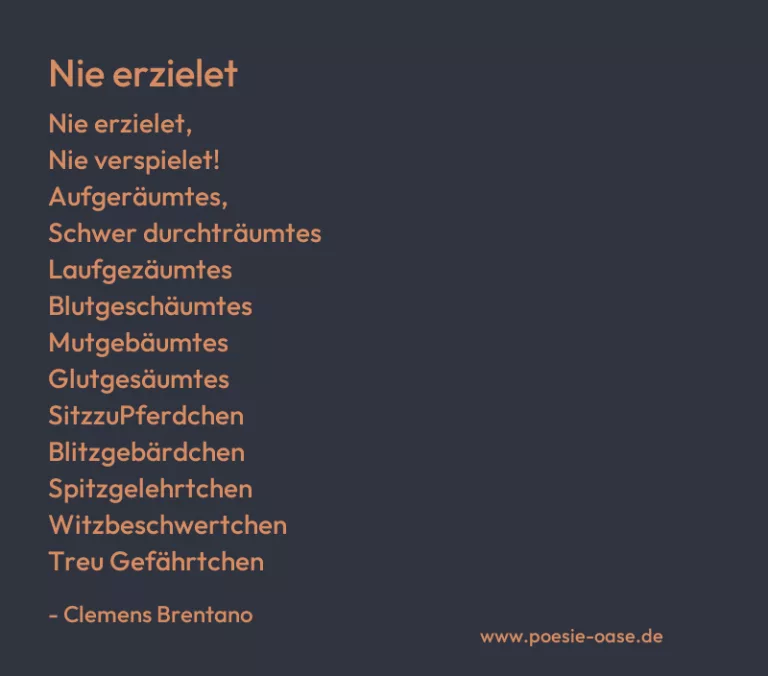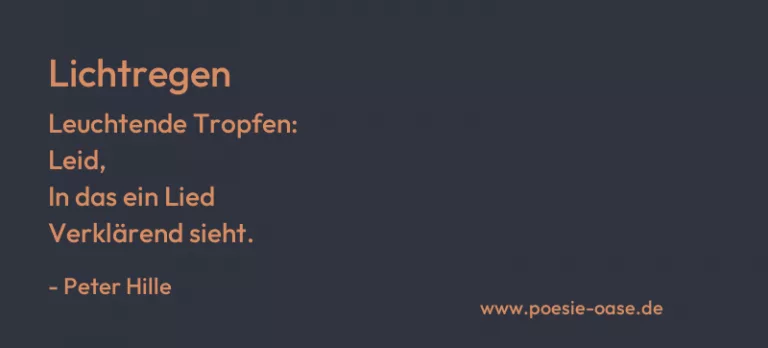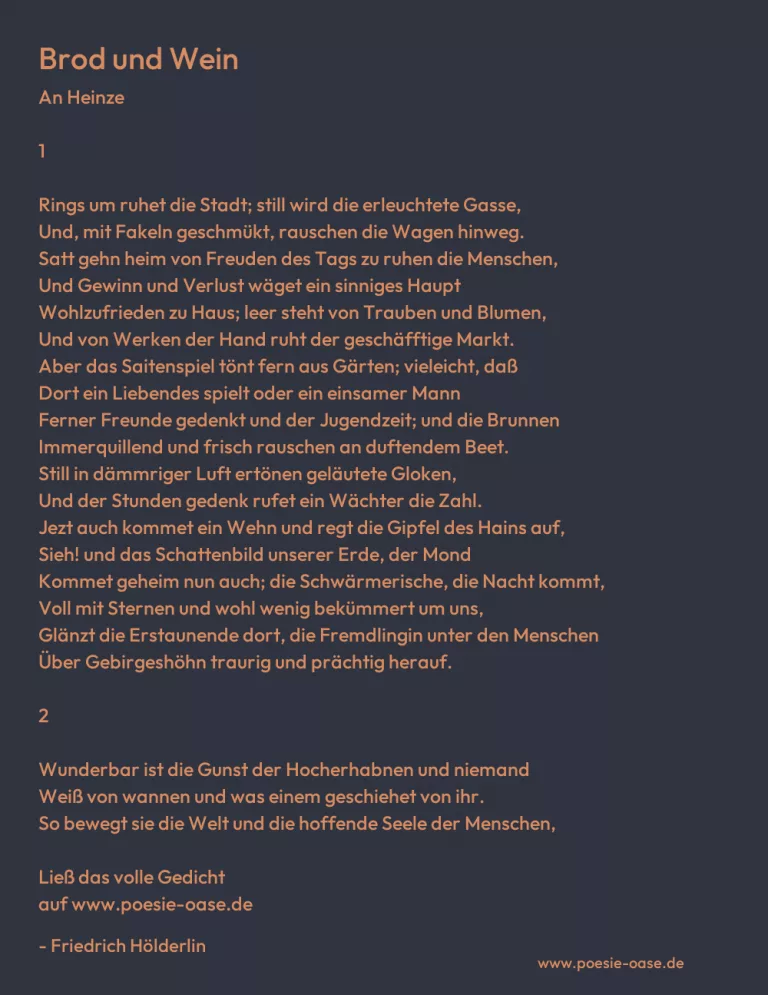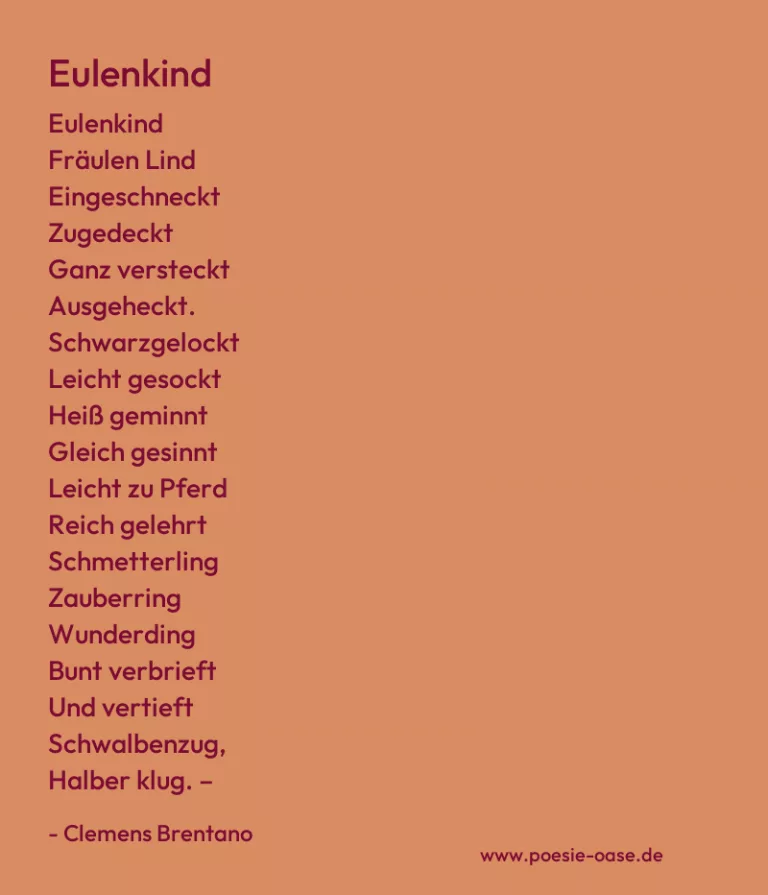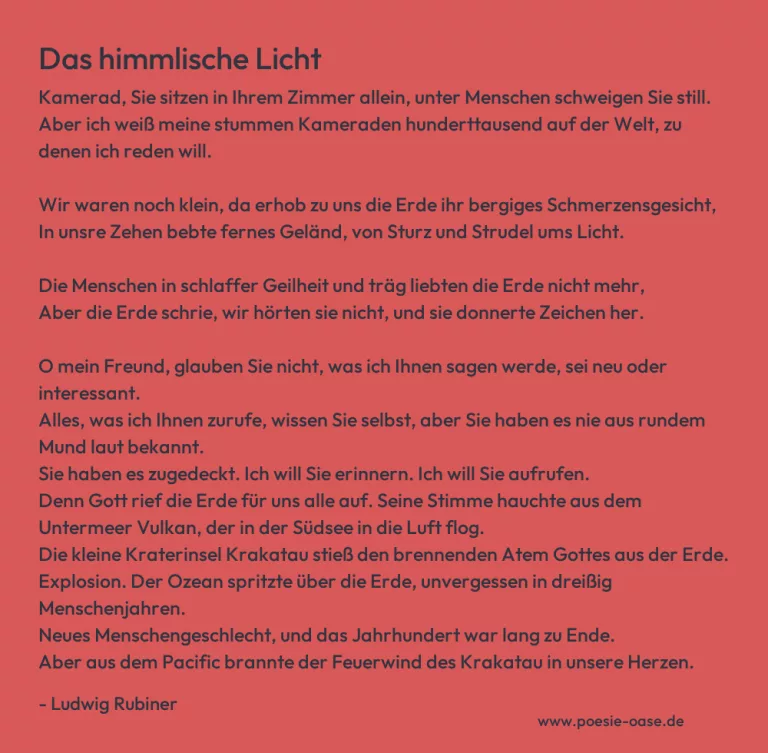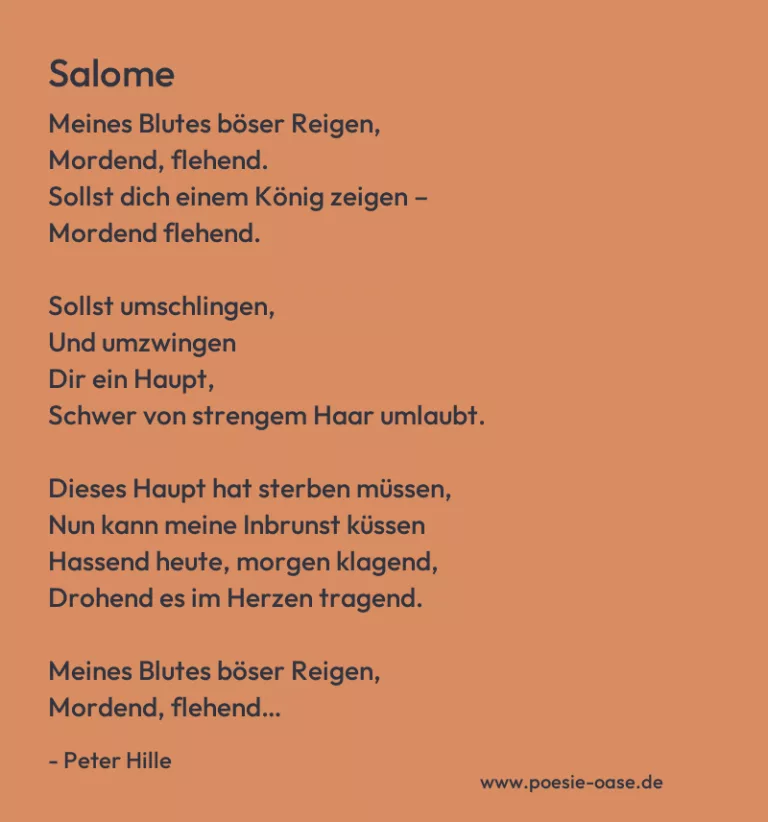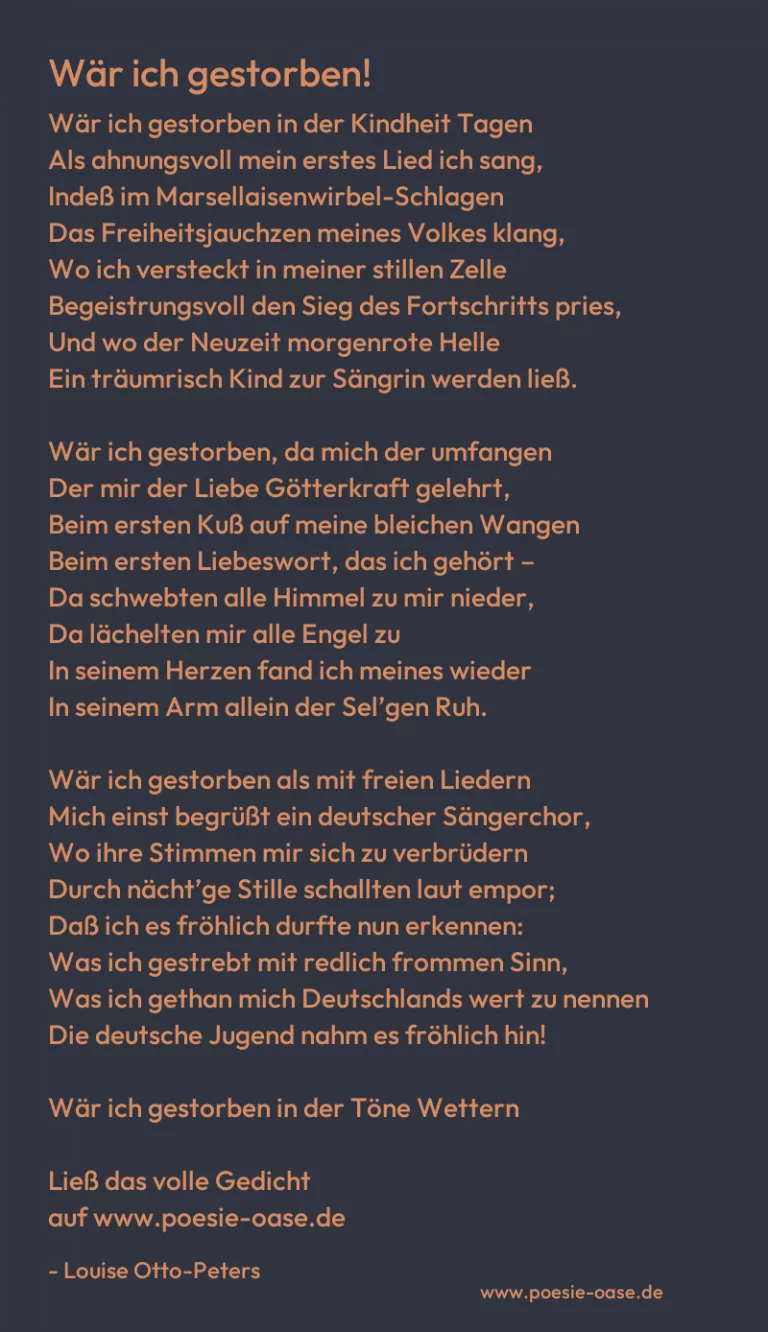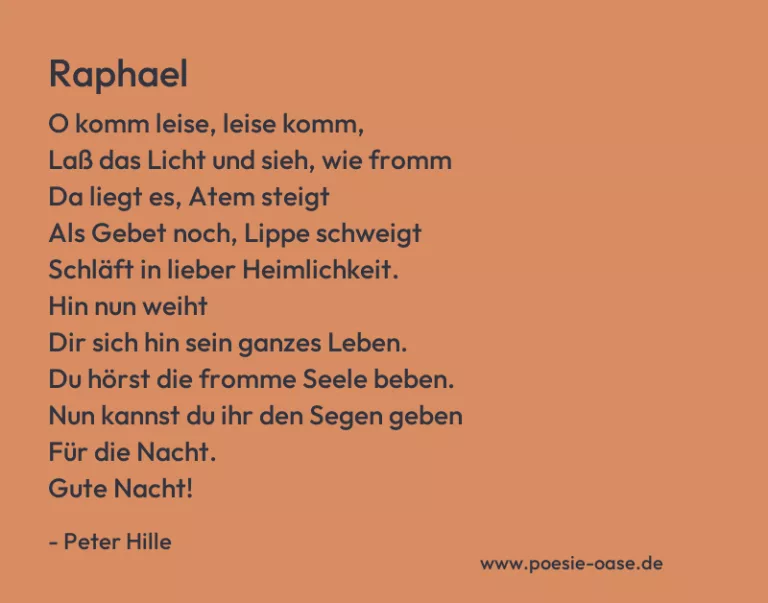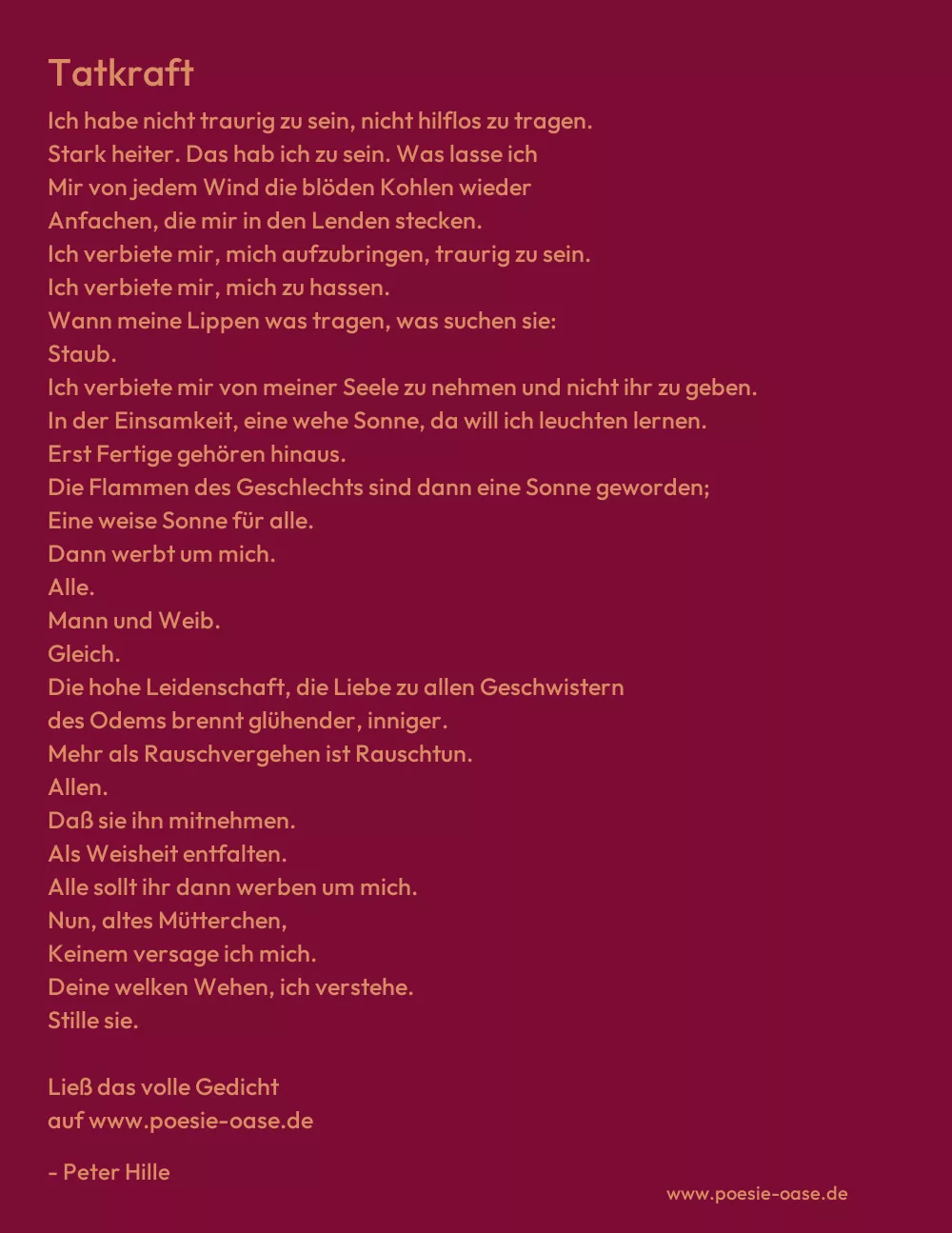Emotionen & Gefühle, Freiheit & Sehnsucht, Frieden, Gemeinfrei, Glaube & Spiritualität, Herbst, Hoffnung, Leichtigkeit, Leidenschaft, Natur, Sommer, Weisheiten
Tatkraft
Ich habe nicht traurig zu sein, nicht hilflos zu tragen.
Stark heiter. Das hab ich zu sein. Was lasse ich
Mir von jedem Wind die blöden Kohlen wieder
Anfachen, die mir in den Lenden stecken.
Ich verbiete mir, mich aufzubringen, traurig zu sein.
Ich verbiete mir, mich zu hassen.
Wann meine Lippen was tragen, was suchen sie:
Staub.
Ich verbiete mir von meiner Seele zu nehmen und nicht ihr zu geben.
In der Einsamkeit, eine wehe Sonne, da will ich leuchten lernen.
Erst Fertige gehören hinaus.
Die Flammen des Geschlechts sind dann eine Sonne geworden;
Eine weise Sonne für alle.
Dann werbt um mich.
Alle.
Mann und Weib.
Gleich.
Die hohe Leidenschaft, die Liebe zu allen Geschwistern
des Odems brennt glühender, inniger.
Mehr als Rauschvergehen ist Rauschtun.
Allen.
Daß sie ihn mitnehmen.
Als Weisheit entfalten.
Alle sollt ihr dann werben um mich.
Nun, altes Mütterchen,
Keinem versage ich mich.
Deine welken Wehen, ich verstehe.
Stille sie.
Und euch ihr Barden, wie werde ich dann euch erst lüften.
Ihr Unfertigen, die ihr euch an Unfertige kauert.
Wollt ihr auseinander.
Auseinander sage ich.
Ich will euch helfen, eure Blöße zu verdecken!
Ihr müden, mürrischen Felsen, die ihr die Nässe liebt!
Und dann meint: Ihr seid Gärten.
Es gibt nur einen Stern für uns.
Den Mannesstern.
Den grauen Stern der Tatkraft.
Und hoch lodert aller Welten suchendes Können in einer klaren, blanken, aller Kräfte Wirbel ruhig lachenden Flamme.
Das will der Weltvater von allen.
Ach ihr Schelme!
Ihr Träumenden!
Ihr leichtgewandigen, zierlichen Flammen!
Wie so schelmisch ihr tanzt – Barden auf Kugeln.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
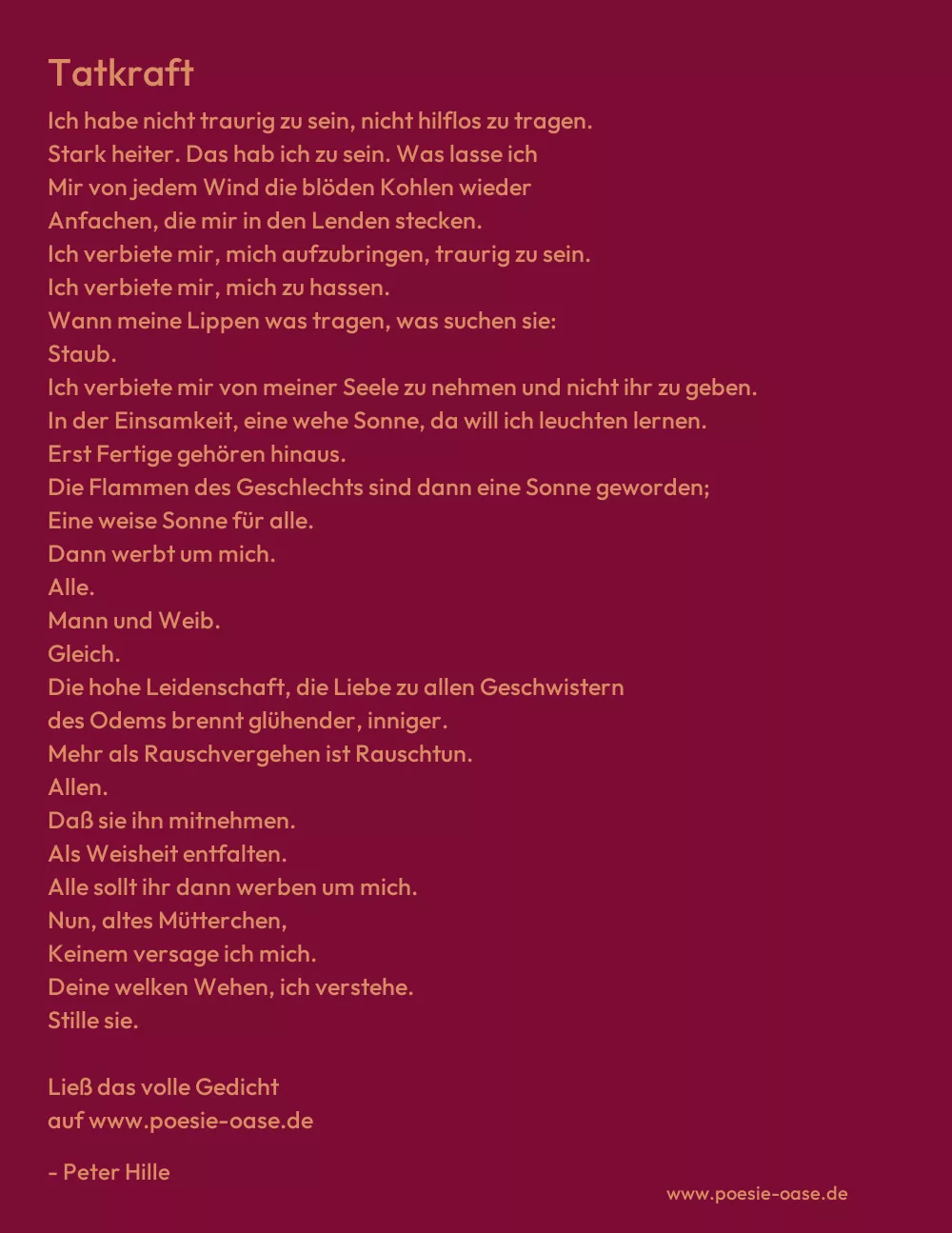
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Tatkraft“ von Peter Hille ist ein leidenschaftliches Plädoyer für innere Stärke, Selbstbeherrschung und eine aktive, zielgerichtete Lebensführung. Bereits zu Beginn stellt das lyrische Ich klar, dass es sich nicht in Traurigkeit oder Hass verlieren will, sondern eine „stark heitere“ Haltung einnimmt. Der Wille zur Selbstdisziplin und zur Kontrolle über die eigenen Gefühle steht im Zentrum, etwa wenn es heißt: „Ich verbiete mir, mich aufzubringen, traurig zu sein.“ Diese Selbstermächtigung wird als Voraussetzung für eine tiefere Reifung und Verantwortung verstanden.
Ein wesentliches Motiv ist der Übergang von der inneren Unruhe und Unreife zur geistigen Reife und Weisheit. Die „Flammen des Geschlechts“ – ein Bild für die wilden, triebhaften Energien – sollen zur „Sonne“ werden, also zu einer kraftvollen, lebensspendenden und beherrschten Energie. Erst wenn diese Wandlung vollzogen ist, kann sich das Ich der Welt in seiner ganzen Reife und Stärke zeigen. Besonders auffällig ist die Vorstellung, dass Mann und Frau „gleich“ um diese gereifte Kraft werben sollen – ein Hinweis auf eine überpersönliche, fast spirituelle Form der Liebe, die über das rein Individuelle hinausgeht.
Hille kritisiert in seinem Gedicht zugleich die Halbherzigkeit und Unfertigkeit seiner Mitmenschen, etwa wenn er von den „Unfertigen“ spricht, die sich „an Unfertige kauern“. Er fordert eine klare Trennung von der Selbsttäuschung und Schwäche, die in der bequemen Untätigkeit oder im bloßen Träumen bestehen. Die „müden, mürrischen Felsen“, die sich für Gärten halten, stehen sinnbildlich für die, die sich in ihrer Stagnation eingerichtet haben. Dagegen propagiert das lyrische Ich den „Mannesstern“ – ein Symbol für Tatkraft, Klarheit und Schaffenskraft.
Am Ende klingt auch ein ironischer Ton an, wenn die „Schelme“ und „Barden“ als „leichtgewandige, zierliche Flammen“ dargestellt werden, die spielerisch über Kugeln tanzen. Dies entlarvt eine Art von naivem Künstlertum oder Träumerei, die dem Anspruch des Gedichts auf Reife und Ernsthaftigkeit nicht genügt. Insgesamt fordert „Tatkraft“ eine Wandlung vom Unreifen zum Starken, vom Suchenden zum Handelnden und von der Vereinzelung zur brennenden, universellen Liebe zu allen Menschen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.