Im Pausengange
Paar auf Paar,
Die Mädchenschar,
Die umschlingen
Mit bunten Ringen,
Die zerdrücken
Die starken Rücken
Der Männer wird.
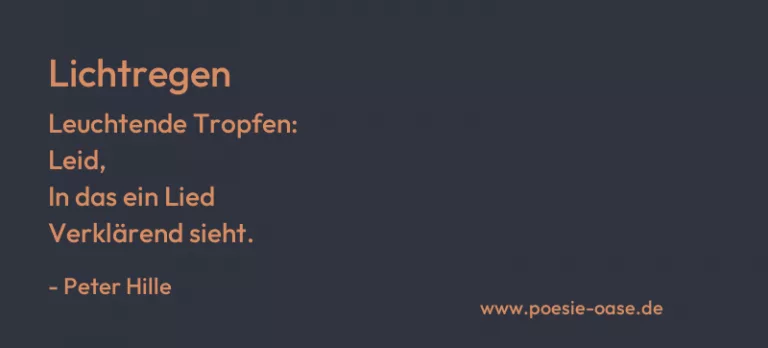
Lichtregen
- Gemeinfrei
- Herzschmerz
Im Pausengange
Paar auf Paar,
Die Mädchenschar,
Die umschlingen
Mit bunten Ringen,
Die zerdrücken
Die starken Rücken
Der Männer wird.

Das Gedicht „Schulschlange“ von Peter Hille beschreibt in knapper Form eine Szene aus dem Pausenhof, in der eine Gruppe von Schülerinnen eine Art Kette oder „Schlange“ bildet. Das Bild der „Mädchenschar“ und der „bunten Ringe“ deutet darauf hin, dass sich die Mädchen in spielerischer Weise an den Armen fassen oder umarmen, um eine geschlossene Formation zu bilden. Diese „Schulschlange“ ist gleichzeitig ein Ausdruck kindlicher Unbeschwertheit und sozialer Dynamik.
Im weiteren Verlauf verschiebt sich die Perspektive, als die scheinbar harmlose Spielerei eine überraschende Wendung nimmt. Die „bunten Ringe“ wirken nicht mehr nur verspielt, sondern entwickeln eine Kraft, die „die starken Rücken der Männer“ bedrückt oder „zerdrückt“. Hier entsteht eine Metapher für die Macht, die diese Gemeinschaft – auch wenn sie zunächst unschuldig erscheint – ausüben kann. Die „Männer“ könnten wörtlich für männliche Schüler stehen, aber auch sinnbildlich für eine größere, gesellschaftliche Rolle von Männlichkeit und Autorität.
Hille nutzt die scheinbar einfache Schulszene, um ein komplexeres Spannungsfeld zwischen Spiel und Ernst, Kindlichkeit und späterer Stärke anzudeuten. Die „Schulschlange“ wird so zum Symbol für das Heranwachsen der Mädchen und für die unterschwellige Kraft, die von solchen Gruppenbindungen ausgehen kann. In der Kürze des Textes liegt eine feine Ironie und die Andeutung, dass aus kindlichen Spielen später ernsthafte Machtverhältnisse entstehen können.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.