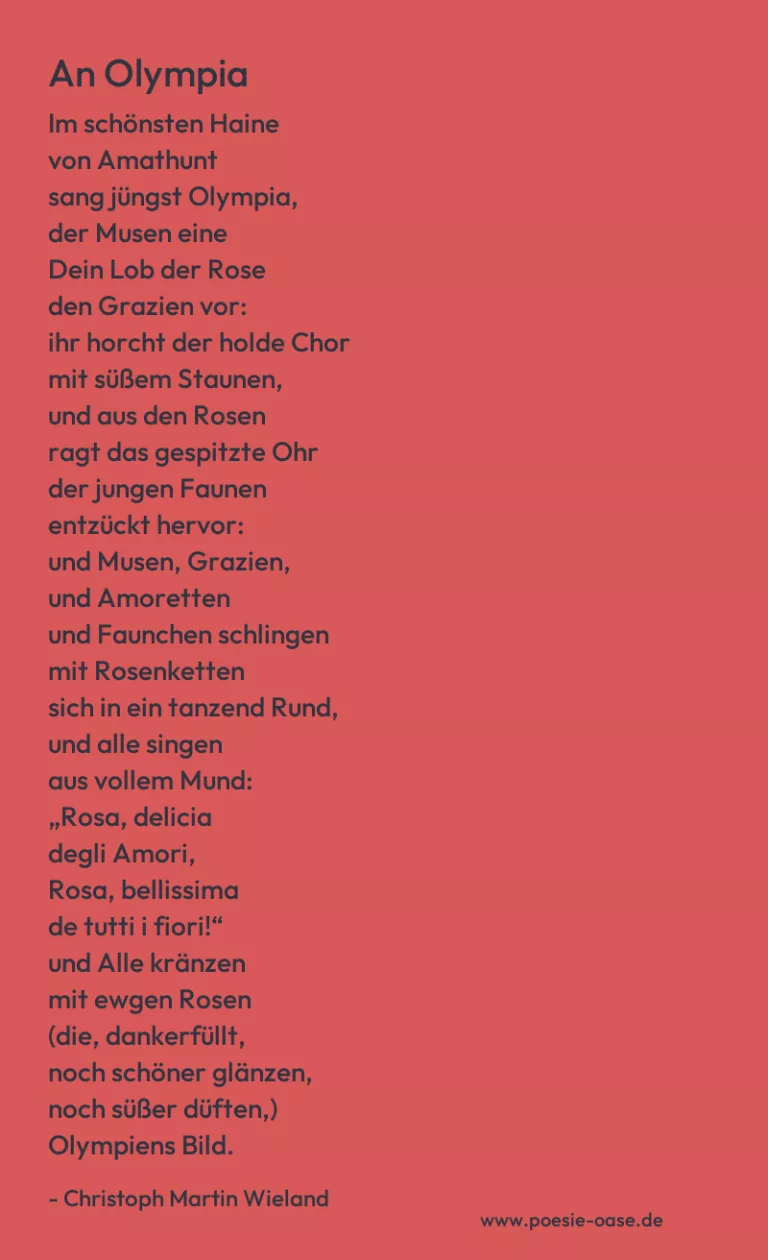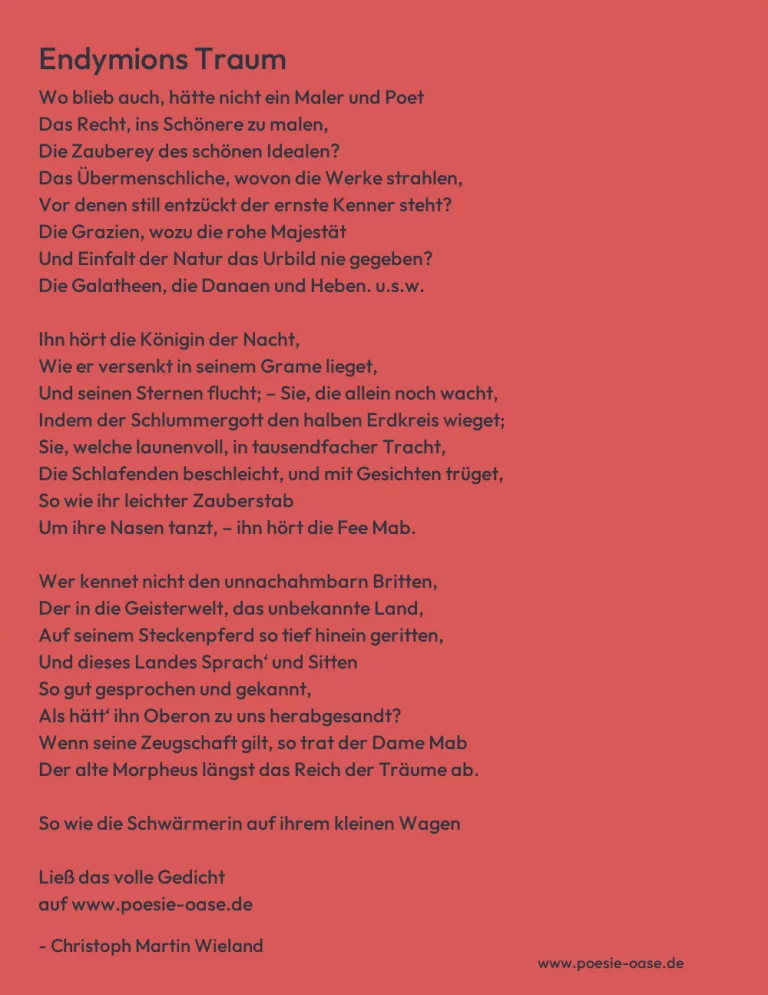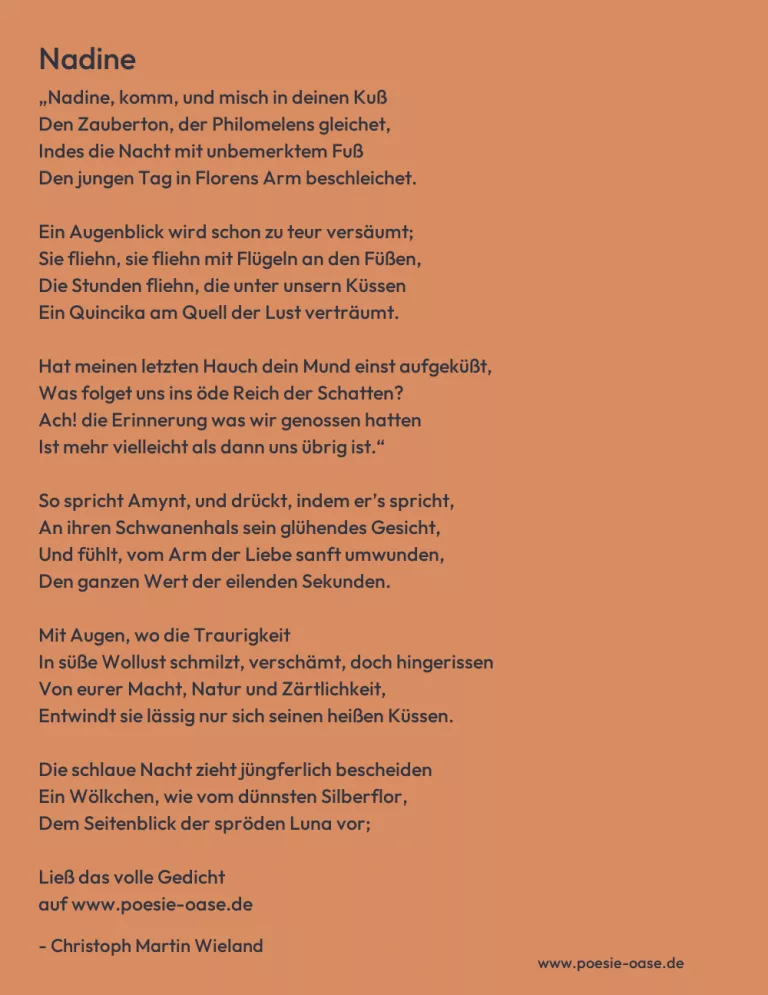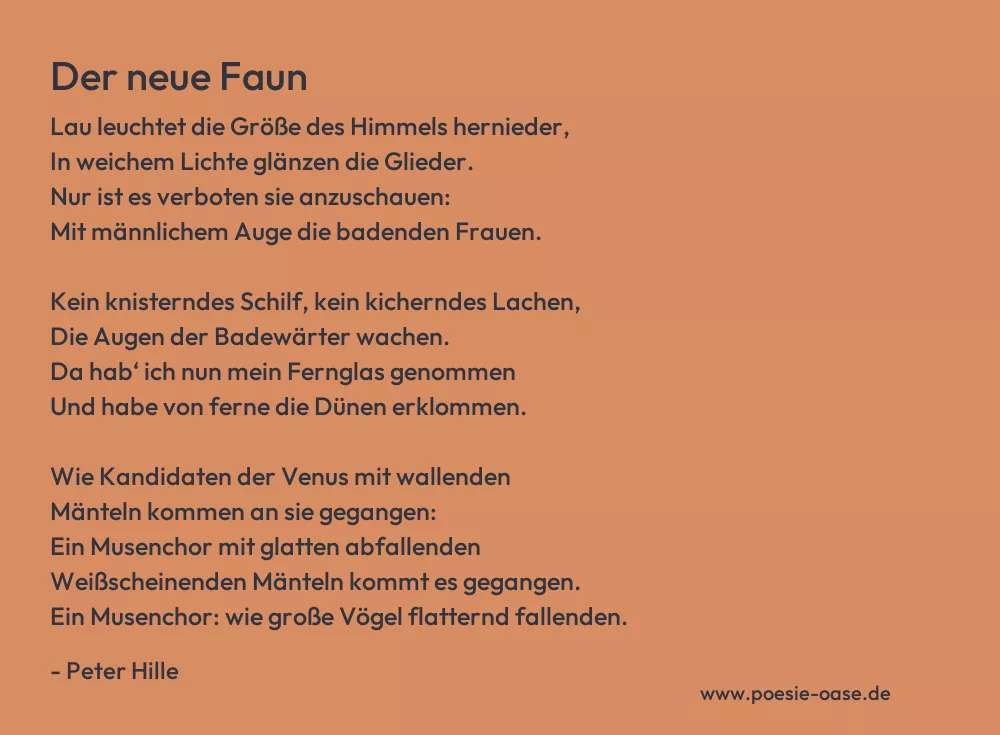Der neue Faun
Lau leuchtet die Größe des Himmels hernieder,
In weichem Lichte glänzen die Glieder.
Nur ist es verboten sie anzuschauen:
Mit männlichem Auge die badenden Frauen.
Kein knisterndes Schilf, kein kicherndes Lachen,
Die Augen der Badewärter wachen.
Da hab‘ ich nun mein Fernglas genommen
Und habe von ferne die Dünen erklommen.
Wie Kandidaten der Venus mit wallenden
Mänteln kommen an sie gegangen:
Ein Musenchor mit glatten abfallenden
Weißscheinenden Mänteln kommt es gegangen.
Ein Musenchor: wie große Vögel flatternd fallenden.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
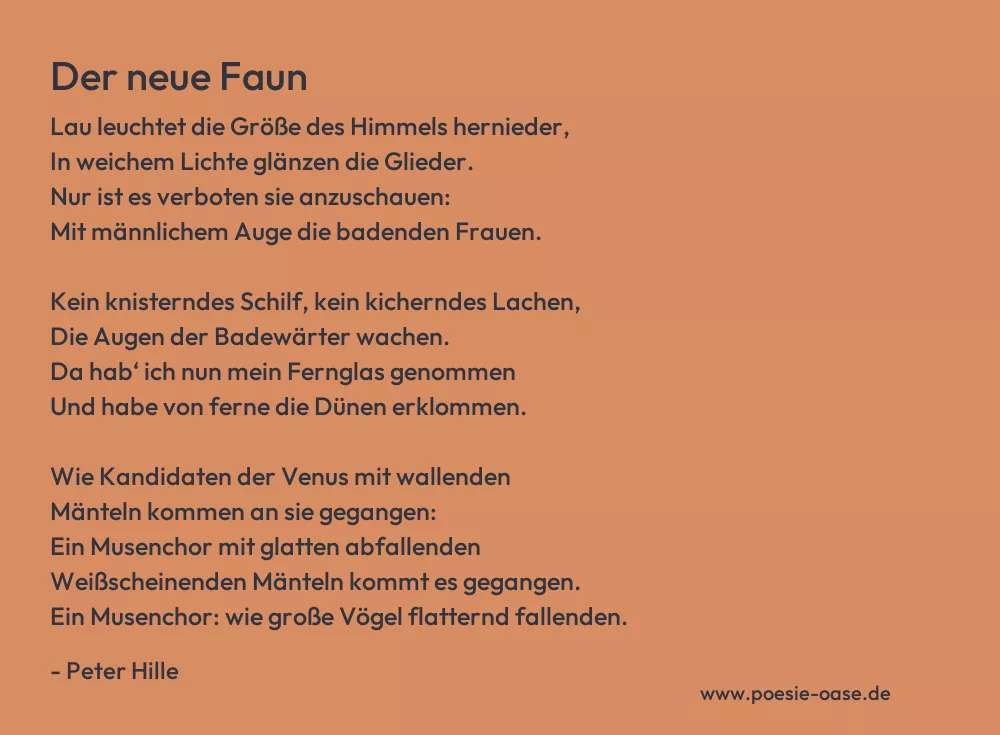
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der neue Faun“ von Peter Hille spielt mit dem Gegensatz zwischen Naturidylle und verbotener Begierde. Bereits der Titel verweist auf die Figur des Fauns, ein Mischwesen aus der antiken Mythologie, das für Lust, Naturverbundenheit und Spontaneität steht. Im ersten Vers wird eine sanfte, fast traumhafte Stimmung erzeugt: „Lau leuchtet die Größe des Himmels hernieder“ und das weiche Licht, das die „Glieder“ glänzen lässt, erschafft eine friedliche und sinnliche Atmosphäre. Doch diese Idylle wird sofort durch das „Verbot“, die „badenden Frauen“ mit männlichem Blick zu betrachten, gestört. Hier deutet sich bereits eine ironische Brechung an.
Das Gedicht nimmt im zweiten Teil eine humorvolle Wendung: Trotz des Verbots nimmt das lyrische Ich sein Fernglas zur Hand und beobachtet aus der Ferne das Geschehen, indem es die „Dünen erklimmt“. Hier wird das Motiv des verbotenen Blicks aufgenommen, das an voyeuristische Elemente erinnert. Die Beschreibung der „wachsamen Badewärter“ unterstreicht das Gefühl einer gewissen Grenzüberschreitung, aber auch die Komik der Situation – der Sprecher nimmt die Rolle eines modernen, neugierigen Fauns ein.
In der dritten Strophe steigert sich die Szene in eine fast mystische Vision. Die Frauen werden als „Kandidaten der Venus“ bezeichnet und erscheinen wie ein „Musenchor“, der sich anmutig bewegt. Die weißen, gleitenden Mäntel, die an „flatternde Vögel“ erinnern, verbinden die badenden Frauen mit klassischen Bildern der Kunst und Mythologie – als seien sie Erscheinungen aus einer antiken Welt, zugleich rein und sinnlich. Diese Bildsprache verleiht der Szene eine ästhetische und poetische Aufladung.
Hille vereint in diesem Gedicht das Thema der Naturbeobachtung mit der ironischen Selbstdarstellung des lyrischen Ichs als moderner Faun. Zwischen sinnlicher Bewunderung und leicht spöttischem Unterton schwankt der Text und thematisiert so das Wechselspiel zwischen Verlangen, künstlerischer Inspiration und gesellschaftlicher Norm. Der „neue Faun“ steht hier sinnbildlich für eine Figur, die zwischen Naturinstinkt und Kultur, zwischen Schaulust und ästhetischem Staunen vermittelt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.