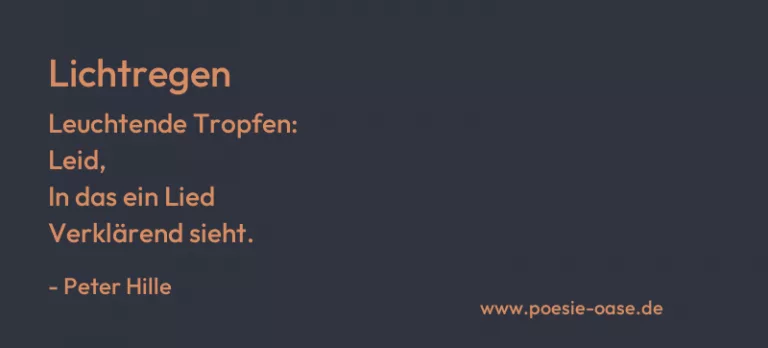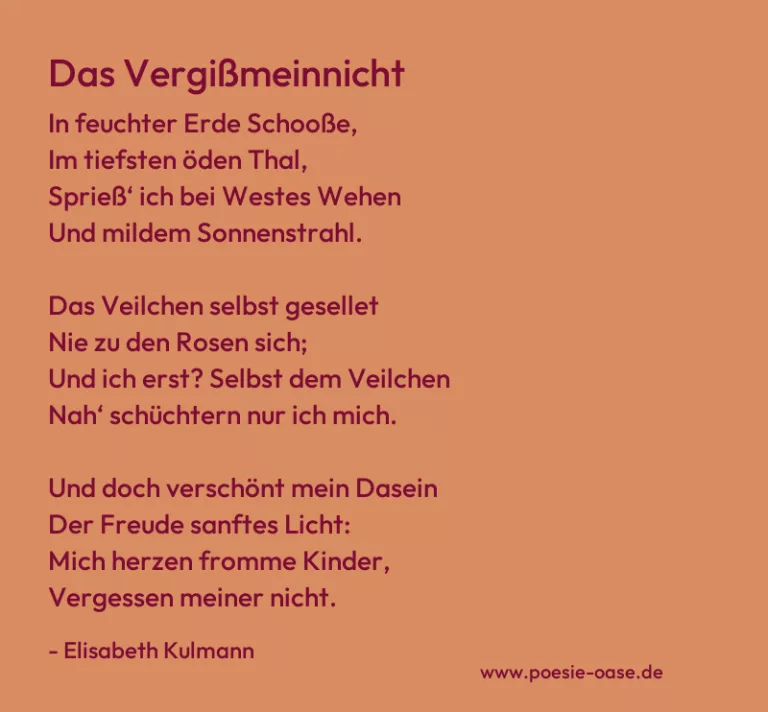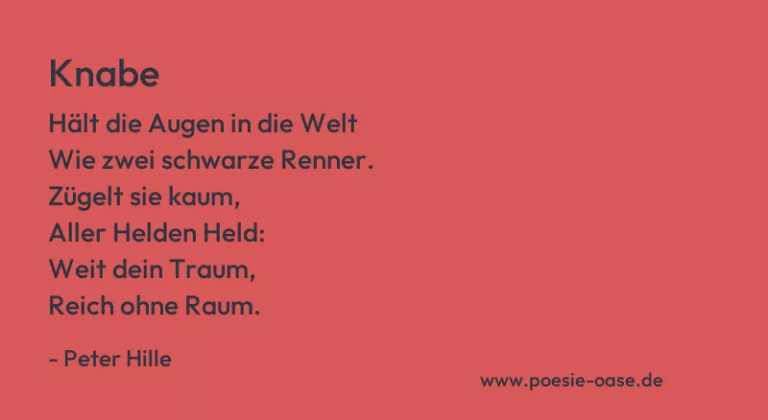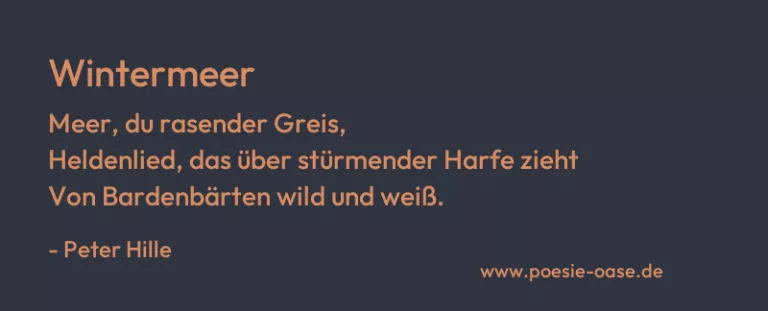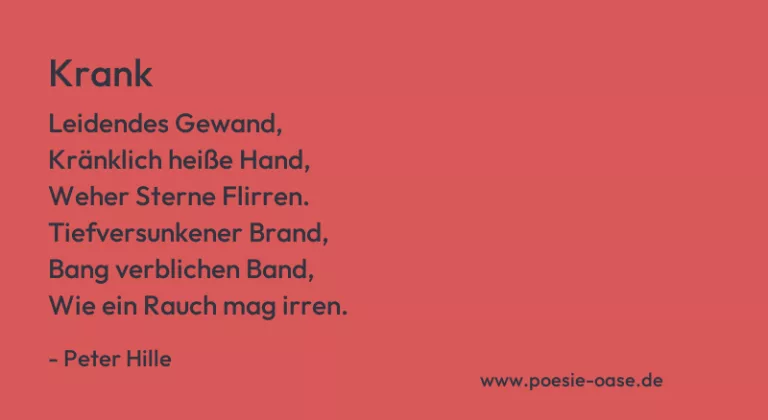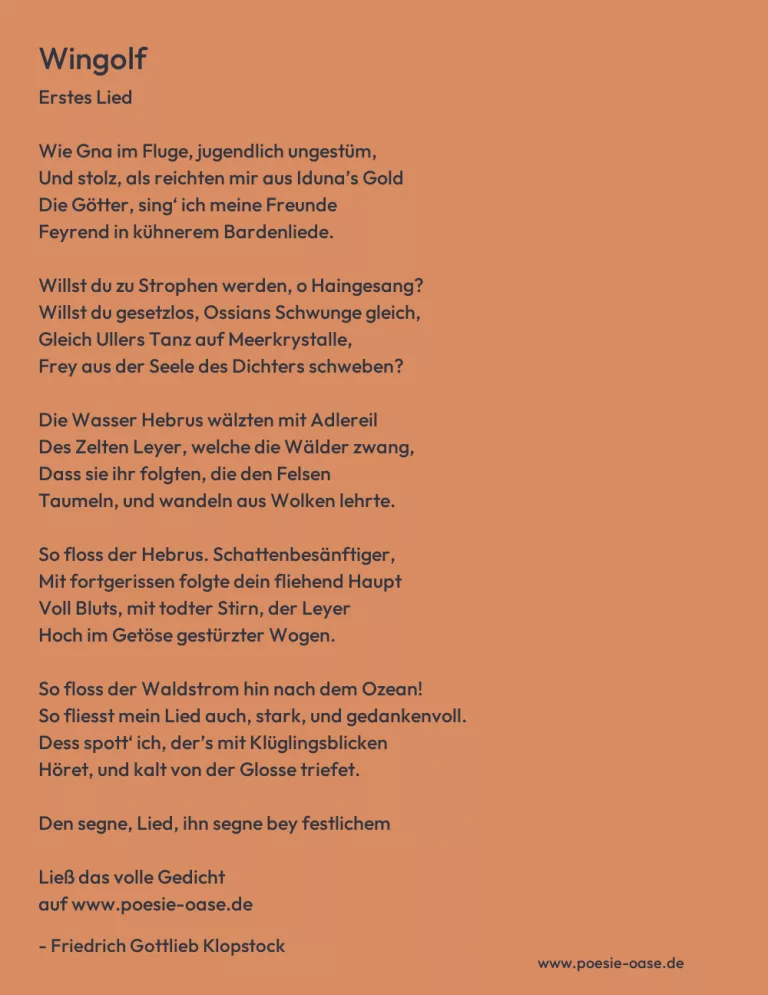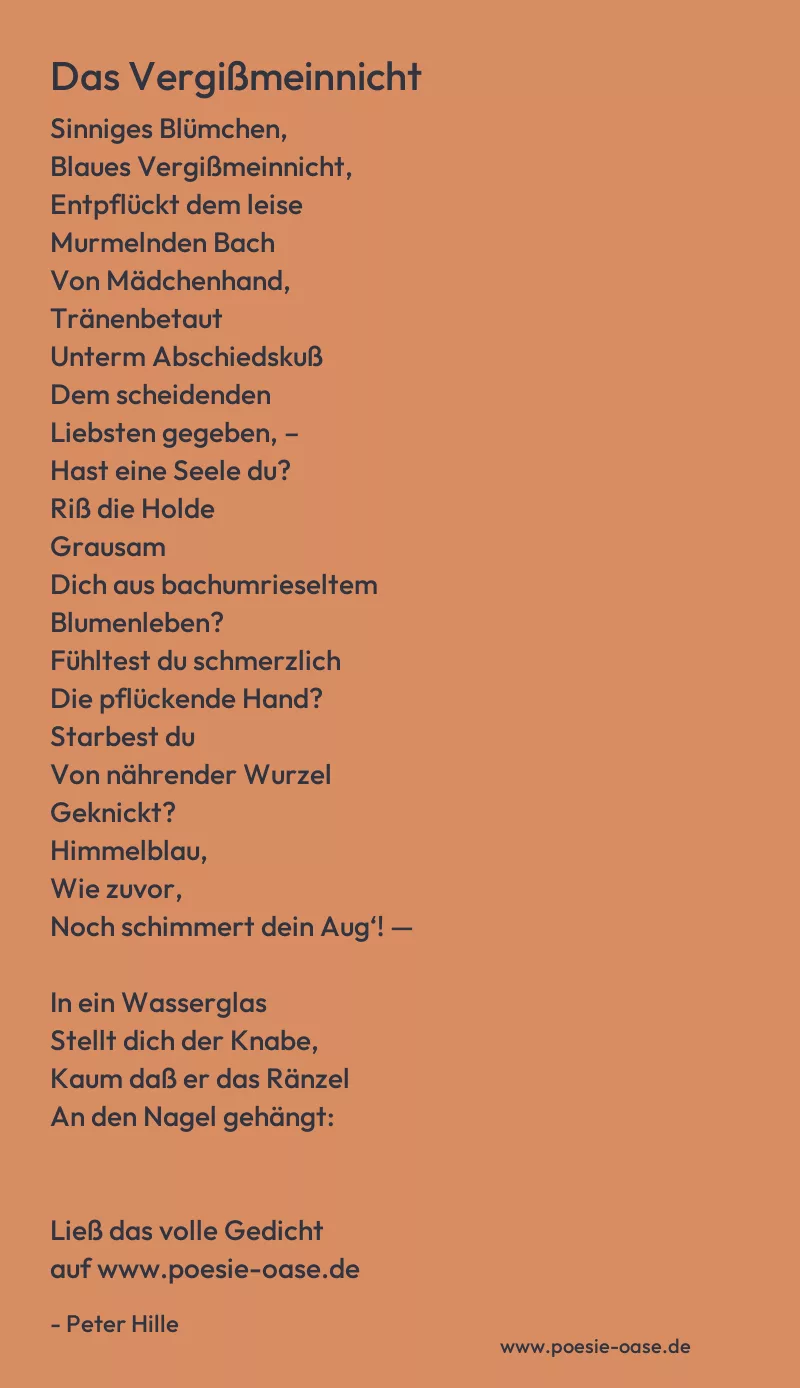Sinniges Blümchen,
Blaues Vergißmeinnicht,
Entpflückt dem leise
Murmelnden Bach
Von Mädchenhand,
Tränenbetaut
Unterm Abschiedskuß
Dem scheidenden
Liebsten gegeben, –
Hast eine Seele du?
Riß die Holde
Grausam
Dich aus bachumrieseltem
Blumenleben?
Fühltest du schmerzlich
Die pflückende Hand?
Starbest du
Von nährender Wurzel
Geknickt?
Himmelblau,
Wie zuvor,
Noch schimmert dein Aug‘! —
In ein Wasserglas
Stellt dich der Knabe,
Kaum daß er das Ränzel
An den Nagel gehängt:
Und frisch bleibst du,
Blühend
Als wenn noch
Wurzelnd du ständest im Bach.
Oft zur Sehnsuchtsstunde
Der Dämmerung
Nimmt er dich aus dem Glase,
Betrachtet dich innig,
Liebesbote du,
Von ihrer Hand
Mit Tränen benetzt,
Gewandert in seine. —
Die Linke im braunen Gelock,
Ans Fenster sich lehnend,
So sieht er mit sehnendem Blick
Hinaus in die Gegend,
Wo weit dahinten
Sein Liebchen weilt.
Seine Gedanken gehen
Weit die Giebel hinüber,
Die Türme und Mauern der Stadt
Weit, weit hinweg,
Bis wo in stiller Kammer
Ein Mägdlein steht am Fenster,
Und Tränen der Wehmut
Im Auge
Ins blassende Abendrot sieht…
Jetzt, Vergißmeinnicht,
Streift dich sein Auge,
Er küßt anstatt der lieben
Geberin dich.
Fühltest du seinen Kuß,
Blume der Treue,
Zürnst du der Maid,
Daß dein Leben sie kürzte,
Das nun bald welkende?
Oder lispelst
Ihre Mahnung
Dem Jüngling zu,
Ihr Tränenwort:
„Vergiß nicht mein!“